Ich glaube, man muss andere Fragen stellen
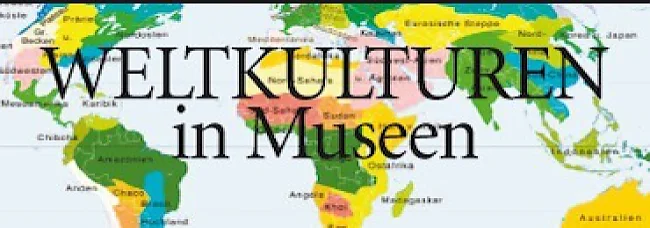
Deutschlands kurze und kleine Kolonialgeschichte war die Grundlage für die meisten volkskundlichen Sammlungen. In der breiten Bevölkerung finden diese Schätze heute wenig Beachtung. Seit einigen Jahren versuchen die Museen, sich neu aufzustellen und sich populärer und zeitgemäßer zu präsentieren. Weil dieser Trend in vielen Städten spürbar ist und einige Museen nun auch in neuen Häusern arbeiten können, begab sich Clair Lüdenbach auf Reisen und befragte Museumsleiter und Kustoden. Zum Auftakt dieser Reihe sprach sie mit der Ethnologin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin Larissa Förster am Internationalen Kolleg Morphomata in Köln über die Gründe für diese Entwicklung.
Clair Lüdenbach im Gespräch mit Larissa Förster, Köln
Clair Lüdenbach: Was hat den Wandel im Ausstellungskonzept der ethnologischen Sammlungen ausgelöst?
Larissa Förster: Ich würde nicht sagen, dass es ein auslösendes Moment gegeben hat. Man hat aber in den letzten Jahrzehnten immer wieder festgestellt, dass die ethnologischen Sammlungen für das, was man früher damit machen wollte, nämlich andere Gesellschaften zu erklären, zu vermitteln und Verständnis zu schaffen – dass das mit den Objekten nicht so leicht ist; denn jede gute Arte-Dokumentation vermittelt einem möglicherweise viel plastischer, wie heute jemand auf Samoa lebt und arbeitet. Das hat dazu geführt, dass die Museen nachdenken müssen, was kann denn dieser Auftrag noch sein, in einer Zeit, wo man reisen kann, wo man global fernsehen kann, – was können wir mit unseren Objekten machen? Dazu kommt, dass in vielen ethnologischen Museen ein Großteil der Objekte, manchmal ein Drittel oder die Hälfte, bis 1915, also während der Kolonialzeit gesammelt wurden. Es sind also alte Objekte. Die können heute viel weniger eine Aussage über den Alltag in Indien oder in Namibia treffen. Diese Krise, die auch sichtbar wurde, weil manche Museen sehr niedrige Besucherzahlen haben, hat dazu geführt, dass die Museen gemerkt haben, sie müssen sich neu positionieren. Sie müssen neu definieren, was ihre Rolle sein soll in einer Gesellschaft mit zahlreichen Menschen mit Migrationshintergrund, in einer Zeit, wo Multikulturalismus und Postkolonialismus debattiert werden, und angesichts der Dynamiken der Globalisierung. So stellen sich die ethnologischen Museen in vielen europäischen Ländern neu auf, entwickeln neue Konzeptionen, neue Dauerausstellungen und experimentieren zum Teil sehr interessant angesichts der Frage – was man mit diesen historischen Sammlungen heute tun kann.
»Die Museen müssen neu definieren, was ihre Rolle sein soll in einer Gesellschaft mit zahlreichen Menschen mit Migrationshintergrund, in einer Zeit, wo Multikulturalismus und Postkolonialismu
Lange Zeit haben viele Menschen auch gar nicht gewusst, dass es solche Sammlungen überhaupt gibt. Deutschland hat ja auch nicht ein solche Geschichte – in der Forschung schon – aber nicht im Bewusstsein der Bevölkerung wie z.B. Holland …
Aus Deutschland und Österreich kamen in der Gründungszeit ethnologischer Museen wesentliche ethnologische Schulen, die in der Theorie ihre ganze Forschung auf Objekte basiert haben. Zum Beispiel der Diffusionismus (eine sozialwissenschaftliche Theorie zur Erklärung kultureller Entwicklung und der Ähnlichkeit weit voneinander entfernter Kulturen, Anm. d. Red.), der erforschen wollte, wie sich bestimmte Objektformen und kulturelle Praktiken über die Welt verteilt haben. Um 1900 war die Blütezeit der ethnologischen Museen in Deutschland, für die sich damals auch ein großes Publikum interessierte. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Mit den Objekten kann man nicht mehr so viel über eine kosmopolitische Gegenwart erzählen.
Heißt das, dass diese Objekte heute keinen Wert haben? Dass man neue Objekte braucht?
Nein. Ich glaube, man muss andere Fragen stellen. In der Gegenwart stellt man immer neue Fragen an die Vergangenheit. Nur so macht man ältere Objekte auch in der Kunstgeschichte wieder für die Gegenwart interessant, indem man an Gemälde des 16., 17., 18. Jahrhunderts nochmal neue Fragen stellt. Und das passiert mit diesen Sammlungen. Es gibt ethnologische Museen, die heute noch sammeln, aber nur wenige. Oft wird nicht sehr gezielt gesammelt, unter anderem, weil es auch kaum nennenswerte Etats für den Erwerb neuer Objekte gibt. Kunstmuseen haben in der Regel viel mehr Möglichkeiten, Sponsoren zu gewinnen, auf dem Kunstmarkt mitzuspielen und auch mal ein Objekt auf einer Auktion zu ersteigern. Ethnologische Museen sind auch in der europäischen Museumslandschaft, sagen wir mal, etwas marginalisiert.
Und wo sich jetzt einige Museen neu aufgestellt haben und einige kommen noch hinzu, was meinen Sie, haben die unter den heutigen Bedingungen eine Chance?
Ich glaube, dass die auf jeden Fall eine Chance haben. Ich stelle derzeit fest, dass es auch insgesamt im Kultur- und Wissenschaftsbereich eine neue Begeisterung für Dinge, für Materialien, für sinnliche Oberflächen gibt. Ich glaube, da können die Museen mit ihren ziemlich interessanten Objekten mithalten. Ethnologische Museen haben ja sehr heterogene Sammlungen, aus vielen Teilen der Welt; verrückte Formen, verrückte Materialien, interessante Praktiken, Zusammenhänge und Kontexte und Deutungsweisen, die dahinter stehen. Ich glaube, dass diese Museen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit wecken können. Aber sie können es nicht mehr auf diese alte Weise, wo sie mit einem Objekt oder auch mehreren versuchten, diese oder jene Kultur zu erklären oder einen Kontinent und seine „typischen Rituale“. Was man früher einmal machte, kann man heute nicht mehr so unreflektiert fortführen.
Aber das Objekt erzählt ja eine Geschichte. Ist es nicht wichtig, diese alte Geschichte noch einmal zu erzählen?
Ich glaube, viele Objekte haben eine ziemlich interessante Geschichte, wenn man sich anschaut, wie sie erworben wurden und durch welche Hände sie gegangen sind. Und auch diejenigen, die diese Objekte abgegeben, verschenkt oder verkauft haben in außereuropäischen Ländern – warum haben die sie abgegeben? Was stand eigentlich dahinter? Was für eine Kontaktsituation hat diesen Transfer von Objekten eigentlich ausgelöst?
Ich meine das mehr im Sinne von Mythos, Fetisch. Wenn ich über ein unscheinbares Ding, dessen Bedeutung ich mir selber gar nicht erklären kann, informiert werde, und dann weiß, was es ist, wozu es benutzt wurde, dann bekommt es eine andere Bedeutung. Es wird mehrdimensional. Wird das denn auch noch gemacht: quasi die Vergangenheit mit erzählt?
Ich glaube, über die Bedeutung der Objekte ist immer viel gemacht worden, über die Frage, in welche religiösen oder ökonomischen Zusammenhänge sie gehören. Aber man hat vielleicht ein bisschen vergessen, dass sich manche Zusammenhänge auch entwickelt und verändert haben. Man muss auch sehen, was in den jeweiligen Ländern heute an neuen religiösen oder ökonomischen Praktiken vorhanden ist, und wie man das vermitteln kann, wenn man kein Objekt dazu hat. Holt man sich dann eins, sammelt man eins, oder leiht sich eins von einem anderen Museum, um zu erzählen, wie sich bestimmte religiöse Praktiken verändert haben? Das sind wichtige Fragen.
Es sind ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen in den Häusern. Wenn ich nur Köln und Frankfurt vergleiche: Müsste man die Geschichten nicht ähnlich erzählen? Die Herangehensweise in Frankfurt ist ja eine zeitgenössische. Sie reflektiert nicht, was da zu sehen ist, das Ausstellungsobjekt, sondern spiegelt sich im neuen Objekt. Das Neue wird über das Alte gestellt. Das Alte ist nur ein Spiegel.
Es ist interessant, dass Sie das so formulieren. Ich würde nicht sagen, dass das eine zeitgenössische und das andere eine historische Herangehensweise ist. Sondern in Frankfurt sind es ganz einfach Künstler, die ohne Vorwissen in die Sammlung gehen, und Objekte, die sie interessant finden, heraussuchen und darüber quasi eine künstlerische Phantasie entwickeln. Das ist natürlich etwas ganz anderes als in Köln. Da hat ein wissenschaftliches Team über fünf oder zehn Jahre Themen entwickelt, die in vielen Gesellschaften eine Rolle spielen: Der Umgang mit dem Tod, Begrüßungsformen, Religion. Und sie haben versucht, Objekte aus verschiedenen Kontexten vorzustellen, um die Vielfalt und die kulturelle Diversität auf der Welt zu zeigen. Von der Herangehensweise, vom Zugriff her ist das ganz anders als in Frankfurt. Und es macht natürlich auch etwas Anderes mit den Objekten. Ich würde allerdings grundsätzlich folgendes sagen: Wir haben ja in Deutschland durch den Föderalismus eine wahnsinnig vielfältige Museumslandschaft. Andere Länder – die Niederlande, Frankreich – haben ein großes ethnologisches Museum in der Hauptstadt, das das Thema dann auf nationaler Ebene repräsentiert. In Deutschland dagegen haben wir viele kleinere und größere ethnografische Sammlungen, und was ich im Augenblick interessant finde, ist, dass sie fast alle unterschiedliche Wege gehen. Das halte ich für ganz, ganz spannend. Da gibt es Versuche, die finde ich besser, da gibt es Versuche, die finde ich schlechter. Und es ist auch noch keiner dabei, der mich total überzeugt hat. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr viel in Bewegung. Diese unterschiedlichen Zugangsweisen machen uns erst richtig bewusst, dass Objekte nicht von sich selbst aus sprechen, sondern dass es unsere Interpretationen und Sichtweisen sind, die wir an die Objekte herantragen und die ihnen Bedeutung verleihen. Insofern finde ich auch die Unterschiede zwischen Frankfurt, Köln, Basel sehr, sehr interessant, denn in der Summe beobachten wir hier ein sehr vielstimmiges Nachdenken darüber, was so ein Museum mit seinen Sammlungen eigentlich kann.
Letzte Änderung: 17.08.2021


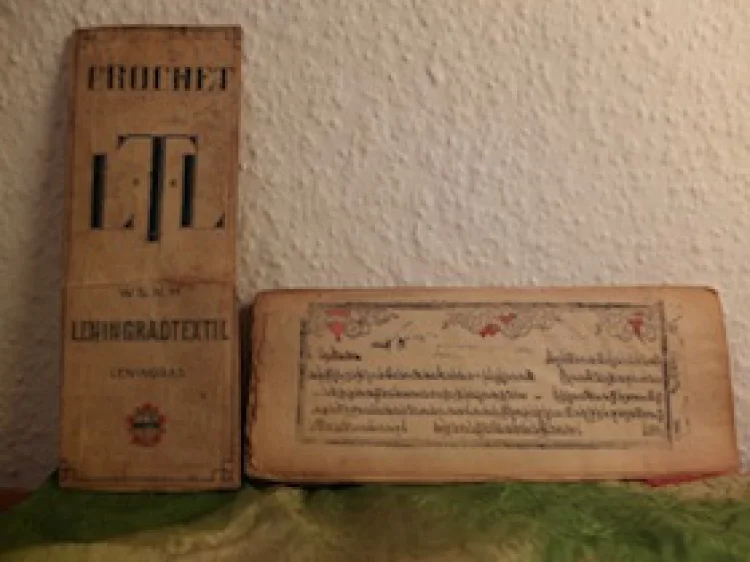


Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.