Eine moralische Verantwortung
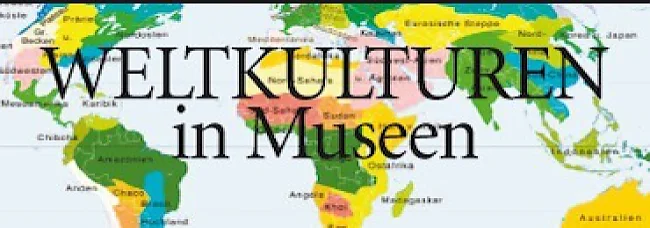
Es geht nicht mehr darum, Exotisches zur Schau zu stellen. Es geht um die Auseinandersetzung unserer Gesellschaft mit anderen Kulturen. Wie man Sammlungen zeigen kann und im ständigen Dialog einen Wissenstransfer erreicht, daran arbeitet das Linden-Museum in Stuttgart. Clair Lüdenbach hat mit der Direktorin Inès de Castro gesprochen.
Interview mit Inès de Castro, Direktorin des Linden-Museums Stuttgart
Clair Lüdenbach: Wie stellt man heute Weltkulturen im Museum dar?
Inès de Castro: Wir suchen nach neuen Wegen. Eine neue Generation von Direktoren und Kuratoren an den Museen diskutiert seit Jahren über eine neue Ausrichtung, über eine neue gesellschaftliche Rolle und Relevanz ethnologischer Häuser. Der Diskurs über Kolonialismus und das Humboldt Forum hat die Diskussion eher in die Gesellschaft gebracht, sie war aber in den Museen schon lange da. Ausschlaggebend waren insbesondere die Kuratoren, die partizipativ gearbeitet haben und Mehrstimmigkeit in die Ausstellungen gebracht haben. Wir probieren hier im Linden-Museum seit vielen Jahren unterschiedliche Teilhabe-Formate aus mit Vertretern aus der diversen Stadtgesellschaft oder aus den Herkunftsgesellschaften. Es geht darum, den anderen eine Stimme zu geben und mehrere Geschichten zu erzählen, die Objektivität in der Wissensvermittlung zu hinterfragen und selbstkritisch mit der eigenen Rolle und der eigenen Geschichte umzugehen. Die Forderung vieler postkolonialer Gruppierungen, ethnologische Museen zu dekolonisieren, sie zu demokratisieren, hat uns auch geholfen, in der Politik die Rahmenbedingungen für unsere Veränderungen zu schaffen. Es gibt dabei strukturelle Schwierigkeiten, die man sehr schlecht überwinden kann, wenn man sich neu ausrichtet, und an denen wir mit der Politik arbeiten müssen.
Hat die Politik da Druck ausgeübt?
Nein, der Wille zur Veränderung kommt von den Museen. Der Diskurs und die starke Pressepräsenz des Themas haben uns sicher dabei geholfen. Hier in Baden-Württemberg erfahren wir zudem viel Unterstützung durch die Politik.
Mir ist aufgefallen, dass die Rede, in der der französische Präsident Emmanuel Macron an der Universität von Ouagadougou in Burkina Faso Ende November 2017 für die Rückkehr afrikanischen Kulturerbes plädierte, hier noch einiges beflügelt hat.
Ja, ja, das stimmt. Wichtig war auch der Bericht der französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und des senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr. Wir haben den Bericht sehr begrüßt, weil er dazu beigetragen hat, das Thema Kolonialismus noch mehr in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir stehen noch am Anfang unserer Auseinandersetzung mit unserer kolonialen Vergangenheit. Ethnologische Häuser sind meist, wie das Fach selbst, in der Zeit des Kolonialismus entstanden. Unsere Sammlungen untermauern die Unterscheidung zwischen Europa und dem Rest der Welt. Bei frühen Sammlungen haben wir von kolonialen Strukturen profitiert. Wir können nicht unsere Wurzeln abstreifen, aber wir sollten uns kritisch damit auseinandersetzen. Ein Versuch zeigt sich in unserer neuen Afrika-Ausstellung „Wo ist Afrika?“, die ab dem 16. März zu sehen sein wird. Wir haben hier versucht, die Rolle des Hauses und seiner Wissenschaftler sichtbar zu machen.

Ich habe ja diese Reihe „Weltkulturen in Museen“ schon vor der großen Diskussion begonnen. Und immer wieder wurde gesagt, einiges ist aus der Kolonialzeit unrechtmäßig erworben, aber vieles kam nur mittelbar über Reisende, zum Beispiel Händler, in die Sammlung.
Wir haben sehr unterschiedliche Sammlungen, die auf sehr unterschiedlichen Wegen zu uns gekommen sind. Einige haben eine enge Verbindung zur Kolonialzeit, insbesondere wenn sie aus den ehemaligen Kolonialgebieten stammen, andere nicht. Wichtig scheint mir, dass das Bewusstsein für die Erwerbungskontexte geschärft wird und dass wir nach unrechtmäßigen Kontexten nicht nur innerhalb der formalen Kolonialzeit schauen, sondern diese in einem breiteren Rahmen fassen, auch im Sinne dieses Leitfadens des deutschen Museumsbundes, zwischen dem 15. Jahrhundert und heute. Es geht also nicht allein um Afrika und die Südsee, die bei der Diskussion oft vergessen wird. Wir haben eine moralische Verantwortung für den Umgang mit unserem schwierigen Erbe allgemein, auch aus anderen Regionen der Welt. Wir sollten aktiv Provenienzforschung betreiben, enge Netzwerke mit Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften etablieren und gemeinsam überlegen, was zu tun ist.
Sie haben eine wunderbare Sammlung orientalischer Kunst. Wie reagiert da die Bevölkerung? Wir haben ja gerade eine sehr starke Gegenbewegung zum Islam. Es wird alles sehr pauschal gesehen. Wie kann man trotzdem Besucher gewinnen, mit diesem sehr umstrittenen Thema?
Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich sehe unsere Aufgabe darin, nicht mehr allein die westliche und häufig homogenisierende Perspektive zu zeigen, sondern mit partizipativen Formaten auf die vielen Geschichten und Sichtweisen aufmerksam zu machen.
Und wie wird das hier im Museum gemacht?
Partizipation ist der Kern aller Projekte. Wir laden zum Beispiel zahlreiche Vertreter aus den Herkunftsgesellschaften ein, um mit uns an der Sammlung zu arbeiten, gemeinsam nach Interpretations- und Präsentationsformen zu suchen. Oder wir erarbeiten Ausstellungen mit Co-Kuratoren oder in Zusammenarbeit mit Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften und der Stadtgesellschaft. Wo wir sicher noch Nachholbedarf haben, ist bei der Zugänglichkeit zu den Sammlungen. Die Sammlungen sollten bald online gestellt werden, damit sie weltweit gesichtet werden können. Wir arbeiten schon einige Jahre daran und werden mit Hilfe des Landes 2020 mit einem Teil der Objekte in einer interaktiven Datenbank online gehen, die auch Provenienzforschung beinhaltet. Bei diesem Thema bräuchten die Museen mehr Unterstützung von der Politik. Dies ist nur mit zusätzlichen Mitteln und mit zusätzlichem Personal zu schaffen.

Merken Sie das schon an höheren Besucherzahlen?
Nein, das merken wir nicht. Wir haben in den letzten Jahren an den Ausstellungen sehr viel geändert: partizipative Formate und zeitgenössische Bezüge ausprobiert. Das wird sehr gut angenommen. Aber wir merken noch keine Erhöhung der Besucherzahlen. Wir sind in einem Veränderungsprozess begriffen und müssen lernen, diesen besser zu kommunizieren. Wir haben von der Bundeskulturstiftung für die nächsten drei Jahre Finanzen bekommen, um mit neuen Formaten zu experimentieren. Mittelfristig denken wir an eine neue Konzeption des Hauses in einem Neubau. Wir nehmen uns die Zeit dazu, gemeinsam mit Herkunftsgesellschaften und Stadtgesellschaft nach neuen Wegen zu suchen. Wie kann ein ethnologisches Museum der Zukunft aussehen? Welche Themen sind relevant? Welche Geschichten möchten wir erzählen?
Ich habe schon sehr viele neue Ansätze in den verschiedenen Museen gesehen. Es gibt immer wieder Ansätze, die verschiedenen Ausstellungsstücke – manche sind ja Alltagsgegenstände und manche sind künstlerische Arbeiten – wie ein zeitgenössisches Kunstwerk zu präsentieren. Geht das bei Ihnen auch in diese Richtung?
Nein, wir gehen einen anderen Weg. Wir suchen vor allem nach der Relevanz der Sammlung für die Gesellschaften von heute. Welche Bedeutung hat diese hervorragende Sammlung, die aus dem 19. und dem 20. Jahrhundert stammt, für die Stuttgarter Stadtgesellschaft? Stuttgart ist eine der Städte, die am meisten von Diversität geprägt ist. Welche Rolle können wir da als ethnologisches Museum spielen? Natürlich sollte der künstlerische Wert der Objekte und ihre Ästhetik nicht ganz vernachlässigt werden. Unsere Besucher suchen bei uns jedoch vor allem nach dem kulturellen Kontext der Objekte, nach den Geschichten, die damit verbunden sind.
Es gibt in der Orientabteilung ja eine Basarstraße, die ich sehr beeindruckend fand. Das ist etwas „Tausendundeine Nacht“ und gleichzeitig etwas Untergegangenes.
Ja, das sind die sogenannten Erlebnisbereiche, die es im ganzen Haus für die verschiedenen regionalen Abteilungen des Hauses gibt. Sie stammen aus den 80er Jahren und sind, meiner Meinung nach, etwas problematisch: Auf der einen Seite werden die „naturalistischen“ Lebenswelten von den Schulklassen geliebt, auch von vielen Besuchern geschätzt. Auf der anderen Seite tendieren sie dazu, Gesellschaften einzufrieren und Stereotypen zu verstärken. Der Basar wurde in den 70er Jahren angekauft und existiert heute nicht mehr. Die für diesen Bereich zuständige Kuratorin wird in naher Zukunft den Basar partizipativ im Rahmen des Projektes der Bundeskulturstiftung bearbeiten und gemeinsam mit Vertretern aus der Herkunftsgesellschaften und der Stadtgesellschaft nach seiner Bedeutung fragen.

Heute gibt es eine zeitgenössische Kunst, die es früher nicht gab. Es ist bei den Künstlern ein Bewusstsein für die eigene Kultur entstanden. Dafür hat sich parallel ein neuer Kunstmarkt etabliert. Bleibt da für dieses Museum auch noch etwas übrig?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Wir kaufen für unser Haus sowohl Objekte aus dem heutigen Alltagsleben als auch zeitgenössische Kunst. Dabei kann es sich um bildende Kunst handeln, wie zum Beispiel zwei Gemälde nordamerikanischer indigener Künstler, oder auch um Tanz- oder Musikperformances, wie die von zwei kameruner Künstler zum Thema Kolonialismus, die in der neuen Ausstellung zu sehen sein wird. Häufig geschieht der Ankauf auch zusammen mit unseren Partnern aus den Herkunftsgesellschaften, was wir als Co-Collecting bezeichnen.
Wie sehen Sie die Zukunft der ethnologischen Museen, der Weltkulturen Museen? Dieses Museum hat ja noch seinen alten Namen „Linden Museum“ als Alleinstellungsmerkmal.
Im Moment ist das noch so. Aber im Neubau möchten wir auch einen neuen Namen, der der neuen Ausrichtung gerecht wird. Der Name unseres Gründers von Linden ist eng mit dem Kolonialismus verbunden. Seine Praktiken waren dieser Zeit entsprechend. Aber zunächst möchten wir gemeinsam an einer Neukonzeption und einer neuen Ausrichtung des Hauses arbeiten. Erst danach sollten wir nach dem passenden Namen suchen. Wir haben nun die große Chance, uns gemeinsam neu zu erfinden.
Letzte Änderung: 17.08.2021

Auch im Linden-Museum Stuttgart wird über die Rückgabe einstmals geraubter Kulturgüter diskutiert. So besitzt es, wie viele große Häuser, einige der berühmten Benin-Masken. Kürzlich wurde schon Witbooi-Bibel und eine Peitsche an den Präsidenten Namibias zurückgegeben. Aber im wesentlichen möchte das Haus seine eindrucksvolle Sammlung mit neuen Präsentationsformen den Stuttgartern näher bringen. Wo ist Afrika? ist der richtungsweisende Titel der neuen Ausstellung.
Weitere Informationen
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.