
Karlheinz Braun hat vor drei Jahren das Erinnerungsbuch „Herzstücke. Leben mit Autoren“ geschrieben. Darin verzeichnet der Chronist unendlich viel Theatergeschichte, Biographisches und Anekdotisches über Intendanten, Schauspieler und vor allem über Autorinnen und Autoren. Und man erfährt, wie Frankfurt am Main einst zur Stadt des deutschen Avantgardetheaters wurde. Damals haben Walter H. Krämer und Bernd Leukert mit dem Autor, der nun 90 Jahre alt geworden ist, gesprochen.
Karlheinz Braun im Gespräch mit Walter H. Krämer und Bernd Leukert
Bernd Leukert: Dieses Buch, „Herzstücke. Leben mit Autoren“, ist eigentlich eine Theatergeschichte von Karlheinz Braun.
Karlheinz Braun: Könnte man sagen. Ja.
L: Karlheinz Braun erscheint darin – wenn man die biographischen Anteile beiseite lässt – als ein Mensch, der über das Studententheater „neue bühne“, über die „Experimenta“ und alles, was sich daraus ergibt, nämlich dem Beziehungsnetz, das er sehr früh vorgefunden oder mit erhalten hat, wie auf einer Drehbühne von Szene zu Szene gehen konnte und sich immer in einer glücklichen Situation befand. Gibt es darin irgendwelche ausgelassenen Stellen?
Natürlich gibt es ausgelassene Stellen. Das heißt, ich wollte auf keinen Fall eine Autobiographie schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben über Autoren (vor allem über Dramatiker) und über die Arbeit mit den Autoren, wie sie zu Autoren wurden, wie ihre Theaterstücke entstanden, wie sie an die Theater gekommen sind, wie sie zu Erfolgen wurden oder zu Misserfolgen. Das war die Absicht. Da es sich vor allem um deutschsprachige Autoren handelte, wurde sehr schnell sichtbar, dass es sich bei den Stücken selbst um deutsche Geschichte handelte – durch die Stoffe, die die Autoren behandelten. Die Autoren haben eben über ihre Zeit geschrieben, über die Nazi-Zeit, über die Bewältigung der Vergangenheit und den Auschwitz-Prozess, über den Wiederaufbau und die Wohlstandsgesellschaft und die Studentenrevolte, also über die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts. Damit hat sich die Geschichte über das Werk der Autoren in das Buch geschoben, und so wurde es unter einem bestimmten Aspekt auch eine rudimentäre Geschichte der Bundesrepublik. Aber es hat sich nicht nur eine Geschichte der Bundesrepublik ergeben, sondern auf einer weiteren Ebene auch eine Geschichte der Ästhetik. Denn da es vor allem um Theaterstücke, Filme, Hörspiele usw. ging, also um Werke der darstellenden Künste, ging es immer auch darum, wie die Autoren schreiben, wie sie diese ihre Stoffe transportiert haben in – jeweils – ein Theaterstück, ein Hörspiel oder einen Film. Also ergab sich auch eine Darstellung der Dramaturgie, der ästhetischen Entwicklung seit den 50er Jahren bis heute. Und weil es vor allem um Theaterstücke ging, die ohne die Theater nicht leben können, entstand auf einer weiteren Ebene auch eine kleine Theatergeschichte der Bundesrepublik, mit einem Schwerpunkt auf die Frankfurter Theatergeschichte, da Vieles hier stattgefunden hat. Und nicht zuletzt, da sich alles in zwei Verlagen abgespielt hat, bei Suhrkamp und im Verlag der Autoren, ist es auch eine Geschichte dieser beiden Verlage, wenn auch keine vollständige. Auf der letzten Ebene komme ich dann vor, bin ich derjenige, der das alles erlebt und erinnert hat. Das war eine Entwicklung, wie ich sie zu Beginn des Buchs nicht vorausgesehen hatte. Was sich erst im Verlauf der Arbeit selbst herausgestellt hat. Und deshalb ist es auch ungeplant so umfangreich geworden.
L: Man erlebt den Berichterstatter Karlheinz Braun in diesem Buch immer an vorderster Front der Entwicklung. Wenn man dieses Buch gelesen hat, stellt sich die Frage, gibt es einen Begriff von Theater, ein Theater, das Sie sich wünschen?
Es gibt keinen Begriff von Theater, den ich mir gewünscht habe. Ich war immer neugierig auf das, was wird, was also zukünftig geschehen wird, und das natürlich zum großen Teil auch aus dem Verdruss und dem Überdruss an dem Bestehenden. Die „Experimenta“ zum Beispiel ist entstanden nicht zuletzt aus dem Bedürfnis nach Änderung der überholten und verkrusteten Verhältnisse an den deutschen Theatern. Und die erste „Experimenta“, die Peter Iden und ich 1966 kuratierten (so würde man heute sagen), kam genau zum richtigen Zeitpunkt – und hat deshalb auch so viel bewirken können im deutschen Theater, was nicht nur in inhaltlich-ästhetischer Hinsicht gilt, sondern auch in struktureller. Denn das waren die Jahre, in denen allmählich die Forderungen nach Mitbestimmung hochkamen, wo das alte Generalintendantentheater in Frage gestellt wurde.
L: Da wollte ich gerade anknüpfen. Denn es gibt ja auch Auflösungserscheinungen, so dass man in letzter Konsequenz dem Publikum das Theater überlässt. Oder man wendet sich vom Theater ab mit der Parole, wir brauchen kein Theater, wir brauchen die politische Aktion, – also die dezidierte Abwendung von der Kunst. Deshalb frage ich: Was ist eigentlich Theater?
Das hängt jeweils von der gesellschaftlichen und politischen Situation ab. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hat das eigentlich reale Theater, wie wir feststellten, mit den großen Demonstrationen auf der Straße stattgefunden. Und beide, das „normale“ Theater und das der Straße, sind sich immer wieder begegnet. Zum Beispiel wie sich in der Zeit des Vietnamkrieges die großen Demonstrationen von der Goethe-Universität über die Bockenheimer Landstraße und den Anlagenring ganz zielbewusst direkt zum Schauspielhaus bewegt hatten, wo gerade der „Vietnam Diskurs“ von Peter Weiss gespielt wurde. Die Demonstranten enterten das Schauspielhaus, gingen durch den Zuschauerraum auf die Bühne, schwenkten ihre Fahnen, verlasen ihre Resolutionen gegen den Krieg der USA und solidarisierten sich mit dem Vietkong. Das bürgerliche Abonnementpublikum war irritiert. Aber nach zehn Minuten verließen die Demonstranten wieder friedlich das Theater, und das Stück ging weiter, angereichert durch eine gewisse Realität. Da hat sich in einer bestimmten Periode das Theater von Außen mit dem von Innen getroffen…
L: Das ist eine seltsame Umkehrung des einzigen Momentes in der Geschichte, wo ein Theater – in dem Fall: Oper – etwas politisch ausgelöst hat, nämlich Aubers „Die Stumme von Portici“: 1830 in Brüssel, „La Monnaie“. Und in dem Moment, nachdem das „Heilige Vaterland“ beschworen wird und die Oper zu Ende geht, stürmt das Publikum auf die Straße und zettelt den Aufstand an. Die Folge ist die Trennung von Niederlande und Belgien.
Das waren große Momente der Theatergeschichte.
L: Gibt es einen anderen Fall, wo Theater tatsächlich und überprüfbar etwas bewirkt hat?
Es gibt sicherlich viele, ich muss spontan an drei Fälle aus meiner Zeit denken. Der eine war sicherlich Hochhuths „Stellvertreter“, der nicht nur die katholische Kirche erschütterte und damit auch die Adenauer-Republik, sondern in letzter Folge mit einem weiteren Stück Hochhuths zum Sturz des Ministerpräsidenten Filbinger führte. Und ich würde behaupten, dass „Die Ermittlung“ von Peter Weiss mehr im Bewusstsein der deutschen Bevölkerung bewirkt hat als die politischen Bemühungen der Bundesregierung oder der Auschwitz-Prozess selbst. Allein die Tatsache, dass das Stück von 16 Theatern in der Bundesrepublik und der DDR gleichzeitig an einem Tag uraufgeführt wurde, und dass das Stück dann als Hör- und Fernsehspiel über alle Sender ging, zur Hauptsendezeit, – das hat eine gesellschaftspolitische Wirkung gehabt wie nur selten ein Theaterstück. Und zuletzt, als drittes Beispiel, die Jahrzehnte lang schwelende Erregung um Fassbinders „Der Müll, die Stadt und der Tod“, von interessierter Seite inszeniert und kulminierend in der Besetzung der Bühne des Frankfurter Kammerspiels durch die jüdische Gemeinde. Wenn man heute nachliest, was sich in den Jahren vor und nach der verhinderten Aufführung lokal und deutschlandweit abspielte, das war eine theatergeschichtliche Erzählung, deren Wirkung die des Theaters weit überstieg. Und das mit einem Stück, das nicht aufgeführt wurde, und dessen Wirkung auf das gesellschaftliche Leben bis dahin nicht denkbar war.
Walter H. Krämer: Sie schrieben, dass Günther Rühle, der das ja zu verantworten hatte, etwas blauäugig in diese Situation gestolpert ist. Wie sehen Sie denn das heute?
„Blauäugig“ ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Rühle hatte das Stück und seine Geschichte erst einmal als Journalist während der zehn Jahre, in denen es nicht gespielt werden konnte, von außen gesehen, und er dachte wohl, wenn ich da jetzt als Intendant ins Theater komme und das Projekt gut vorbereite, es mit rationalen Argumenten zur Diskussion stelle, dann wird jeder verstehen und einsehen, dass das kein antisemitisches Stück ist. Das Theater hat dann auch Wochen und Monate vor der geplanten Uraufführung diese Vorbereitung vorbildlich geleistet, mit Vorträgen und Diskussionen. Das meinte ich mit „blauäugig“. Als wäre den Vorwürfen des Antisemitismus mit rationalen Argumenten zu begegnen. Dass sich das dann völlig anders entwickelt hat, dass die anfänglich etwa hundert Interessierten in den weiteren Veranstaltungen zu Tausenden anschwollen und die immer emotionaler werdenden Diskussionen rational kaum mehr zu steuern waren, das war nicht absehbar…
K: Aber finden Sie es denn richtig, dass er versucht hat, das Stück auf die Bühne zu bringen?
Natürlich war das richtig! Es wäre auch heute notwendig, das Stück zu spielen, gerade, um die Mechanismen mit den Klischees des Antisemitismus und ihre Ursachen aufzuzeigen. Das Stück wurde in vielen Ländern der Welt gespielt, ohne dass es zu antisemitischen Vorwürfen kam, ganz im Gegenteil. Und im selben Jahr, in dem Fassbinder seine Inszenierung am TAT abgebrochen hat, nicht zu Ende geführt hat, also 1976, hat der Schweizer Filmemacher Daniel Schmid das Stück mit dem unveränderten Text verfilmt. Dieser Film mit dem Titel „Schatten der Engel“ wurde dann als offizieller Beitrag der Bundesrepublik Deutschland bei den Filmfestspielen im Januar 1976 in Cannes uraufgeführt – ohne irgendwelche Proteste. Und erst nach der Uraufführung hat die israelische Delegation – ohne den Film gesehen zu haben – in Cannes von der Festspielleitung verlangt, sie müsse sich von dem Film distanzieren und ihn nachträglich wieder ausladen. Der Film wurde dann auch im Hessischen Fernsehen gezeigt und kam ein halbes Jahr später in die deutschen Kinos. Und es gab überhaupt keine Proteste. Niemand nahm daran Anstoß. Erst als 1985 Günther Rühle das Stück – wie von Fassbinder verfügt – in Frankfurt uraufführen wollte, kam es zu den bekannten Protesten. Nur das Theater hat solche Wirkungen ausgelöst. Oder wurde dafür benutzt.
L: Vielleicht, weil das Theater immer noch eine moralische Anstalt ist.
Wahrscheinlich. In den Kinos werden ja auch unbeanstandet Pornofilme gezeigt. Es ist für mich ganz unzweifelhaft, dass das Stück ins Theater gehört. Mit den ihm immanenten Möglichkeiten. Und es wurde dann ja auch in New York, in Los Angeles und ganz Skandinavien, selbst in Israel gespielt. Nur in Deutschland nicht, außer in einer „kommentierten“ Aufführung in Mülheim. Aber diese Aufführungsgeschichte ist ein Kapitel für sich. Über das Stück und seine Geschichte gibt es inzwischen einen ganzen Bücherschrank voller Literatur. Der Clou der Geschichte ist jedoch, dass in diesem Jahr, am 20. Mai, in Frankfurt, in der Eschersheimer Landstraße unweit des alten längst abgerissenen TAT, das allumfassende Fassbinder-Center eröffnet wird, – mit Reden der Staatsministerin für Kultur aus Berlin und dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, – eine gedenkwürdige und zugleich forschende Institution mit dem gesamten künstlerischen Nachlass des großen Theater-und Filmemacher, um die ganz Deutschland, vor allem die Filmstadt München, Frankfurt beneidet. Ein Paradox sondergleichen. Denn das Stück wird weiterhin nicht in Frankfurt gespielt, genauer: Es wird nicht gespielt werden können.
K: Was ich daran interessant finde – ich vermisse das zumindest – dass heute das Theater oft nicht mehr so wirklich aufregt. Wenn man sich die Bühnen anguckt, das, was Sie auch in Ihrem Buch häufig beschreiben: kleine oder größere Skandale, wo Theater auch wirklich Barrieren eingerissen hat, das gibt es ja heute so gut wie nicht mehr.
Das betrifft ja nicht nur das Theater. Alle Künste provozieren nicht mehr. Heute gilt: Anything goes. Es wird alles beklatscht – mehr oder weniger. Und natürlich liegt das daran, dass das Theater inzwischen meiner Ansicht nach in seiner Bedeutung sehr marginalisiert ist. Das heißt, es ist eine Unterhaltungs- oder Informations- oder Bildungsplattform unter vielen anderen. Und wenn früher, noch bis zum Ende des letzten Jahrhunderts, das Theater doch eine moralische und gesellschaftspolitische Anstalt war, wird es heute als solche überhaupt kaum mehr wahr- und angenommen. Die meisten Theatermacher verstehen sich zwar noch in ihrer alten Rolle als „Gewissen der Nation“, aber das reagiert kaum mehr darauf. Waren es früher noch die stolzen Gebäude von Rathaus, Kirche und Theater, die das Gemeinwesen mit dem „Wahren, Schönen und Guten“ repräsentierten, so sind es heute längst andere Mächte. Ein weites Feld, auf dem sich das Theater wahrscheinlich neu erfinden muss.
L: Kann das auch damit zusammenhängen, dass das Theater – nicht pauschal, aber schon spürbar – inzwischen mit der Wurst nach dem Speck wirft und mit Bearbeitungen von Romanen, Filmen usw. arbeitet? Dass die Originale fehlen?
Die Originale fehlen ja nicht. Die sind ja da. Das ist ein Thema, das ich am Ende des Buches angeschnitten habe. Aber da gibt es einmal eine Entwicklung des Dramas seit über hundert Jahren, die mit dem Beispiel des wortlosen Stückes „Atem“ von Samuel Beckett zu einem Stillstand, wenn nicht gar zu einem Ende gekommen ist. Im Gegenzug gibt es theatralische Aktionen, die ohne literarisches Vokabular auskommen, das sogenannte „postdramatische Theater“, das die bisherige Dominanz des von einem Autor entworfenen und geformten Textes als Grundlage einer Aufführung verweigert und mit neuen szenischen Formen für ein Theater nach dem Drama arbeitet. Das heißt, die Theatermacher haben sich emanzipiert von den literarischen Vorgaben und betrachten sich als die eigentlichen Urheber des theatralischen Produkts. Ich verallgemeinere jetzt ganz ungebührlich, und das kann man bewerten, wie immer man will: Da gibt es innovative Beispiele, die dafür sprechen, die interessant sind und die Sache auch weiterbringen. Aber natürlich gibt es auch die Epigonen, die das nur nachmachen, ohne etwas Eigenes hinzuzufügen. Dass eine solche Praxis für originäre Stückeschreiber nicht gerade stimulierend ist, ist verständlich. Zumal wenn Theatermacher mangels eigener Stoffe und Ideen auf andere literarische und bildnerische Werke zurückgreifen, auf Romane und Filme, die sie als Material für eigene theatralische Arbeiten umformen und nutzen. Wenn also Autoren nicht besser gleich ins Theater gehen und ihre Texte selbst szenisch realisieren, dann ziehen sie sich eher auf ein anderes literarisches Terrain zurück, auf Romane und andere Prosa. Die dann vielleicht von einem Regisseur entdeckt und von den Theatermachern „dramatisiert“ wird – und so auf die Bühne kommt. Eine verkehrte Welt.
K: Also, Sie würden der These widersprechen, die ja von vielen Regisseur*innen auch geäußert wird, dass es heute kein Stück gibt, das adäquat auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert?
Natürlich! Es gibt immer noch viele neue Stücke. Aber die Stücke werden, im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, meist nur einmal gespielt oder, wenn der Autor Glück hat, von zwei oder drei Theatern „nachgespielt“ – während zum Beispiel ein Stück wie „Andorra“ von Max Frisch nach der Zürcher Uraufführung in derselben Spielzeit von 20 bis 30 Theatern nachgespielt wurde, in zwei Spielzeiten von 60 bis 70 Theatern! Da konnten Stücke noch Wirkung entfalten und nebenbei auch ihren Autor ernähren. Doch wenn Stücke, die auch heute große gesellschaftliche Relevanz haben – , ich erspare mir hier eine Aufzählung – wenn sie Glück haben, von drei, vier, fünf deutschsprachigen Theatern gespielt werden, können sie kaum die gewünschte Wirkung entfalten, und werden leicht ersetzt durch namensträchtige Bestseller und Projekte, in denen ein aktuelles Thema vermeintlich das Publikum anzieht. Dann muss man sich nicht wundern, wenn die originären Autoren sagen, warum soll ich eigentlich noch für ein solches ex-und hopp-Theater schreiben? Was die Relevanz der Stücke angeht, da müsste man jetzt ins Detail gehen. Sehr pauschal betrachtet kommt es mir vor, dass es mehr und mehr die effektvolle Verpackung ist, die ein Publikum befriedigen soll, all die reichen Mittel einer technischen, von ständiger musikalischer und filmischer Begleitung unterstützter Vermittlung, die weniger zum Denken als zur emotionaler Überwältigung taugen. Und natürlich ist das Publikum so, wie man es sich schafft, und es klatscht und scheint begeistert. Aber viele gehen auch nach Hause und verspüren eine gewisse Leere. Ein schöner Abend, der schnell vergessen ist. Vielleicht bedürfte einer anderen Theaterarbeit insgesamt, um das Theater wieder relevant zu machen.
K: Und wie könnte die aussehen? Was müsste sich ändern?
Vielleicht müssten die Theatermacher selbst, und vor allem die Schauspieler, wieder mehr darüber nachdenken, warum sie Theater machen, müssten sich weniger als Objekte sehen, die heute den Regievorstellungen zu folgen haben und morgen der nächsten: Muss denn jeder das realisieren, was möglich ist, und nicht nur das, was notwendig ist? Ich denke ganz altmodisch an die mitbestimmte Arbeit des Ensembles in der Zeit von Palitzsch und Neuenfels in Frankfurt zurück, die beide über zehn Jahre lang feste Hausregisseure in einem Theater waren, wo das Ensemble, wo die Schauspieler wussten, wie sie in einem gemeinsam sich entwickelndem Prozess spielen sollten, – sowohl bei Palitzsch wie auch, sehr entgegengesetzt, bei Neuenfels: Heute gibt es kaum noch feste Hausregisseure. Heute müssen sich die Schauspieler unter einem erhöhten Produktionsdruck von heute auf morgen auf einen neuen Regisseur und dessen Stil und eine bestimmte Arbeitsweise einstellen. Samstag ist Premiere, am Montag geht es mit einem anderen Regisseur völlig anders weiter. Schauspieler sind verwandlungs- und anpassungsfähig, das erfordert ihr Beruf – aber sie sollten nicht nur funktionieren, sie müssen auch wissen, warum und wofür sie funktionieren. Nicht unbedingt, um möglichst effektvoll ihr eigenes Ego herauszubrüllen. Ich denke gern mit denen auf der Bühne, mit den Schauspielern. Aber dazu brauche ich auch Autoren, die im Spiel zu denken geben. Und wollten wir nicht über die sprechen, über die ich in „Herzstücke“ geschrieben habe, und deren Stücke mehr und mehr von den Bühnen verschwinden?
Siehe auch:
Faust-Autorenseite Karlheinz Braun
Letzte Änderung: 04.07.2022 | Erstellt am: 04.07.2022

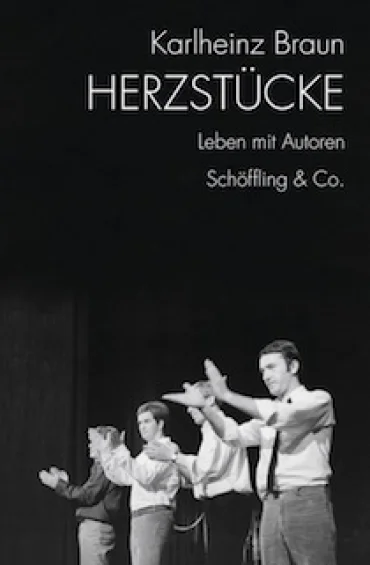
Karlheinz Braun Herzstücke
Leben mit Autoren
Gebunden, 680 Seiten
ISBN: 978-3-89561-254-1
Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2019


