Kann ein Historiker ein Chronist der Gegenwart sein?

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2025 wurde an den deutschen Historiker Karl Schlögel vergeben ‒ völlig zurecht angesichts der Naivität, mit der so manche Westeuropäer (leider auch gelegentlich Politiker und Intellektuelle aus Mittelosteuropa) dem putinschen und postsowjetischen Imperialismus begegnen. Schlögels Dankesrede in der Paulskirche, gehalten bei der traditionellen Preisverleihung am letzten Tag der Buchmesse, machte noch einmal deutlich: »Russki mir« ‒ das ist räumlich und zeitlich für den Westen eine fremde Dimension. Auch Schlögels neuestes Buch »Auf der Sandbank der Zeit. Der Historiker als Chronist der Gegenwart«, eine Art Best of …, nämlich vom Autor selbst ausgewählt und komponiert, geht in diese Richtung: Wolle man Russland verstehen, müsse man Raum und Zeit anders denken ‒ stets im Kontext derjenigen, die sich wehren, weil sie nicht unter dem postsowjetischen Stiefel Putins und seines Isolationismus leben wollen.
Die Schriftstellerin Katja Petrowskaja beginnt ihre Laudatio auf den neuen Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Karl Schlögel mit einer herzzerreißenden Geschichte, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht, sodass einigen Gästen in der Paulskirche die Augen feucht werden. Petrowskaja, die in Kiew geboren wurde, in Berlin lebt und in ihrem Deutsch den sympathischen Akzent und Singsang der ukrainischen und russischen Sprache beibehalten hat, beschreibt eine Demonstration in Berlin, gleich zu Anfang des russischen Angriffs auf die Ukraine. Auf dem Bebelplatz umarmen sich Demonstranten und schweigen, dann werden Reden gehalten, und ein Mann hat sich in die ukrainische Flagge eingehüllt, und da ist noch ein anderer Mann, ein trauriger Zaungast: Karl Schlögel, der den Reden aufmerksam zuhört und der weint …
Ein starker Auftakt der Laudatio, die einen deutschen Historiker würdigt, der, wie Tony Judt, Timothy Snyder, Norman Davies oder Timothy Garton Ash, von Russland viel mehr versteht, als die sogenannten Russlandversteher, um mal einen einschlägigen Satz aus der Dankesrede von Schlögel zu paraphrasieren (sie ist auch online zugänglich ‒ auf der Seite des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels): »Es gab viele Russlandversteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden.« Schlögels Kritiker, vor allem im Kontext der Vergabe dieses so bedeutenden und tief in der Geschichte der Bundesrepublik verankerten Preises, rekrutieren sich aus verschiedenen Kreisen und Medien, nicht nur solchen Printmedien wie Neues Deutschland oder Junge Welt, es gibt sie auch dort, wo man sie gar nicht vermuten würde: in den Wissenschaften.
Es stört mich kaum, wenn ein Journalist solcher Provenienz über die Stränge schlägt und mir auf der Frankfurter Buchmesse ins Ohr raunt, er finde die Sowjetunion »cute« und würde sich freuen, wenn sie zurückkäme. Über die Mythologisierung des sowjetischen Imperiums wurden natürlich schon unzählige Texte verfasst. Doch nur wenige sind so analytisch, so sachlich und zugleich empathisch wie die Aufsätze von Schlögel ‒ vor allem im Kontext der Melancholie, der Schwermut und der Unvereinbarkeit der sowjetischen Geschichtsschreibung mit der grauen und oft brutalen Realität des sozialistischen Alltags, wobei hier von einer Geschichtsschreibung gesprochen wird, die im Dienste des hegelianisch-marxistischen Materialismus und der daraus resultierenden Dialektik gestanden habe, wie Schlögel in seinem famosen Aufsatz »Melancholie und Geschichtsschreibung« feststellt.

Dieser Text leuchtet in seinem neuesten Werk, dem buntscheckigen Sammelsurium »Auf der Sandbank der Zeit. Der Historiker als Chronist der Gegenwart«, besonders stark und trägt zur Klärung der Frage bei, warum es so schwer sei, der sowjetischen Vergangenheit beizukommen und wenigstens hier und da Fetzen der Wahrheit zu entreißen. Schlögel schreibt darin: »Die sowjetische Geschichtsschreibung (…) war nicht nur ideo-zentriert, ideo-logisch, sondern teleo-logisch. Wo es nur um den Vollzug einer szientistisch verstandenen Fortschrittsgeschichte ging, stand Reflexion unter einem Generalverdacht. Reflexion förderte Unsicherheit und Skepsis, zersetzte jene Parteilichkeit und Härte, die im praktisch-politischen Geschäft erforderlich waren. Der Sammelbegriff für all diese als kleinbürgerlich denunzierten Schwächen war Melancholie, sodass Wolf Lepenies zu Recht von einem ›Melancholieverbot‹ im Herrschaftsbereich des Marxismus-Leninismus sprechen kann.«
Schlögels Essay »Melancholie und Geschichtsschreibung« ist insofern ein hochinteressanter, als dass er uns vor Augen führt, wie Täter und Opfer, Revolutionäre und Exilanten ihre eigene Geschichtserfahrung in Russland und auch in Mittelosteuropa während der sowjetischen Epoche betrachtet haben könnten ‒ keinem einzigen Kritiker Schlögels, der weder Nikolai Berdjajew noch Leo Schestow gelesen hat, die zwei Säulen der russischen modernen Philosophie zu Anfang des 20. Jahrhunderts, ist klar, was all diese Mikrokosmen in Verbindung mit der Weltgeschichte bedeuten. Der benjaminsche Flaneur sei, so Schlögel in »Narrative der Gleichzeitigkeit oder die Grenzen der Erzählbarkeit von Geschichte« (ebenso in seinem neuesten Buch), in den sowjetischen Städten unter die Räder geraten, da man ihn misstrauisch beobachtet habe ‒ könnte er doch ein Feind der Partei sein.
Überhaupt ist den Kritikern Schlögels, die gern in der Aggression des putinschen Russlands gegen die Ukraine einen Stellvertreterkrieg Westeuropas sehen ‒ geopolitisches Denken vorgaukelnd ‒, nicht klar, was das imperiale sowjetische Regime im Namen der kommunistischen Ideologie und Prophetie einem Menschen antun konnte ‒ was ja Putins Russland mehr oder weniger eins zu eins übernommen hat, nämlich dieses sowjetische Erbe der Todeskultur, gepaart mit Respektlosigkeit und Empathielosigkeit dem Individuum gegenüber, das an der großen imperialen, messianisch und historisch-ideologisch begründeten Idee nicht teilnehmen wollte oder nicht korrekt teilgenommen hatte. Millionen von Menschen, darunter zahlreiche Dichter, haben einen hohen Preis für ihren Drang nach Freiheit gezahlt. Der Sowjetstaat war zumindest nicht die Republik, in der sie leben und arbeiten wollten. Dieses Land kannte nur Unterdrückung und Seilschaften, und zwar ungeheuren Ausmaßes. Aber auch das »Eurasiertum« konnte sie nicht begeistern, zumindest in den meisten Fällen, und lebten sie heute, würden sie auch der Ideologie »Russki mir« wenig abgewinnen können.
Und die Fortsetzung der alten Muster und Verhaltensweisen im ehemaligen sowjetischen Imperium, das von Betonköpfen regiert und erst von Gorbatschow in seinen Grundfesten erschüttert wurde, folgte mit der Machtübernahme durch Putin und sein FSB. Wenn ich damals, also vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren, gefragt wurde, was nun aus Russland unter Putin werden würde, vor allem im Zusammenhang der Beziehungen zu Polen und Westeuropa, antwortete ich lapidar: Früher oder später werde Putins Russland versuchen, die alte Weltordnung wiederherzustellen, und das könne durchaus sogar in einem europäischen Krieg enden ‒ gegen die Ukraine, gegen Polen, gegen die baltischen Staaten, ja, selbst gegen den Westen. Meine Gesprächspartner zeigten mir dann oft den Vogel. Ich nahm es ihnen nicht übel, denn ihnen fehlte die elementare Erfahrung des Sozialismus und Kommunismus aus dem Ostblock, in dem ich geboren wurde und aufwuchs.
Beweise dafür, wer Anna Stepanowna Politkowskaja wirklich ermordet hat ‒ eine tapfere Frau, die in ihrer Kritik des autoritären Regierungsstils Putins kein Blatt vor den Mund nahm ‒, gibt es nicht, doch jeder, der sich keine Illusionen darüber macht, wie gefährlich die messianische Sehnsucht nach einem Imperium und nach einer gerechten Erfüllung der Geschichte mancher Russen ist, weiß, dass es nur einen Mörder geben kann. Das Menschenleben spielt in diesem großen Plan der totalen Machtausübung und -gier keine Rolle, so war es aber in Russland auch schon vor der Revolution und Machtübernahme durch die Bolschewiken. Das zaristische Reich wollte stets ein imperialer Player in Europa sein ‒ da konnte man auch Warschau schnell verschlucken, um an den preußischen Staat zu grenzen.
Aber bleiben wir noch ein wenig bei der Melancholie und der Mythologisierung.
Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel ‒ wobei ich am Abend zuvor auf einem Bankett die Frage einer besorgten Freundin beantworten musste, ob es wirklich zu einem Krieg komme und die russischen Soldaten in der Ukraine einmarschierten, was ich, ohne zu zögern, bejahte ‒, erwachten in Ost und West viele Ressentiments, von denen man dachte, sie seien in einem Museum des Kalten Krieges und der Mentalitätsgeschichte gut aufgehoben. Und so wurde auch ein schon etwas in Vergessenheit geratenes Gedicht »Auf die Unabhängigkeit der Ukraine« von Joseph Brodsky ausgegraben und analysiert, auch im deutschsprachigen Feuilleton. Brodsky hat es zwar nie in seine Gedichtbände aufgenommen, aber dennoch gern vorgetragen, dieses Pasquill gegen die Ukraine, die darin regelrecht beschimpft wird, wobei die Ukrainer klischeehaft als »Chochols« (die ukrainischen Kosaken mit dem charakteristischen Schopf) und ihr Nationaldichter Taras Schewtschenko im Vergleich zu Puschkin als ein minderwertiger Poet entlarvt werden. Recht hat Hans Christoph Buch, der in seinem Essay für die NZZ vom 5. Mai 2022 »Ein hässlicher Fleck auf der sonst weißen politischen Weste – wie Joseph Brodsky dazu kam, in einem Gedicht die Ukraine zu schmähen« nach Gründen für dieses Schmähpoem sucht, wenn er konstatiert, dass es unmöglich sei, all die Nuancen und Idiosynkrasien, die Brodsky in sein Pasquill transplantiert hat, im Deutschen wiederzugeben. Buch, der den Nobelpreisträger und Exilanten in den USA besucht hat, schreibt über das plumpe Gedicht seines Freundes: es »(…) ist zu lang, und es ist unübersetzbar, weil es nur aus idiomatischen Redensarten und Schimpfwörtern besteht, die Russen und Ukrainer einander um die Ohren hauen: ›Skalp-Locke‹ und ›Ziegenbart‹ sind die harmlosesten. Noch dazu ist es gespickt mit schwer zu entschlüsselnden Anspielungen: von der Schlacht von Poltawa (1709) bis zu Lenins kratzendem R. Es handelt sich um eine Schimpfkanonade, deren Autor, sonst nicht zur Obszönität neigend, die Ukraine zur Sau macht.«
Brodsky, der Czesław Miłosz anvertraute, er sei in einem Imperium aufgewachsen und als verschmähter Dichter in ein anderes Imperium, nämlich in die USA, geflüchtet, ist natürlich ein komplizierter Fall. Er hatte unter Dichtern viele Freunde, so auch Wystan Hugh Auden oder Adam Zagajewski: Er verachtete aber alle, die sich aus Dichtung nichts machten, und in Venedig drückte er seine Zigaretten in den Palazzi in Blumentöpfen aus, aber aus Verachtung vor Snobs und Ignoranten ‒ das Rauchen und Schimpfen über die Ignoranz gegenüber der Dichtung ließ er sich von niemandem verbieten. Buchs Argumentation, Brodsky habe als Jude die Erfahrung einer »verfolgten« Minderheit geerbt, die »Hitlers Todeslager«, »Stalins Hexenjagden« und zuvor »die Pogrome der sogenannten Schwarzen Hunderten« zu ihrer kollektiven Identität habe zählen müssen, was bei dem Dichter russischer Sprache aus der russischen Groß- und Hafenstadt Leningrad, dem ehemaligen St. Petersburg, zu einer enormen Skepsis gegenüber der Provinz geführt habe, leuchtet mir schon ein ‒ solch einem Autor aus dem mondänen »Petersburg« sei all das Leid der Juden in der russischen und ukrainischen Peripherie »in frischer Erinnerung« gewesen (und dort, in dieser verhängnisvollen Provinz, wollte er nie leben).
Und dennoch: Es ist ein seltsames und unnötiges Gedicht, das Brodsky zum Glück nie publiziert hat ‒ und eine bekannte russische und in Deutschland lebende Dichterin sagte mir einmal, na ja, das Gedicht sei doch ironisch, man dürfe es nicht ernstnehmen. Natürlich, erwiderte ich, doch in jeder Ironie, was ich nicht ausgesprochen, aber gedacht habe, steckt ein Körnchen Wahrheit. Brodsky gefiel sich schon in der Rolle des Ovid, des durch das Römische Reich verbannten Dichters, wohlgemerkt: eines Dichters einer imperialen Nation. Und trotzdem war er zugleich derjenige, der Dissidenten unterstützte und der einem Miłosz, wissend, welches Format dieser Autor und Kritiker des sowjetischen Imperiums hatte, in den USA den Weg zum verdienten Ruhm ebnete, indem er den Polen aus Berkeley für den Neustadt Prize empfahl.
Kehren wir deshalb zu der Raum- und Zeitproblematik zurück, die auch in diesem speziellen Fall durchaus eine wichtige Rolle spielt: Großdichter Brodsky aus Leningrad (aus »Petr«, wie er nicht nur liebevoll, sondern auch selbstbewusst St. Petersburg nannte) versus ukrainische Provinz, in der Täter und Opfer oft austauschbar waren. Karl Schlögel ist nämlich auch ein literarischer Raum- und Zeitdeuter ‒ er liest die Städte und Provinzräume und untersucht ihre Beziehung zur Zeit, so auch zu ihrem linearen Verlauf, aber auch zu solchem, der sich nur noch in der Erinnerung abspiele, abgekoppelt von der Gegenwart und trotzdem stets in einem dialektischen Verhältnis zu ihr, so der Historiker. Er lese deshalb Romane und Gedichte, die ihm, anders als historische Untersuchungen, lebendige Einblicke in die Geschichte geben würden. Er schreibt in dem Essay »Narrative der Gleichzeitigkeit oder die Grenzen der Erzählbarkeit von Geschichte« im selben Buch: »Als Historiker kann man nur mit Neid auf das blicken, was Schriftsteller und Dichter sich in ihrer unendlichen Freiheit erlauben können, während unsereins doch aufgerufen oder – gleichsam auf dem Boden kriechend – dazu verurteilt ist, den Dingen, den materialen Überresten auf die Spur zu kommen, den Quellen eben zu folgen. Die Leichtigkeit, mit der die Literatur Zeiträume erschaffen und erzählen kann, bleibt uns verwehrt. Sie führt uns aber Register vor Augen, von denen wir lernen können.« Fiktionale Literatur kann zum Beispiel ein historisches Ereignis als ein Motiv einsetzen und instrumentalisieren, um die Gegenwart zu kommentieren ‒ das Gleiche gelingt auch (utopischen) Sci-Fi-Romanen, etwa denen von Stanisław Lem oder Doris Lessing.
Bei dem Bild der Verschmelzung von Zeit und Raum bezieht sich Schlögel auf Michail Bachtins Begriff des Chronotopos. Der Historiker schreibt im selben Essay: »Der literarische Chronotop, in dem Zeit und Raum verschmolzen sind, bezeichnet Situationen, die an bestimmte Orte und Zeiten gebunden sind. Der Chronotop des Abenteuerromans mit seiner Beschleunigung und Überraschung ist anders als der des idyllischen Romans, der der langsamen und zyklischen Zeit folgt. Die Anregung oder Schlussfolgerung für eine Geschichtsschreibung lautet hier, dass es eine Korrespondenz zwischen geschichtlichem Verlauf und Konstellation einerseits und Darstellungsform andererseits geben könnte und dass die Katarakte katastrophischer Ereignisse eine andere Darstellungsform, vielleicht sogar ein anderes Genre verlangen als eben die Bewältigung einer langen, wohleingerichteten, in sich ruhenden Zeit.«
Natürlich kann man diese Ausführungen im Kontext der Gedichte von Miłosz oder der »Odyssee« von Homer lesen, erscheint uns doch der Raum in deren Werk magisch. In ihm, in der Landschaft und in den Städten, spielen sich tragische Heldengeschichten ab, oder noch ganz anders ausgedrückt: In den Apfelweinfässern ruht die Zeit und tut dem Wein gut, während gleichzeitig seit Jahrhunderten Kriege geführt werden. Die hier geschilderte geistige Landschaft Europas entstammt dem Gedicht »Notatnik: Bon nad Lemanem« (Notizbuch: Bon am Genfersee) von Miłosz.
Überträgt man aber all dies auf die Ukraine, wendet man all die Ausführungen zum Chronotopos in einem Kriegsgebiet an, wird man zerstörte Landschaften und Städte besuchen müssen: Schlögel schreibt in seinem Aufsatz »Charkiw. Der Krieg wird nicht nur an der Front entschieden« im selben Buch: »Putin hat in Charkiw-Saltiwka fortgesetzt, was er in Grosny, Aleppo und Mariupol schon vorgeführt hatte. Saltiwka – eine Stadt in der Stadt, verlassen, verwüstet, für lange Zeit unbewohnbar gemacht.«
An diese Gedanken knüpft der Historiker auch in seiner Dankesrede in der Paulskirche an: »Putins Russland ist entschlossen, die unabhängige und freie Ukraine von der Landkarte Europas zu tilgen. Putin hat es offen erklärt und beweist Tag für Tag seither, dass es ihm ernst damit ist. Kein Wort kommt an die Bilder der Zerstörung heran. Keine Grausamkeit, die seine Truppen nicht begangen haben. Nichts und niemand, der nicht zur Zielscheibe von Drohnen und Raketen geworden ist: Marktplätze, Wohnviertel, Museen, Krankenhäuser, Hafenanlagen, Bahnhöfe. Städte, die gerade dabei waren, sich in Form zu bringen – neue Flughäfen, Verkehrswege, Hotels – werden zurückgebombt. Städte werden zum Gelände, in dem man mit Drohnen auf Menschenjagd geht. Auf den Volltreffer der Rakete folgt der Volltreffer auf die Rettungsmannschaft. Die Industriegiganten des sozialistischen Aufbaus werden genauso in Schutt und Asche gelegt wie Kirchen, Klosteranlagen oder Sanatorien. Was einmal das ukrainische Ruhrgebiet war, gibt es nicht mehr. Wenn man das Land schon nicht erobern kann, dann muss es wenigstens zerstört, unlebbar gemacht werden.«
Der Vorwurf, der Krieg Putins sei in Wahrheit ein Stellvertreterkrieg der NATO und der EU gegen Russland, wir im Westen seien an diesem Krieg schuld, wollten wir selbst doch die Ukraine teilen und ausrauben, um uns zu bereichern und um geopolitisch besser dazustehen, erschließt sich einem nur dann, wenn man in der Tat nicht begreift, was Mittelosteuropa ist. In vielen Köpfen, nicht nur in den linken in Westeuropa, hat sich nämlich der Atavismus aus Jalta und dem Kalten Krieg tief eingenistet wie eine parasitäre Spezies: die Teilung in zwei Zonen, in die unter dem russischen Einfluss stehende Zone, in der solche Länder wie die Ukraine, Polen oder Litauen in einer Halbunabhängigkeit leben dürfen, und in die Zone, in der der Westen Westen bleibt, der ewige Feind Russlands, der doch endlich um den Dialog mit dem Imperium bemüht sein müsste.
Es ist ein Denken, das nur auf Erfahrung aufbaut und dabei die Reflexion ausschließt, weil es sich nur zu Meinungsbildung und Weltanschauung hingezogen fühlt ‒ nicht zum kritischen Betrachten. Und da dieses unkritische Denken keine Erfahrung mit dem sowjetischen wie auch russisch-postsowjetischen Imperium gemacht hat, dieses einfache und eindimensionale Denken, kann es nicht erkennen, wozu Putin fähig ist.
Manchmal möchte man diese Köpfe fragen: Und wenn der russische Herrscher baltische Staaten angreift und dann auch Polen ‒ was werdet ihr dann sagen? Geben wir ihm Polen und das Baltikum »zurück«? Und dann Ostdeutschland? Russische Panzer in Paris? Würden sie eurem naiven Denken eine Ernüchterung bringen? Ist das, was euch vorschwebt, die ihr glaubt, ein aggressives Imperium habe das Recht, sich zu nehmen, was auf seinem Speiseplan stehe, damit es endlich satt werde und das schöne Paris in Ruhe lasse?
Karl Schlögel sagt mutig zu all dem Komplex aus Missdeutungen und Imponderabilien »nein« ‒ der Kriegstreiber sitzt aber woanders, und er gehört noch obendrein zu den ewigen Drangsalierern dieser Menschheit, zu all den Männern, die seit Tausenden von Jahren denken, die Welt müsse ihnen dienen, müsse ihre Wünsche und Vorstellungen verwirklichen ‒ im Rahmen einer einzigen Wahrheit.
Ich gebe es zu ‒ ich konnte Putins Russland noch nie ausstehen, und obwohl ich ein eifriger Leser der philosophischen Werke von Berdjajew und Schestow bin und in Russland publiziert und Lesereisen absolviert habe, können sie mich zurzeit auch nicht mehr trösten. Die beiden Pariser Exilanten führten miteinander einen schwierigen Dialog, der eine als ein zum mystischen und esoterisch-religiösen neigender Denkaristokrat und Dostojewski-Spezialist ‒ der andere als ein Skeptiker und Nörgler, der nihilistisch und existenzialistisch zu allem »nein« sagte ‒ lange vor Emil Cioran und Jean-Paul Sartre. Aber wenigstens wussten sie, dass der Dialog die einzige Form der Kommunikation ist, die zum Erfolg der Gesellschaft und der Menschheit per se führen kann. So sehe ich auch das Werk Schlögels ‒ als eine Kontinuation des Dialogs und nicht als einen Bruch mit der Zivilisation und Kultur, weil sie beide vor allem zum Unheil neigen würden.
22.-24. Oktober 2025, im Verlag Edition Faust, Frankfurt am Main
Letzte Änderung: 29.10.2025 | Erstellt am: 24.10.2025
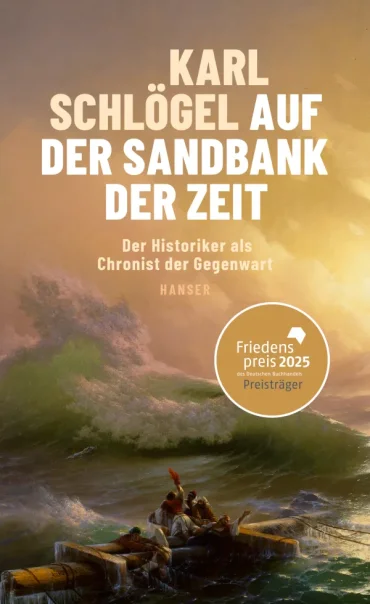
Karl Schlögel Auf der Sandbank der Zeit. Der Historiker als Chronist der Gegenwart
Erscheinungsjahr: 2025
176 Seiten, gebunden
Auch als E-Book erhältlich
ISBN-10: 3446286918
ISBN-13: 978-3446286917
Preis: € 23,– | sFr 21.90,–
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


