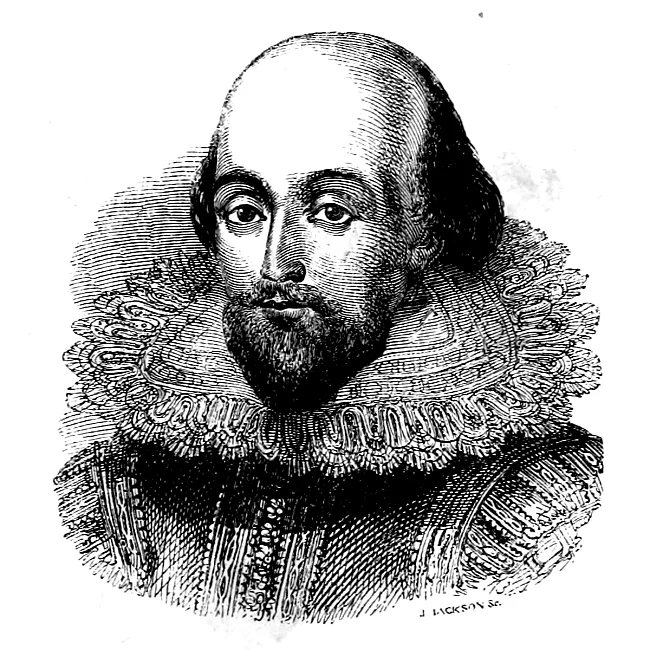
Shakespeares Königsdramen zeigen die ewige Versuchung der Macht – und warum ehrgeizige Herrscher oft scheitern. Stefana Sabin wirft einen Blick auf diese zeitlose Warnung für Wähler und Politiker gleichermaßen.
Auf einem Empfang im Weißen Haus 1998 zu Ehren des poet laureate Robert Pinsky erzählte der damalige Präsident Bill Clinton in seiner Begrüßung, wie er in der Highschool Passagen aus Shakespeares Macbeth auswendig lernen musste. Unter den erlauchten Gästen war auch der Harvard-Gelehrte und renommierte Shakespeare-Forscher Stephen Greenblatt, der Clinton bei der Verabschiedung darauf ansprach. „Herr Präsident“, sagte Greenblatt gemäß seines eigenen Berichts, „finden Sie nicht, dass Macbeth ein großartiges Stück über einen immens ehrgeizigen Mann ist, der sich ermächtigt fühlt, politisch und moralisch katastrophale Taten zu begehen?“ Clinton antwortete, ohne zu zögern, während er ihm noch die Hand schüttelte: „Ich denke, dass Macbeth ein großartiges Stück über jemanden ist, dessen immenser Ehrgeiz ein ethisch inadäquates Ziel hat.“
Die spontane und derart geschickte Antwort, die Macbeth’ Machtwillen und die unheilvollen Impulse, die ihn zum Morden treiben, so prägnant fasste, erstaunte den Shakespeare-Gelehrten. Und er überlegte, ob sich in Shakespeares Historien, „ein ethisch adäquates Ziel“ für menschlichen Ehrgeiz entdecken lässt.
Tatsächlich sind Shakespeares Königsdramen eminent politische Stücke, die nicht nur die Geschichte Englands aufarbeiten, sondern auch die zeitlosen Dynamiken der Macht und deren Konsequenzen aufzeigen. Und vielleicht gerade, weil sie in fiktionaler Brechung allgemeine Fragen nach Herrschaftsverhältnissen und gesellschaftlicher Verantwortung stellen, sind diese Stücke von anhaltender Aktualität – und eine wertvolle Ressource für das Verständnis von politischem und allgemein menschlichem Verhalten.
Wenn Shakespeare unser Zeitgenosse bleibt, wie der polnische Literaturtheoretiker Jan Kott Mitte der 1960er Jahren meinte, dann nicht, weil er unsere heutigen Ansichten und Meinungen teilt, sondern weil er unsere Qualen und Zweifel versteht. Er inszeniert Geschichte als einen brutalen Machtkampf und erzählt von der unwiderstehlichen Verlockung der Macht. Weniger eine ideale Menschlichkeit – vielmehr die reale Entmenschlichung im Machtkampf ist ein durchgehendes Thema der Königsdramen.
Das dauerhaft Erstaunliche an Shakespeares Dramen besteht darin, dass seine Figuren uns nahe bleiben, ja uns immer noch verfolgen, obwohl die sozialen, politischen und ethischen Strukturen, auf die sie sich stützten, längst vergangen sind. Denn Shakespeares Königsdramen – und seine Dramen überhaupt – führen die zeitlose Gültigkeit menschlichen Verhaltens vor: gesellschaftliche Verhältnisse und Einstellungen ändern sich, aber die Hauptrollen bleiben.
Shakespeares Königsfiguren agieren einen unerbittlichen Willen zur Macht – sie sind getrieben von einem immensen Ehrgeiz, der oft ein ethisch inadäquates Ziel hat. Sie entwickeln ständig neue Strategien für ihr Handeln und setzen sich über innere Konflikte ebenso hinweg wie über moralische und soziale Konventionen. Deshalb haben diese Stücke immer auch eine psychologische Dimension: Sie zeigen, wie Machtfantasien entstehen und mit welcher Rücksichtslosigkeit sie verwirklicht werden – und welche gesellschaftlichen Gefahren lauern, wenn nicht der politische Gestaltungswille, sondern der narzisstische Geltungsdrang den Ehrgeiz treibt.
Und das ist das Besondere an Shakespeares Königsdramen: dass sie in der Mischung aus tatsächlicher Geschichte und erfundener Handlung, aus gesellschaftlicher und psychologischer Erkenntnis das Politische erfinden.
„In den acht Jahren, in denen ich unter schwierigen Umständen versucht habe, Gutes zu bewirken“ schrieb Bill Clinton über Shakespeare‘s Lessons in Leadership auf der Seite der Shakespeare Theatre Company, „boten mir die Königsdramen immer wieder Orientierung über die Lasten und die Herausforderungen des Amtes ebenso wie über die Schwierigkeit, manchmal den gewöhnlichen Mann hinter dem Amt zu verdrängen und manchmal gerade ihn aufscheinen zu lassen.“
Gerade in schwierigen Zeiten wie die jetzigen würden Shakespeares Königsdramen wichtige Erkenntnisse bieten, wenn Politiker – und Wähler! – sie nur lesen würden.
Letzte Änderung: 20.02.2025 | Erstellt am: 20.02.2025


