Polnische Postkarten mit Gedichten, aber auf Deutsch geschrieben
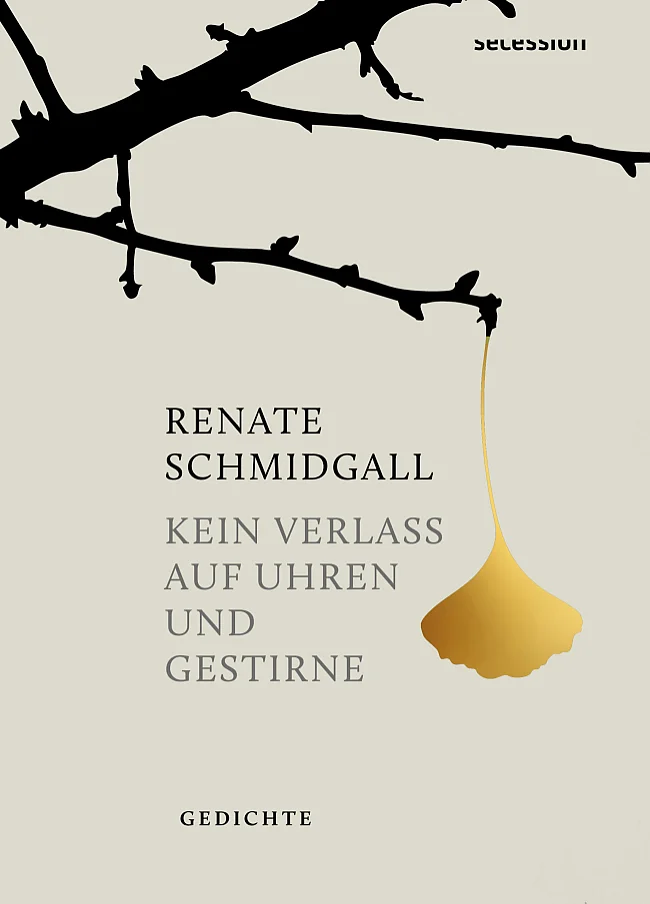
Die renommierte Übersetzerin der polnischen Literatur Renate Schmidgall verarbeitet in ihrem ersten Gedichtband Einflüsse aus beiden Kulturen ‒ der deutschen und polnischen. Dabei greift sie in ihrer Lyrik solche Themen auf, wie die Kindheit in Deutschland, die Erinnerung an sie und an polnische Dichter und Freunde, die Identität und das Phänomen der Zeit, das uns Menschen oft einen Strich durch die Rechnung macht, weil wir uns auf sie nicht einmal im Kontext unserer Erinnerungen verlassen können. Schmidgalls Gedichte sind geprägt sowohl von persönlicher ‒ intimer ‒ wie auch von kulturgeschichtlicher Erfahrung, wobei sich in ihrem Werk Bezüge finden, die ihre genaue Kenntnis Osteuropas unter Beweis stellen, so Artur Becker.
Das Doppelleben einer Poetin
Literaturübersetzer, insbesondere die hervorragenden unter ihnen, fangen irgendwann an, eigene literarische Texte zu verfassen, zumal sie manchmal ihrer Schützlinge, die sie oft seit Jahrzehnten schon übersetzen, und ihrer Bücher etwas überdrüssig geworden sind. Sie haben dann den Eindruck, dass sie, indem sie ihnen treu geblieben sind und sich über viele Jahre hinweg mit ihrer Literatur beschäftigt haben, fast wie in einer Ehe mit ihnen leben, und eine Ehe kann ja bekanntlich nach sehr langer Zeit ziemlich langweilig oder anstrengend werden. Susanne Höbel, die deutsche Übersetzerin der Prosa von John Updike, vertraute mir schon vor vielen Jahren auf einer Übersetzerkonferenz in Wolfenbüttel an, dass sie plötzlich genug von ihrem Liebling hatte und sich einfach von ihm »scheiden ließ«. Ich weiß nicht, ob sie auch Gedichte schreibt wie Renate Schmidgall (Jahrgang 1955), die in Darmstadt lebt und seit Jahrzehnten polnische Literatur ins Deutsche übersetzt – zeitgenössische Prosa und Lyrik, zum Beispiel Paweł Huelle und Andrzej Stasiuk oder Maciej Niemiec und Adam Zagajewski. Allerdings scheint Renate Schmidgall ihre Autoren, deren Werke sie übersetzt hat, nach wie vor zu lieben ‒ sonst hätte sie ihnen nicht so viele Gedichte gewidmet.
Als ich also Schmidgalls exzellenten Gedichtband »Kein Verlass auf Uhren und Gestirne« zu Ende gelesen hatte, der 2025 im Secession Verlag in Berlin erschienen ist und Gedichte aus den Jahren von 1994 bis 2024 versammelt, fiel mir noch etwas ein: dass ich Anfang der 90er Jahre – ich glaube, es war 1991 – eines meiner ersten Manuskripte mit Gedichten mit dem für Debütanten recht typischen Titel »Zeithaut« an das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt geschickt hatte: gut, dass es nie erschienen ist. Und die arme Renate Schmidgall, die damals in diesem legendären, von Karl Dedecius gegründeten Institut arbeitete, das in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen feierte, musste ans andere Ende der Stadt fahren, um meine Sendung bei der Post abzuholen, und war nach der Lektüre einiger Gedichte enttäuscht. Außer Atem und verärgert rief sie mich ‒ wenn ich mich recht erinnere ‒ noch am selben Tag an: Wozu solche Gedichte und warum nehme ich ihr überhaupt so viel Zeit weg? Aber junge Dichter sind gnadenlos, und das ist gut so, denn sie müssen sich durchsetzen, sie müssen gegen Giganten kämpfen.
Das war vor fast fünfunddreißig Jahren, und heute ist Schmidgall tatsächlich eine Dichterin zweier Kulturen und Sprachen. Sie trägt die Poesie ihrer deutschen Heimat in sich, aber sie trägt vor allem die Poesie Polens in ihrem lyrischen Herzen, vor allem die neueste, die sie oft selbst übersetzt hat: Szymborska, Herbert, Zagajewski, Niemiec … Crème de la Crème. Übrigens: In Polen ist Schmidgall als eigenständige Lyrikerin (die auch einige ihrer eigenen Gedichte ins Polnische selbst übertragen hat) schon längst bekannt, und man kann schmunzelnd sagen, dass ihr Debüt dort stattfand, wo ihre treuesten literarischen Freunde seit Jahrzehnten wohnen und schreiben.
Widersprüchliche Verbündete: Zagajewski und Niemiec, das ungleiche Paar
Das Interessanteste ist, dass Schmidgall zwei polnische Dichter, die über Jahrzehnte in Paris Exilanten gewesen waren, besonders schätzt und favorisiert, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten, sodass man sich fast auf die Zunge beißt, wenn man ihre Namen in einem Atemzug nennen muss: Das lyrische Werk von Adam Zagajewski und das von Maciej Niemiec ‒ vergleicht man es miteinander, so erkennt man schnell, dass man hier mit zwei fremden Planeten und Zivilisationen zu tun hat (wobei Niemiec immer noch auf eine Bekanntmachung seiner Lyrik in Deutschland wartet). Zagajewskis Poesie neigt zum Stoizismus, zum Zen-buddhistischen Innehalten, sie kreist um Harmonie und huldigt ästhetisch dem vitruvianischen Menschen – dieser Dichter schreibt kristallklare Gedichte und beschäftigt sich vor allem mit kulturhistorischen Problemen, unserer europäischen Heimat und Ontologie im weitesten Sinne, was ja auch nicht verwundert, denn Herbert und Miłosz haben Zagajewski tief beeindruckt und beeinflusst, einen der Hauptvertreter der »Neuen Welle« in Polen, die in den Siebzigern mit ihrem ironischen und knallharten Realismus die polnische Poesie auf den Kopf gestellt hat, nach dem Motto: In der Kürze liegt die Würze.
Niemiec hingegen ist ein Hamlet-ähnlicher Dichter wie Kazimierz Ratoń – übrigens ein in Polen längst vergessener Autor –, aber Niemiecs Poesie steht mindestens zehn Stufen über Ratońs Werk, das heißt, Niemiec ist in der polnischen Sprache ebenso wie Zagajewski ein Dichter von höchstem Rang, dem es jedoch auf dieser irdischen Welt nicht leichtgefallen ist, glücklich und zufrieden zu sein, denn seine gesamte Poesie ist aus dem Schmerz des Daseins gewoben. Sie entstand immer aus dem Schrei gegen unser Dasein – gegen die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber der Vergänglichkeit und dem Tod. Sie entstand aus der Angst vor dem Vergessen, aus der Angst vor dem Verlust des Selbst, aus der Angst vor dem Verlust der Heimat, aus der Angst vor dem Verlust der Kultur, aus der Angst vor dem Verlust der Geschichte, aus der Angst vor dem Verlust der Identität, aus der Angst vor dem Verlust der Menschlichkeit.
Mit anderen Worten: Niemiec ist ein Punk, Zagajewski ein Mönch, der sich um den Frieden der Seele und die kosmische Ordnung der Welt kümmert, auch deshalb, weil unsere Zivilisation immer wieder kurz vor der Selbstzerstörung steht, obwohl es so viel Schönheit auf der Erde gibt – Schönheit in der Poesie, Kunst und Philosophie und auch in der Natur.
Doch trotz all dieser weltanschaulichen Diskrepanzen und poetischen Widersprüche ist Schmidgall in der Lage, beiden Dichtern eine besondere poetische Zuneigung und Wertschätzung entgegenzubringen: Und gerade in ihrer eigenen Poesie zeigt sich, wie sehr die Dichterin Schwarz mit Weiß, Feuer mit Wasser, die unerbittlich vergehende Zeit mit der Ewigkeit verbinden möchte. Ihre Gedichte sind auf den ersten Blick voller Harmonie, sprühen geradezu vor Energie – sie strahlen positives helles Licht aus; aber unter der Oberfläche dieser Harmonie sieht alles anders, ja sogar oft dunkel aus – auch ihre Gedichte schreien und beklagen die Welt: Die Dichterin reflektiert über ihr eigenes Dasein, ihren eigenen Untergang, ihre eigene Zerbrechlichkeit, die ihren Ursprung in der Kindheit hat.
Die Möwen von Ahrenshoop und die »Krim-Sonette« von Adam Mickiewicz
Vielleicht tauchen deshalb – aufgrund dieser Dialektik – in Schmidgalls Gedichten so oft Möwen auf: einerseits schöne, würdevolle Vögel, andererseits aber auch streitsüchtige und kämpferische Raufbolde und Zeitgenossen, deren Spezialität ist, andere zu ärgern. In dem schönen Gedicht »Ahrenshoop« scheint die Möwe eine solche unruhige Seele zu sein, die plötzlich als Eindringling und Feind herbeifliegt, um jedwede Harmonie zu zerstören, der Idylle ein Ende zu bereiten, wobei dieses Gedicht natürlich auf die Poetik und die rhetorischen Mittel von Maciej Niemiec anspielt: »Durch die Scheibe des Autos / sieht man eine Düne, Grasbüschel, einen Streifen / Himmel. Plötzlich fliegt eine Möwe in dieses Bild hinein – / vom Fenster für einen Augenblick eingefangen, / bevor sie entschwindet – in etwas Unbeschreibliches«.
Das beliebte Ostseebad Ahrenshoop ist eine malerisch gelegene Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern: Dänemark ist zum Greifen nah, und die Gegend ist vor allem dafür bekannt, dass sie Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg ein Mekka für Künstler war, wobei bis heute im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop Studienaufenthalte möglich sind. Es scheint aber, dass die Schönheit der Landschaften und der Natur ein größeres Thema in Schmidgalls Gedichten ist, vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber sicherlich mit Wurzeln in der klassischen deutschen und auch polnischen Poesie. Es geht hier nicht nur um Vertreter der Sturm-und-Drang-Bewegung, es geht nicht nur um Romantiker. Es gab schließlich einen Dichter wie Friedrich Hebbel, der Winterlandschaften beschrieb, und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrieben auch Dichter der ersten Reihe über Natur und Landschaften: Sarah Kirsch oder Peter Huchel zum Beispiel.
Betrachten wir also lieber die polnischen Wurzeln und Einflüsse bei Schmidgall: Die berühmten »Krim-Sonette« des polnischen Nationaldichters und Klassikers Mickiewicz und Widmungen von Gedichten an Andrzej Stasiuk, Maciej Niemiec und Paweł Huelle tauchen in ihrer Lyrik nicht nur als kulturelle Referenzen auf. Die Dichterin tritt hier bewusst in einen Dialog mit der polnischen Literatur, antwortet polnischen Dichtern und Prosaautoren und knüpft an ihre Themen und ihre Poetik an. Im Gedicht »Ich denke an Boltenhagen«, das Stasiuk gewidmet ist, taucht ein Angler auf, der am Meer meditiert – aber die Bildhaftigkeit dieser Verse erinnert an die farbenfrohen Beschreibungen der Nacht, des Himmels und der Natur in Stasiuks Erzählungen. Und wenn die Dichterin aus Polen nach Deutschland zurückkehrt, wo »auch die Wolken« »ordentlich« »stehen«, wie sie in einem anderen Gedicht schreibt, spürt man ihre Sehnsucht nach dem polnischen Klima.
Die nächste Frage sollte lauten: Welche Bedeutung haben die »Krim-Sonette« für die Dichterin? Es geht also ‒ grob umrissen ‒ um romantische Motive und um die Sehnsucht nach der fernen Welt, nach Reisen. Schmidgall liebt es nämlich, ihre Reisen zu beschreiben, und somit besuchen wir mit der Dichterin die Krim und Sopot, Paris und Odessa, Moskau und Faro, Granada und Tschechien, Rhodos und Danzig und immer wieder die Orte ihrer Kindheit: Heilbronn und Sontheim. In »Die letzte Nacht auf der Krim«, versehen mit einem Motto aus den »Krim-Sonetten«, wartet die Dichterin darauf, sich von der Schönheit des Schwarzen Meeres zu verabschieden, aber es will nicht klappen; sie kann diesen schönen Ort nicht verlassen, denn selbst die Zeit, obwohl sie unerbittlich vergeht, hat hier keine Bedeutung mehr. Dieses freudsche Gedicht ist wie ein Traum vom großen Ozean, in dem nichts mehr unsere Existenz bedroht, kein kultureller Pessimismus, kein Katastrophismus. Endlich können wir wir selbst sein und müssen uns nicht zurückhalten – wir müssen vor niemandem so tun, als wären wir glücklich. In diesem Traum kehren wir zum Ozean zurück, aus dem wir alle stammen – »Das Unbehagen in der Kultur«, ein Essay von Sigmund Freud aus dem Jahr 1930, handelt genau davon, wie sehr wir uns nach Freiheit und Unschuld sehnen, nach der Zeit also, als wir im Paradiesgarten noch nicht darüber nachdenken mussten, was uns die Zukunft bringen würde und wer wir einmal sein würden und unbedingt sein sollten.
Rückkehr nach Hause und »der ewige Moment«
beziehungsweise »der Duft der Ewigkeit«
Das Huelle gewidmete Gedicht »Nach Weinsberg fahren« sticht jedoch aus diesem eleganten Sammelband hervor, in dem es um eine ganz andere Rückkehr geht – nämlich in die »Heimat«, also zum Elternhaus. Es ist ein sehr romantisches Gedicht, in dem alles vorkommt: ein Schaffner, Brombeeren, ein Bahnhof und inmitten der Weinberge sogar eine mittelalterliche Burg. In diesem Gedicht kehrt Schmidgall in ihr »Tal der Issa« (so heißt Miłoszs Kindheitsroman) zurück, also in die Welt ihrer Kindheit, in der das Gift der Zeit keine Wirkung hat, wie die Dichterin in einem anderen Gedicht unter Berufung auf Bruno Schulz postuliert: »›An allem schuld ist / der schnelle Verfall der Zeit‹« heißt es in »Donnerstag«.
Ein Postskriptum muss an dieser Stelle natürlich sein: Der Titel »Nach Weinsberg fahren« spielt auf eines der schönsten Gedichte von Zagajewski und der polnischen Dichtung an: »Nach Lemberg fahren«. Schmidgall hat auch ihr Lemberg, und in ihrem Gedicht schreibt sie: »nach Weinsberg fahren, die Gegenwart / beiseiteschieben wie den Vorhang«. Schön, nicht wahr? Alles scheint so still und einfach zu sein, liest man solche Zeilen, und doch ist der Geist des lyrischen Ichs voller Unruhe und Verwunderung, dass jeder von uns seinen eigenen »ewigen Moment« hat, in dem nur für ihn die Unsterblichkeit zum Greifen nah ist, und sonst für niemand anderen. Kurz gesagt: Jeder hat sein Weinsberg, jeder hat sein Lemberg …
Sehen wir uns noch einen Moment lang im Zusammenhang mit der Rückkehr nach Hause die Landschafts- und Reisegedichte an: Die Dichterin interessiert sich darin, wie bereits erwähnt, vor allem für die Störung oder gar Zerstörung von Harmonie und Idylle. Wenn wir die Schönheit betrachten und uns an der Landschaft erfreuen, fühlen wir uns glücklich, es geht uns gut, und plötzlich geschieht etwas Ungewöhnliches, das wir nicht erwartet haben und das ikonoklastisch ist – es dauert buchstäblich nur den Bruchteil einer Sekunde, in der plötzlich alles kaputtgeht und zusammenbricht und die Schönheit verschwindet, ebenso wie das Gefühl der Zufriedenheit. Trotzdem wirkt diese plötzliche Störung faszinierend. In dem Gedicht »Schneegestöber mit Birne (in memoriam Wilhelm Genazino)« schreibt Schmidgall (wobei in diesem poetischen Puzzle alle Sätze aus einem Buch des erwähnten Autor stammen würden, so die Fußnote im Gedichtband): »Der Wind drückt die Flugbahn der Flocken nach oben, / als flöge der Schnee wieder in den Himmel. // An dem Baum im Garten hängt eine Birne; / als es Zeit dafür war, ist sie nicht vom Ast gefallen. / Auch ich möchte vergessen, worauf ich warte.« Was zum Teufel hat die Birne mitten im Winter an einem Baum zu suchen?, wundern wir uns. Und dennoch ist sie da und so lebendig, als wäre nichts geschehen. Und etwas Ähnliches fragt man sich, wenn man das Gedicht »Große Augen (für Andrzej Stasiuk)« liest: Was zum Teufel haben diese zwei Störche im Regen auf einem Feld irgendwo bei Bełżec zu suchen? Ihr Durchhaltevermögen und Stoizismus beunruhigen uns ‒ angesichts des Bösen, das in dieser Landschaft einst geschah. Schmidgall schreibt in diesem Gedicht: »Ein Dorf namens Wielkie Oczy, Große Augen, / klebt an der ukrainischen Grenze wie eine Fliege / am Fenster. Ein Laden, ein Kreisel, von dem / drei Straßen ins Nirgendwo abgehen. (…) // Zehn Kilometer nach Bełżec. Ein Feld aus Schlacke / und die Namen der Orte, aus denen die Juden / deportiert wurden. Vierhundertfünfzigtausend. / Sanik, Sambor, Drohobycz, Tuchów, Stryj, Żydaczów. / Geordnet nach den Monaten des Abtransports. / Die Vitrine mit Schuhen. Listen der Gegenstände: / Uhren, silberne Zigarettendosen. Anzahl, Wert / pro Stück, Gesamtwert. (…) / Ein SS-Offizier floh und erhängte sich 1945. / Die Landschaft ist flach. Auf dem Feld hinter Bełżec / zwei Störche im Regen.«
Ein weiteres großes, vielleicht metaphysisches Thema in dieser auf den ersten Blick zarten Lyrik ist die Zeit und ihr verwegenes Spiel mit uns Menschen. Manchmal heilt sie, und manchmal ist sie ein gnadenloser Richter. In »Durch die Beskiden (für Andrzej Stasiuk)« lesen wir: »Am Himmel steht senkrecht der Viertelmond / über den Scherenschnitten der Tannen. Gleich / wird die Reise Erinnerung sein, // und wir haben, was wir brauchen.« Die Ankündigung der Vergangenheit ist hier nicht bloß ein Ausdruck der Melancholie, es geht vielmehr um unser Bewusstsein, das sich zeitlos durch die Räume unseres Lebens bewegt, die Linearität dabei aufheben kann, obwohl wir, gefangen in einem physischen sterblichen Körper, zunächst einmal nur als Statisten dieses kosmischen Dramas erscheinen mögen.
Aber dann wird es noch konkreter und magischer, sobald die Autorin in ihre Erinnerungen eintaucht, wie in dem Gedicht »Schmetterlinge« (für Adam Zagajewski zum Geburtstag)«: »Jetzt wird die lila Erinnerungsmaschine / schon im Juni angeworfen; / und duftet wie die Ewigkeit / (wie Deine Pfingstrosen).« Den Duft der Ewigkeit ‒ den kennt jeder und eben nicht nur aus den Romanen des 19. Jahrhunderts. Und die Erinnerung an diesen universellen Duft, der einer bestimmten Vergangenheit anhaftet und den man zum Beispiel auch aus der Kindheit kennt, kann eben wohltuend sein. In »Karlsruhe« lesen wir daher: »Tante und Onkel längst tot, die Adresse lebt. / Jahrzehnte später eine Veranstaltung mit Paweł Huelle, / zu der Freunde kamen. Ich genoss die Mischung / aus Schwäbisch und Polnisch, bei badischem Wein. / Heimat. Man kann nicht genug davon haben.«
Nachwort von Michael Krüger und Identitätsmeditationen
Nach der Lektüre von Krügers Nachwort hatte ich den Eindruck, dass er in Schmidgalls Gedichten poetische Meditationen sehen möchte, wie wir sie aus den Texten von Hildegard von Bingen oder Thomas Merton kennen. Das ist kein falscher Ansatz, dennoch zeigt er nur eine von vielen Facetten dieser Poesie. Denn Schmidgall, und das finde ich unglaublich spannend, trägt auch Tadeusz Różewicz in sich: In ihren Gedichten finden wir auch die »Unruhe« des wachen Geistes, die der Dichter aus Gleiwitz und Breslau sein Leben lang in sich getragen hatte; in »In den Briefen Vögel« schreibt Schmidgall: »Ich träumte, jemand hat meine Wohnung / aufgeräumt, doch unter dem Teppich / bricht der Boden.« Wir finden bei dieser Autorin auch jede Menge Unzufriedenheit, Ungeduld, Untreue, denn diese Poesie ist auch messerscharf – sie zerlegt die Welt in kleine Teile und zieht die Schleier beiseite, hinter denen sich unsere dunkelsten Geheimnisse, unsere verlorenen Lieben, unsere vergangenen Wünsche und ungestillten Sehnsüchte verbergen.
Diese großartige Übersetzerin der zeitgenössischen polnischen Literatur, die 2013 Mitglied der Jury der ersten Ausgabe des Wisława-Szymborska-Preises war, kann auch nonkonformistisch sein – sogar destruktiv. Davon zeugt beispielsweise das Gedicht »Ostern bei den Schwiegereltern«, und diese wenigen Zeilen sollen meine Überlegungen abschließen: »Für ein paar Stunden ist Friede (wie damals, / mitten im Krieg) – das Kind spielt Klavier, / der Kaffee duftet, und der baldige Abschied / wird angenehm wehtun.«
Epilog für Anfänger
Abschließend möchte ich diese Gedichte auch einigen Politikern ans Herz legen, damit sie sehen, wie eine Deutsche über Deutschland und Polen schreibt, das nach 1945 einen ganz anderen Identitätskonflikt erlebt hat als sein westlicher Nachbar. Politiker glauben oft, dass sie Weltbürger, dass sie Reisende seien, die überall hinkommen, an jeden Ort, und zu jedem Bürger sprechen könnten; dass sie genau wüssten, wie komplex unsere Identität sei. Und weil sie das glauben, verweise ich sie oft auf die Poesie ‒ die des polnischen Dichters Czesław Miłosz und die von T. S. Eliot, also auf die besten Dichter aus Ost und West, die geradezu ostentativ und prophetisch ihr Werk den dringendsten Krisen und Schwierigkeiten unserer modernen Identität im 20. Jahrhundert gewidmet haben.
Die Wahrheit ist jedoch grausam, denn fast niemand hört auf Dichter. Manchmal erhalten sie eine große Auszeichnung. Dann haben sie ihren großen Auftritt, der zwei oder fünf Minuten dauert. Und Verrückte wie ich lesen konzentriert Gedichte und schreiben darüber für andere Verrückte. Das Tröstliche ist jedoch, dass sich an diesem Zustand eine Sache nie ändert: Nach uns werden andere kommen und das poetische Werk fortsetzen.
Letzte Änderung: 28.11.2025 | Erstellt am: 27.11.2025
Veranstaltungshinweis:
Renate Schmidgall liest aus ihrem Gedichtband
»Kein Verlass auf Uhren und Gestirne«
am Donnerstag, den 27.11.2025
in der Stadtteilbibliothek Bornheim in Frankfurt am Main
Beginn 19:30 Uhr
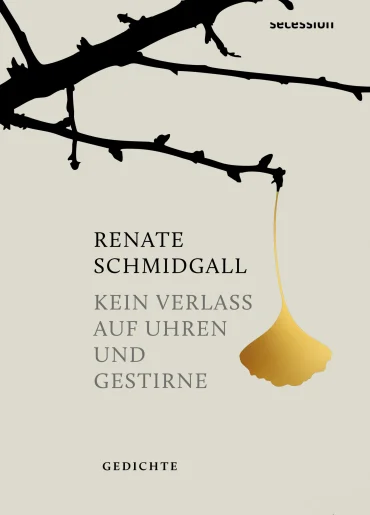
Renate Schmidgall Kein Verlass auf Uhren und Gestirne
Gedichte
Mit einem Nachwort von Michael Krüger
Englische Broschur
143 Seiten
€ (D) 18.00 | € (A) 18.50
erschienen 22. September 2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


