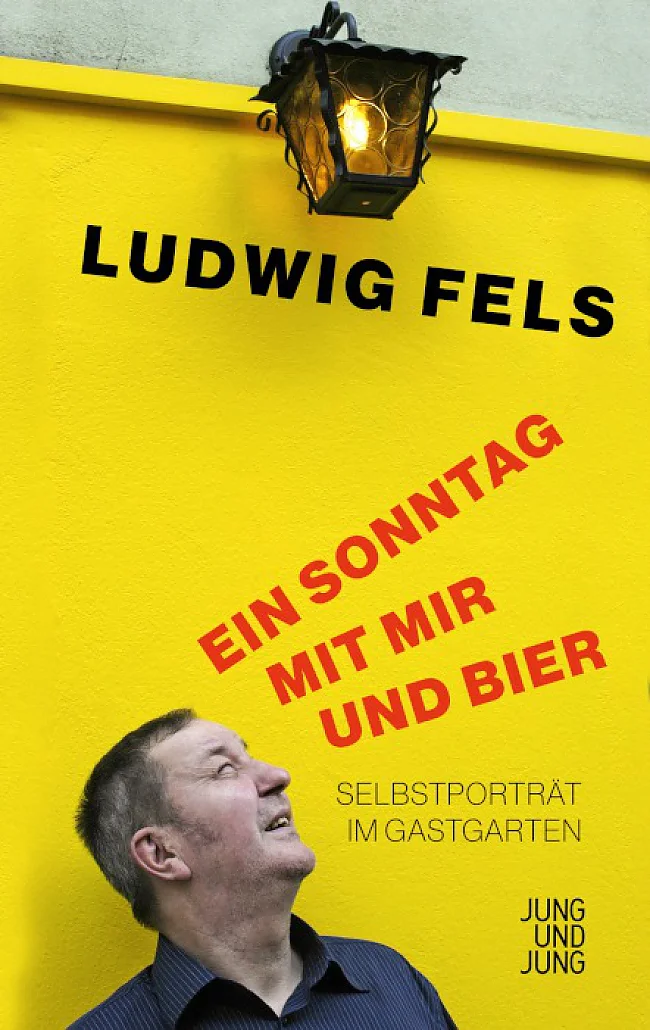
»Der ›Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller‹ Ludwig Fels sitzt an einem langen Sonntag im fränkischen Biergarten, und wir Zuschauer lachen uns kaputt und weinen manchmal mit, denn der Dichter hat Lyrisches, Privates, Dramatisches und Weltumspannendes zu berichten, aber nicht zu wenig und auch nicht zu viel, sondern genau auf den Punkt. Sein bei Jung und Jung posthum veröffentlichtes Manuskript »Ein Sonntag mit mir und Bier. Selbstporträt im Gastgarten« ist eine gnadenlose, philosophisch anmutende Abrechnung mit sich selbst und der Welt ‒ und nicht nur eine ironische Selbstbetrachtung und Blödelei.
Als ich mich an die Rezension des posthum veröffentlichten Buches »Ein Sonntag mit mir und Bier. Selbstporträt im Biergarten« (Jung und Jung 2025) von Ludwig Fels setzte, dachte ich mir: Ohne zwei, drei Flaschen Starnberger Hell schaffe ich die Rezension nicht, ich muss mich nämlich auf das gleiche Niveau katapultieren, in die dünne fränkische Luft, in der Fels seinen herrlich verrückten Biergartenmonolog hält ‒ voller Humor, bitterehrlich und so leicht zugleich, als würde man fünf Zentimeter über dem Boden schweben und alles Böse und Schmerzliche aus seinem Leben endlich getilgt haben.
Allerdings dachte ich noch an etwas anderes: Wer mit dem Irrationalen nichts anzufangen weiß und unbedingt einen roten Faden braucht, sollte von »Ein Sonntag mit mir und Bier. Selbstporträt im Gastgarten« lieber die Finger lassen. Dichter sollten jedoch dieses Wunderwerk unbedingt lesen, sie werden dann lernen, dass Irrationales beim Erzählen durchaus hilfreich sein kann ‒ als Brennstoff für Anarchie und Medizin gegen die Langeweile, als Quelle für die Assoziationen beim Schreiben.
Ja, der rote Faden ist in diesem Buch eigentlich ganz dünn: Da sitzt einer im Biergarten und erzählt von seinem Leben als Dichter, dekonstruiert sich selbst, entblößt seine Schwächen und rechnet nicht nur mit sich selbst ab, sondern auch mit seiner fränkischen Heimat, mit Deutschland und Europa wie auch mit den Spießern und Dauernörglern, die den Biergarten ‒ eigentlich das Felsʼsche Hoheitsgebiet ‒ besuchen, um dümmlich in ihre Smartphones zu starren, wie Fels schreibt; er lässt dann ein paar Tote wiederauferstehen, redet mit ihnen, was nach einigen Maß Bier sogar logisch erscheint, und lässt sich von einem Taxi nach Hause fahren, wo auch immer dieses sein soll. Also ‒ man könnte einfach meinen: nichts Spektakuläres, aber ein netter Text.
So einfach ist es aber nicht – Fels hatte schon seine Gründe dafür, dass das Buch zu seinen Lebzeiten in seinem Archiv verblieb, und während man es liest, spürt man, dass der Autor an eine Veröffentlichung wohl nicht ernsthaft gedacht hat. Man spürt während der Lektüre eher, dass er etwas Verbotenes schreibt, etwas, was man normalerweise unter keinen Umständen sagen sollte ‒ weder in der Familie noch in der Öffentlichkeit, wenn man zumindest ein ernstzunehmender Dichter ist. Das »Feeling« im Buch ist also (ich zitiere den Dichter an dieser Stelle als einen Täter) folgendes: »Ich beanspruche dichterische Freiheit! Ich habe lange geübt, bevor ich zum Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller geworden bin, habe ‒ hey! ‒ in Fabriken gearbeitet und nach der Arbeit daheim am Küchentisch in der Wohnküche geschrieben. Schnauze und Maul! Sozialwohnung, Innentoilette, kein Bad, kein Vater, kein Arsch: Arbeiterdichterbehausung für Fürsorgeempfänger! (…) Auf der Straße schnorrte ich Geld für Bier, und trotz allem war es nie genug für den Tod, den jungen, harmlosen Tod. Die Banalität der Revolte. Später dichtete man Oden auf die Revolution, die nie stattfand. Später ging es einem einfach schon zu gut, denn schließlich hatte man überlebt ‒ und nicht nur sich selbst, hatte gearbeitet, während andere Bücher voller Gedichte schrieben und den Klugscheiß ihrer Professoren verklärten. Natürlich war es gar nicht so, sondern viel schlimmer. Lieber Ludwig, das ist furchtbar eklig, was du da so absonderst, findest du nicht? Warum bloß schreibst du so etwas? Anders gesagt: Warum schreibst du so etwas einfach erst gar nicht? Halt den Mund im Kopf: Vorschlag! Das Herz ist ein vorlauter Körperteil. Es behauptet Liebe, wo nichts ist.« Herrlich!
Nüchtern bleibt man jedenfalls nicht, wenn man nur anfängt, die 111 Seiten zu lesen, wobei es eben nicht so sehr um den Bierrausch, von dem sich Fels in seinem Manuskript auf den ersten Blick tragen lässt, geht, sondern um den Rausch der Dichtung und Freiheit. Das ist das wichtigste Atout von »Ein Sonntag mit mir und Bier …« ‒ es ist ein lyrischer Rausch der Einsamkeit und Verletztheit, die man normalerweise nie zeigt, obwohl man am liebsten, wie es Czesław Miłosz einmal sagte, auf die Straße laufen würde, um alles, was wehtut und ärgert, endlich herauszuschreien und um gegen die existenzielle Misere ‒ welcher Art auch immer, als Dichter begegnet man schon schnell einer ‒ zu protestieren.
Was passiert also in diesem angenehm verrückten Buch, dessen Sprache obendrein wunderbar wild ist und gnadenloser Bilder- und Metaphernstärke folgt? Oder besser gefragt: Mit was für einem Tier haben wir es hier zu tun?
Es ist ein Einakter und es schöpft damit aus der ältesten Quelle ‒ dem griechischen Drama. Ein Film wird nämlich über den Dichter Ludwig Fels im Biergarten gedreht, und ob das wirklich stimmt oder eher eine geschickte Legitimation für den langen Monolog eines alten fränkischen und mit allen Wassern gewaschenen Ziegenbocks ist, wissen wir nach der Lektüre immer noch nicht, denn vielleicht ist alles erstunken und erlogen, nie da gewesen, auch wenn die Figuren dieses Einaktermonologs tatsächlich existiert haben: »An deiner Stelle, sagt er, würde ich über Leute schreiben, die wirklich gelebt haben. / Wer hat denn wirklich gelebt? Hast du wirklich gelebt? Sogar der liebe Gott klingt erfunden, wenn man ihn beschreibt«, heißt es in einem Gespräch mit Onkel Karl, den Fels im Biergarten trifft, obwohl der Onkel schon längst tot ist.
Wenn man so will, ist Felsʼ Buch eine Totenfeier in einem fränkischen Biergarten, und die Tragödie der menschlichen Existenz, die letztendlich nicht länger dauert als ein Wimpernschlag oder das Trinken von ein paar Maß Bier ‒ kosmisch betrachtet ‒, wird besonders dann sichtbar, wenn Fels über seine ungeborene Tochter schreibt, die ihn wie der Onkel Karl auch besucht. Natürlich ‒ was ist Dichtung, was ist Wahrheit, fragt man sich hier. Es könnte doch in der Tat sein, dass Fels uns an der Nase herumführt, zumal die Antworten der ungeborenen Tochter, die in einer Abtreibungsklinik irgendwo in einem hessischen Kaff ihr Dasein abrupt beenden musste, zum Nachdenken über die Kürze unseres Auftritts auf der irdischen Bühne zwingen.
Die Tochter ist immer noch da ‒ sie ist aus dem Gedächtnis der Eltern nie verschwunden; sie ist inzwischen ‒ während des Besuchs im Biergarten ‒ eine junge hübsche und selbstbewusste Frau, die die Angst ihrer Eltern verstehen will und nach Nähe und dem Leben als Mensch auf Erden Sehnsucht hat. Sie sagt zu ihrem Vater: »Aber weißt du, ich wollte auch einmal die Augen öffnen und Licht sehen, wollte auch einmal mit meiner Zunge spielen und wortlos singen und geliebt werden und getröstet sein und von Gott träumen und euch glücklich machen, Mama und dich.« Mehr Empathie und Trauer zugleich um den selbstverschuldeten Verlust kann man in so wenigen Zeilen eigentlich nicht unterbringen. Überhaupt hat das ganze posthum veröffentlichte Manuskript einen versteckten melancholischen Ton, der um die Verluste und Niederlagen kreist, mit denen man den Rest des Lebens zubringen muss. Das ist traurig und dennoch so wahr, so wirklichkeitsgetreu, wie es nur in der Dichtung möglich ist.
Zu diesem dramatischen Reigen der Verluste gehört auch der Vater, der unbekannte Soldat, der kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durchs Land gezogen war und, wie Fels gesteht, »eine Rast in Treuchtlingen einlegte, ob vor Erschöpfung oder Verliebtheit, da solle ich meine Mutter fragen, die ihre Röcke hochgehoben und ihre Hose heruntergelassen habe, das Fleisch jung und vom Land.«
Doch tun wir es nicht alle? Sprechen wir nicht alle gelegentlich mit längst Verstorbenen? Bekannten und unbekannten Toten? Ja, wir tun es alle. Der Diskurs mit ihnen, den Jenseitigen, dient doch der Pflege unserer psychischen Gesundheit und nicht nur dem Ritual des Gedenkens, weil es sich so gehört. Und Dichter, die sich in Gespräche mit den Toten nicht verwickeln lassen, können ihre Koffer packen und sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Denn wie schon Henri Bergson schrieb, lasse sich das menschliche Gedächtnis nicht auf bloße materielle, sprich neurologische Prozesse reduzieren. Der Dichter Ludwig Fels ist zwar seit 2021 tot, aber seine Teilnahme am Geist, der wie Bergson sagt, über das Zeitliche definiert werde und nicht über das Räumliche, macht ihn für uns alle gegenwärtig zugänglich, als weilte er immer noch unter uns Irdischen. Und damit ist er unsterblich. Die Unsterblichkeit des Gedächtnisses, dessen Ursprung der Geist sei, stehe aber jedem Menschen zur Verfügung, so Bergson. Und wenn Fels in seinem Biergarten mit der Geschichte und der Sprache und den Imponderabilien seines Egos herumfuchtelt und jongliert, ist der Eindruck, da spreche der menschliche Geist, der nicht sterben will, weil er das Sterben nicht kann – nicht versteht, unangefochten.
Man muss sich also bei dem Talent des Fels’schen Gedächtnisses nicht wundern, dass in seinem Buch ein ganzer Reigen von Toten auftritt, eben nicht nur aus der eigenen Familie und Verwandtschaft ‒ manchmal hat man den Eindruck, in dem fränkischen Biergarten finde die neutestamentarische Auferstehung der Toten statt. Es entsteht dann ein europäisches und historisches Panoramabild, wobei niemand vergessen wird, selbst der unbekannte Soldat und der namenlose Bauer werden berufen und marschieren vor dem Auge des Dichters wie auf einer Militärparade. Es sind seine Verbündeten, all die vergessenen Menschen, die doch gelebt, gewirkt und gearbeitet haben. Die Ahnen kommen, »ein stattlicher Haufen Vorfahren, die auf Wollhaarmammuts in die Fabriken ritten und sich von weichgekochten Kanonenkugeln ernährten. Büttel waren unter ihnen, welche die Holzstöße in Brand setzten und die Fackeln küßten. Sobald danach das Wehgeschrei begann. Kaufleute, die im Faulturm schmachteten, Bauernkrieger, Leibeigene, Verbündete meines Schicksals, die durch Traumlandschaften meiner Seele geistern.«
Schließlich: Es entsteht ein Panorama wie auf den Gemälden von Pieter Bruegel dem Älteren, und es ist doch nicht nur ein poetisches Buch mit einem dünnen roten Faden und einem vergnügten und mächtig angetrunkenen Dichter, der nach unzähligen Maß Bier den Mut findet, sich selbst ins Gesicht zu schauen und die Absurditäten des Literaturbetriebes und der Fabriken, in denen er geschuftet hat, offenzulegen ‒ es ist auch ein Dialog mit jedem Menschen, der jemals existiert hat; und ein Dialog mit den heute Lebenden und denjenigen, die noch kommen werden. Die Zeit steht nämlich in Felsʼ Biergarten still, der dreidimensionale Raum wird aufgelöst, und die Reise durch Jahrhunderte wie auch durch die dunkelsten Landschaften unserer Charaktere und Taten kann beginnen. Fels schreibt: »Können Sie sich Karl Marx am Kreuz vorstellen? Und links und rechts die Schächer Lenin und Stalin? Während Hitler wie der Apostel Petrus kopfunter gekreuzigt wurde?«
Denn Fels weiß eines: Irgendwann ist selbst eine persönliche Abrechnung ‒ aber eben nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den anderen Menschen ‒ bloß eine Abrechnung und nicht mehr; denn man ist trotzdem da, existiert für sich selbst für immer, auch wenn man schweigt, nichts mehr sagt. Und die Erinnerung lässt sich nicht ausschalten, das Gedächtnis, wie wir von Bergson gelernt haben, analysiert weiter das Vergangene und lässt uns mit dem Vergangenen allein. Wir müssen unsere Schlüsse ziehen und damit der Gegenwart begegnen. Ludwig Felsʼ posthumes Werk, die Rede eines Biergartenbesuchers am Sonntag, ist so ein Versuch, mag er auch scheitern, unsere Gegenwart erfassbar und verständlich zu machen. Na ja, wer hätte das gedacht, dass Dichtung, die oft mit dem Irrationalen in Verbindung gebracht wird, so rational über die dialektische Kondition des menschlichen Daseins sprechen kann. Das kann sie, wenn sie sich so einer Stimme wie derjenigen von Ludwig Fels bedienen kann: Er war ein geniales Sprachrohr dafür.
Vielleicht auch deshalb, weil er ein Arbeiter war, der geschrieben hat. Antiintellektuell auftretend konnte er intellektuell wirken. Seine dialektische Haltung erinnert mich an ein philosophisches Oxymoron von Simone Weil, die sagte, nur ein Atheist könne Gott verstehen. Da ist was dran. Denn ich denke, dass Fels mehr vom Kosmologischen und Existenziellen verstanden hat, als so manche Dichter, denen hochgradige anerkennende Zeugnisse ausgestellt wurden, aus denen eindeutig hervorgeht, dass sie das Geheimnis unserer Existenz exzellent beschrieben hätten. Von wegen! Lest einfach Fels, der ein Fels in der dichterischen Brandung ist.
Hotel Libertine, Frankfurt am Main, 2.-3. September 2025
Letzte Änderung: 07.09.2025 | Erstellt am: 06.09.2025
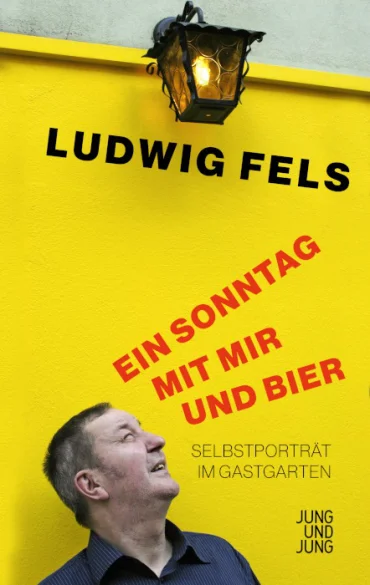
Ludwig Fels Ein Sonntag mit mir und Bier. Selbstporträt im Gastgarten
Erscheinungsjahr: 2025
128 Seiten, gebunden
Auch als E-Book erhältlich
WG 1112
ISBN 978 3 99027 414 9
Preis: € 20,– | sFr 28,–
Erschienen am 23.01.2025


