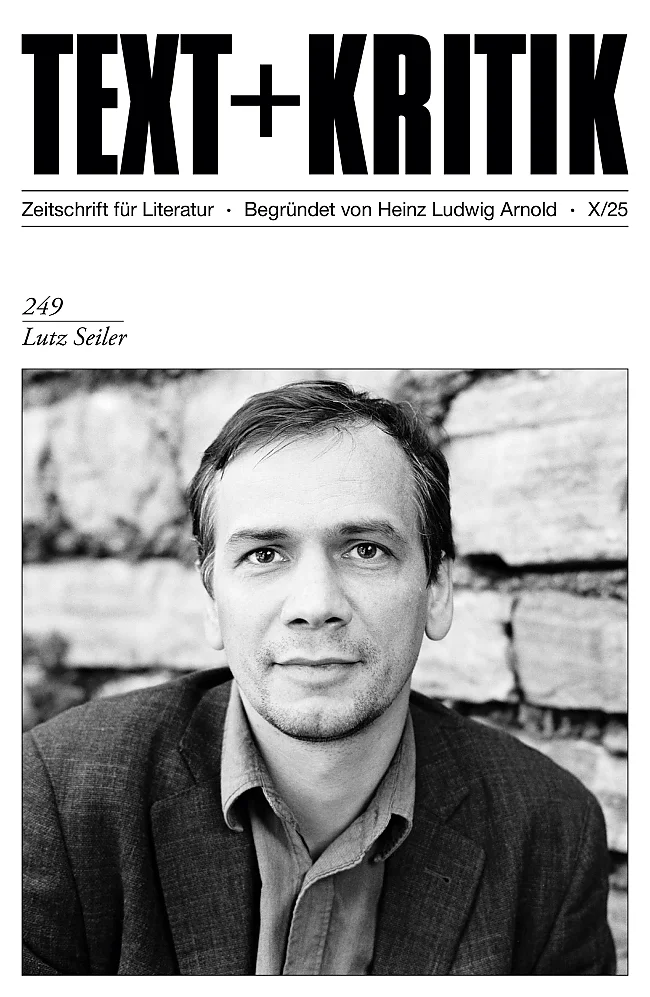
Wie schreibt man über einen Autor, dessen poetisches Werk zwischen den Trümmern des Ostens und der Sehnsucht nach Transzendenz oszilliert? Artur Becker nähert sich dem neuen TEXT+KRITIK-Heft Nr. 249 über Lutz Seiler mit persönlichem Rückblick, politischer Schärfe und literarischer Leidenschaft – und beleuchtet dabei einen Dichter, der die seelischen Narben Ostdeutschlands in Sprache fasst.
Im Frühjahr 2005 war ich Stipendiat in der Casa Baldi in Olevano Romano, die eine Art Landhaus der in Rom ansässigen Villa Massimo ist. Und eines Abends saß ich in meinem Apartment zusammen mit den beiden ostdeutschen Dichtern Thomas Rosenlöcher (seligen Angedenkens) und Gerald Zschorsch, und der Cesanese vom dörflichen Weinhändler und Winzer Ernesto floss in Strömen. Zschorsch, den ich bereits 1998 in der Villa Decius in Krakau kennenlernte, war bei mir zu Besuch, Rosenlöcher, der es bedauerte, nicht in der Villa Massimo residieren zu dürfen, hatte wie ich das Stipendium in der Casa Baldi bekommen, und wir gingen uns auf dem Berg, von dem aus man das wunderschöne und in der Tat romantisch verträumte Dorf der »Nazarener« überblickte, freundlich aus dem Weg ‒ bis auf diesen einen Abend.
Nach einigen Gläsern des schwarzroten Cesanese, der ein kräftiger Bursche und zugleich genauso abwechslungsreich ist wie die in felsige Hügelstreifen geschnittene Landschaft in Latium, kamen wir dann auch auf die Solidarność und den Streik in der Danziger Werft im August 1980 zu sprechen. Rosenlöcher beteuerte, er und seine Landsleute in der DDR hätten damals während des Streiks in der Danziger Werft zusammen mit uns Polen mitgefiebert und uns die Daumen gedrückt: Sie seien mit uns auch solidarisch gewesen, indem sie jeden Abend Nachrichten des Westfernsehens gesehen hätten … Zschorsch sagte: »Oh Gott!«, konnte er doch über diese Art von Solidarität nur lachen … Er hat ja als junger Mann auch in Bautzen eine lange Strafe abgesessen, bevor er Mitte der Siebziger von der BRD freigekauft wurde.
1980 war Zschorsch Stipendiat der Villa Massimo in Rom gewesen, wo er Thomas Brasch abgelöst hatte. Rudi Dutschke schrieb zu Zschorschs erstem Buch Glaub bloß nicht, dass ich traurig bin: Prosa, Lieder, Gedichte ein Begleitwort. Zschorsch, ein Dichter aus Plauen, war nicht der Einzige, der wegen seiner Kritik am DDR-Regime ins Gefängnis gehen musste; Utz Rachowski oder Jürgen Fuchs kommen wie Zschorsch auch aus dem Vogtland, und auch sie hatten einen hohen Preis für ihre dissidentische Haltung und Arbeit zahlen müssen. Zschorsch büßte vor allem seine Gesundheit ein. Die psychische Folter im Gefängnis hinterließ bei ihm bleibende Spuren ‒ zumal er nie ein einfacher Zeitgenosse gewesen war. Heute lebt er in einem Altersheim und meidet die Öffentlichkeit.
Die DDR war ein moralisch und politisch korrupter Staat, der großes Leid über seine Bevölkerung brachte und der bei Millionen von Menschen bleibende psychische Schäden herbeigeführt hatte; das DDR-Regime war besonders gnadenlos, ganz wie in den stalinistischen Zeiten der Sowjetunion oder in der Volksrepublik Polen während jener dunklen Epoche des Terrors. Und wie ahistorisch und gefährlich Erich Honecker denken und agieren konnte, beweist sein Vorschlag, den er unter den sowjetischen Genossen ausbreitete: Honecker wollte in Polen mit seiner Armee einmarschieren und General Wojciech Jaruzelski, der am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht in seiner Heimat ausgerufen hatte, in dieser schweren Stunde beistehen. Eine absurde Idee, denn deutsche Soldaten in deutschen Panzern auf polnischen Straßen ließen meine Landsleute sofort an den 1. September 1939 denken. Es hätte ein Blutbad gegeben.
Was konnte man also als Individuum in einem aggressiven und seine eigenen Bürger mordenden Staat tun, um sein wahres Gesicht und seine ethische Identität nicht zu verlieren? Czesław Miłosz beschrieb in seinem Essay Verführtes Denken (1953) die Leiden der polnischen Dichter und Intellektuellen, die verschiedene Methoden entwickelten, um vor der grausigen Wirklichkeit des kommunistischen Regimealttags zu fliehen. Die Rolle des »Ketman« war damals sehr beliebt, grob gesagt: Man tat so, als wäre man Eingeweihter und unterstützte die historische Rolle der Partei ‒ im »Neuen Glauben«, der den »Neuen Menschen« schaffen sollte. Innerlich lebte man aber in einer Welt, die nicht bloß privat und utopisch war, sondern die wahre Welt – eine Welt, die vor der Partei und ihrem »Neuen Glauben« versteckt werden musste. Würde sie von der großen Partei entdeckt werden, wäre man sofort gefährdet … Es ist daher historisch und psychologisch betrachtet nicht stimmig, was man in Deutschland über die sogenannte »Friedliche Revolution« von 1989 erzählt ‒ sie war nicht friedlich, viele Menschen haben, eben auch in den benachbarten sozialistischen Ländern, den Kampf für die Freiheit mit ihrem Leben bezahlt, damit die Mauer irgendwann endlich fallen konnte.
Und an all die Opfer und zerstörten Leben, auch wenn die literarischen Karrieren groß und international erfolgreich waren, wie das im Falle von Czesław Miłosz war, musste ich denken, als ich das neue, dem Dichter, Prosaisten und Essayisten Lutz Seiler gewidmete Heft TEXT+KRITIK Nr. 249 las. Sicher, das Heft enthält hervorragende Beiträge zu Seilers Lyrik und Romanen, und wer diese Literatur noch nicht kennt, müsste nach der Lektüre dieses Hefts eigentlich bestens vorbereitet sein, um sich in die wunderbaren Gedichte und Romane Seilers zu vertiefen und womöglich sein treuer Leser werden zu können.
Aber man fragt sich, während man die poetologischen Deutungen und Erklärungen in den zahlreichen Essays über Seilers Werk liest, warum sie so »abgehoben« scheinen, beziehungsweise so ätherisch ‒ im Hintergrund des sozialistischen Alltags wirkte doch eine gnadenlose Kraft, die die Menschen in der DDR zu Handlangern, Zombies und Krüppeln machte, und manche Dichter mussten ins Gefängnis und später von der BRD »übernommen werden« wie Jürgen Fuchs zum Beispiel. Andere wiederum spielten die Rolle des »Ketman« hervorragend und flüchteten in künstliche Welten, die eben auch von Lutz Seiler beschrieben wurden. Doch ringsherum war alles »verstrahlt« und unerträglich ‒ es handelte sich um eine Wirklichkeit, die einem aufgezwungen wurde wie eine Uniform in der Armee.
Es ist daher, bedenkt man noch einmal, mit was für Regimen man auf Seiten des Warschauer Paktes und im Kalten Krieg zu tun hatte, hochinteressant, wie »ostdeutsche« Intellektuelle mit ihrer Vergangenheit umgehen, zumal sie in einem xenophobischen Staat lebten, der einen sozialistischen Staat behauptete, de facto aber einen faschistoiden und nationalistischen Staat kreierte und am Leben erhielt.
Seiler wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, die Debatte über sogenannte »ostdeutsche« Literatur und die »Normal Null« stets in eine Richtung, manichäisch quasi, laufen zu lassen: hier der Osten, bedürftig und irgendwie unreif, und dort der Westen, der angeblich »normale« Teil Deutschlands. Seiler sagt in einem Interview, das Bernard Banoun im Sommer 2024 mit dem in Stockholm und in Deutschland lebenden Dichter geführt hat: »Ich verstehe gut, dass die im Osten geborenen Autorinnen und Autoren sich gegen den Fortbestand dieser provinzialisierenden Markierung wehren, weil sie bestimmte Vorannahmen assoziiert, nicht nur zur Beschaffenheit von Texten, Inhalten und Ästhetiken. Verstärkt wird das Unbehagen von der Tatsache, dass es gleichzeitig keine vergleichbar intensiv markierte Befragung westdeutscher Herkünfte und ihrer Folgen, insbesondere unter dem Vorzeichen ›westdeutsch‹ gibt, da diese als vergleichsweise ›normal‹ gesetzt sind, der Westen ist ›Normal Null‹, wie es der Sprachwissenschaftler Kersten Sven Roth einmal ausgedrückt hat. Der Osten hingegen ist das weiterhin Abweichende, Erklärungsbedürftige. Die Asymmetrie ist offenkundig und darüber zu sprechen, bewirkt vermutlich nicht viel, im Gegenteil: Am Ende verlängert es nur diesen inzwischen schon reichlich ausgewalzten Diskurs. Christoph Dieckmann hat einmal dafür plädiert, beide Termini, ›DDR-Literatur‹ und ›BRD-Literatur‹, mit der Zäsur von 1990 fallen zu lassen. Erstens, weil sie hässlich sind, zweitens, weil sie die Gefahr einer Fehldeutung enthalten und drittens, weil sie asymmetrisch verwendet werden.«
In Seilers Roman Stern 111 kommt es zu einer existenziellen Zuspitzung dieser Ost-West-Problematik, denn die Eltern des Hauptprotagonisten Carl Bischoff aus Gera, der seinen inneren »Ketman«, seine geistige Flucht nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Wirklichkeit, im postsozialistischen Berlin ausleben konnte, wissen längst, dass sie in »Westdeutschland« nicht glücklich werden können. Dirk Ochsmann schreibt dazu in seinem hervorragenden Beitrag »California Dreaming. Vom Erzählen der Eltern in Lutz Seilers ›Stern 111‹«: »Denn in Westdeutschland, gleich ob die Orte nun Gießen, Gelnhausen oder anders heißen, wird ihnen als Ostdeutschen das Gefühl vermittelt, ›aus einem für immer verlorenen Krieg‹ zu kommen (94), ›aus der Wildnis‹ (211), nichts zu können, faul und nichts wert zu sein (370 f.). Das ›Stigma ihrer östlichen Herkunft‹ (101), äußerlich sofort erkennbar am ›unheilbar[en]‹ Dialekt (170), führt zu einer ganzen Kette an Demütigungen. Sie werden als ›Ost-Schweine‹ bezeichnet (164) und in einer Form des strukturellen Rassismus wie Sklaven behandelt, insbesondere der Vater: ›Das erste Mal in seinem Leben hätte er es auf diese Weise gespürt, dabei sei ihm plötzlich das alte Wort vom Massa in den Sinn gekommen. ›Jedenfalls habe ich schwarzgesehen für unsere Zukunft und dann, für einen Moment, habe ich mich selbst schwarz gesehen, schwarz und angegraut und einfach zu alt für einen brauchbaren Sklaven, mit über fünfzig Jahren.‹ (161)«
Dass nach 1989 für viele Ostdeutsche, aber auch Polen, Tschechen, Ungarn und so weiter das Leben in der neuen, weil kapitalistischen Wirklichkeit nur noch wenig zu bieten hatte, ist das andere Gesicht der Weltgeschichte, die nicht nur von autoritären Regimen vorangetrieben wird. Das Aussortieren von Generationen und das Verschwinden (der Dinge, ja ganzer Dörfer, zum Beispiel Culmitzsch, wo Uranabbau betrieben wurde und wo Seiler aufwuchs) scheinen, glaubt man den kritischen Beiträgen des neuen TEXT+KRITIK-Heftes aufs Wort, ein großes Thema der Literatur Seilers zu sein. Hier, im Kontext des Verschwindens und Vergehens der Tage und Werke, ist Seiler ‒ in meiner referenziellen Vorstellung von Literatur ‒ mehr ein europäischer bzw. polnischer Autor, wie zum Beispiel der von ihm gern zitierte Adam Zagajewski. Denn die Frage muss für einen Dichter lauten: Wie beschreibe ich die Wirklichkeit, wie begegne ich ihr, wenn sie sich ontologisch, physikalisch und historisch in erster Linie als eine Geisel der Vergangenheit entpuppt? Seiler bricht aus diesem in der Tat ermüdenden, wenn auch ethisch und historisch richtigen Diskurs der Ost-West-Problematik aus und steht dadurch einem Miłosz oder Zagajewski näher als manch einem seiner deutschen Lieblingsdichter. Aber das, was für andere Dichter Muttermilch ist, kann für einen deutschen Autor sogar Gift sein. Ostdeutschland hat im 20. Jahrhundert eine dreifache Katastrophe erlebt: den Nationalsozialismus, den Kommunismus und dann die sogenannte »Friedliche Revolution«, die eben keine friedliche war. Millionen von Menschen lebten somit in einer Lüge, manche leben in dieser bis heute (siehe die AfD-Faszination), und hier muss ich sofort an Theodor Wiesengrund Adornos gnadenlosen Spruch aus dessen Werk Minima Moralia (1944-1947) denken und ihn zitieren: »Es gibt kein richtiges Leben im falschen.«
Hervorzuheben sind, wobei wirklich alle Beiträge dieses Seiler-Heftes eine hohe, zur Rezeption und zum Lesen der Werke von Seiler animierende Qualität haben, die Texte von Lothar Müller (»Der Trafo-Gott und das Ende des mechanischen Zeitalters. Über die Dinge, Geräte und Apparaturen in Lutz Seilers Lyrik und Prosa«) und Ilma Rakusa (»Im Kieferngewölbe. Lutz Seilers poetischer Wald«): Sie nähern sich dem Seiler’schen Werk vor allem poetologisch, aber sie tun es ohne den Impetus des Welterklärers und Dichterverstehers, sondern aus der Überzeugung heraus, dass Seilers Mythen aus der Kindheit, sein sakraler Umgang mit vergänglichen Gebrauchsgegenständen des Alltags, seine ambivalente Einstellung zur Natur oder seine kritische Betrachtung des Fortschritts und unserer Zivilisation eine Synthese mit dem geschriebenen Wort bilden. Semiotik lässt hier grüßen, und Roland Barthes’ Mythen des Alltags werden einem buchstäblich aufs Auge gedrückt. Rakusa schreibt: »Für Seiler, der in seiner verschlungenen Berufskarriere auch als Handwerker tätig war, sind Werkzeuge mehr als ein leeres Wort. Nämlich Teil seiner ›Heimaten‹. (…) Fast überflüssig zu bemerken, dass Lutz Seilers Naturverbundenheit nichts Sentimentales (oder Romantisches) anhaftet. Natur wird bei ihm nicht verklärt, zu tief haben sich ihm die Uranhalden seiner Kindheit eingeprägt: eine versehrte, ja toxische Landschaft. Doch sein Blick liebt das Detail, den ›klee im gras, so kostbar, das staubtuch, das / aufs fensterblech schlägt‹, wie es im Gedicht ›müssen wir riesen verhungern?‹ heißt.«
Lothar Müller ist der einzige Kritiker im Seiler-Heft, der sich auf das dünne Eis der Metaphysik, der Religionen und der Transzendenz begibt, um eine ‒ zugegeben ‒ vorsichtige Interpretation der rhetorischen Bilder in Seilers Dichtung zu liefern; ein schwieriges Unterfangen, bedenkt man, dass das Christliche in der DDR durch einen »Neuen Glauben« ersetzt wurde, der den geistigen Fortschritt des Menschen und der Gesellschaft zu einem ideologischen Kampf machte. Gott beziehungsweise Transzendenz hatte da nichts zu suchen. Aber es ist bekannt, dass Poesie ohne Sakralität, Transzendenz und Mythos nicht auskommt ‒ das ist sozusagen ihre Hauptaufgabe, diese Epiphanie zu suchen, denn sie gibt der Welt ihr ontologisches Mysterium, das jedoch durch Religion, Philosophie, Wissenschaften oder Ideologien missbraucht wurde, zurück. Müller schreibt in seinem Essay: »Eines der berühmtesten Lenin-Zitate, gängige Münze in der Fortschrittsrhetorik der DDR, lautete: ›Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.‹ In Lutz Seilers Debütband ›berührt/geführt‹ (1995) war davon in den Schlusszeilen des Gedichtes ›Niemand sagte …‹ über die Kautschukproduktion nur eine Schwundstufe, ein Fragment geblieben: ›… in seiner eigenen Hütte / sklavenarbeit, klassenkampf / elektrifizierung / plus‹. Der sterbende Gleisarbeiter in ›Die Zeitwaage‹ lässt die heroischen Arbeiterfiguren des Sozialismus hinter sich. Er rückt ein in die Welt des Trafo-Gottes, der diesseitig-irdischen Transzendenz, der Koppelung der Arbeit und ihrer Werkzeuge mit den Energien religiös aufgeladener Sprache.«
Das Heft fängt übrigens mit einem Auszug aus Lutz Seilers neuem Romanmanuskript an, dem sogleich das Gespräch mit Bernard Banoun folgt ‒ für mich ist natürlich das Spannendste und Wichtigste, was Seiler als Schriftsteller zu seinem eigenen Handwerk zu sagen hat. Ich stelle mir vor, nachdem ich einiges durchaus Wertvolles und Affirmierendes zu dieser Thematik in TEXT+KRITIK erfahren habe ‒ auch eben aus erster Hand natürlich ‒, wie der »Maestro« im »Kieferngewölbe« die Rinde von den Bäumen abschabt, sie trocknet und immer wieder nach den schönsten Exemplaren sucht, um ein kleines Rimbaud’sches Schiff zu schnitzen oder vielleicht ein paar Zeilen niederzuschreiben, die er dann immer wieder laut vorliest, um den Rhythmus und zugleich den Inhalt einer Prüfung zu unterziehen. Eine faszinierende Methode, für die man sehr viel Ruhe braucht, auch in Stockholm.
Das Autorenfoto des Frankfurter Fotografen Jürgen Bauer auf dem Cover des Seiler-Heftes entstand in Cadenabbia, wo es über viele Jahre die Textwerkstatt der Konrad-Adenauer-Stiftung gegeben hat, zu der Autoren der deutschsprachigen Literatur eingeladen wurden, um ihre neuesten Manuskripte vorzustellen und in der Werkstatt zu diskutieren. Die im Mai dieses Jahres verstorbene Germanistin Prof. Birgit Lermen war Begründerin und Spiritus Rector der Literaturwerkstatt. Jürgen Bauer war oft dabei, und nicht selten fragte ihn die resolute und äußerst sympathische Birgit Lermen, eine ältere Dame, die stets mit ihrem eigenen Nackenkissen nach Cadenabbia reiste, wer nun in diesem Jahr seiner Meinung nach für den Konrad-Adenauer-Literaturpreis in Frage käme. Sieht Seiler auf dem Foto des Frankfurter Fotografen wie der ewige Literaturpreisträger aus, dessen literarischen Abenteuer tatsächlich in Stockholm enden könnten? Nein, auf dem Foto sehen wir einen zuversichtlich blickenden Mann mittleren Alters, der genauso gut als Handwerker in einem Magazin für Bauunternehmer und Architekten porträtiert werden könnte. Bauer hat es wieder einmal geschafft, einen Autor in seiner ganzen Ambivalenz und Mysteriösität einzufangen.
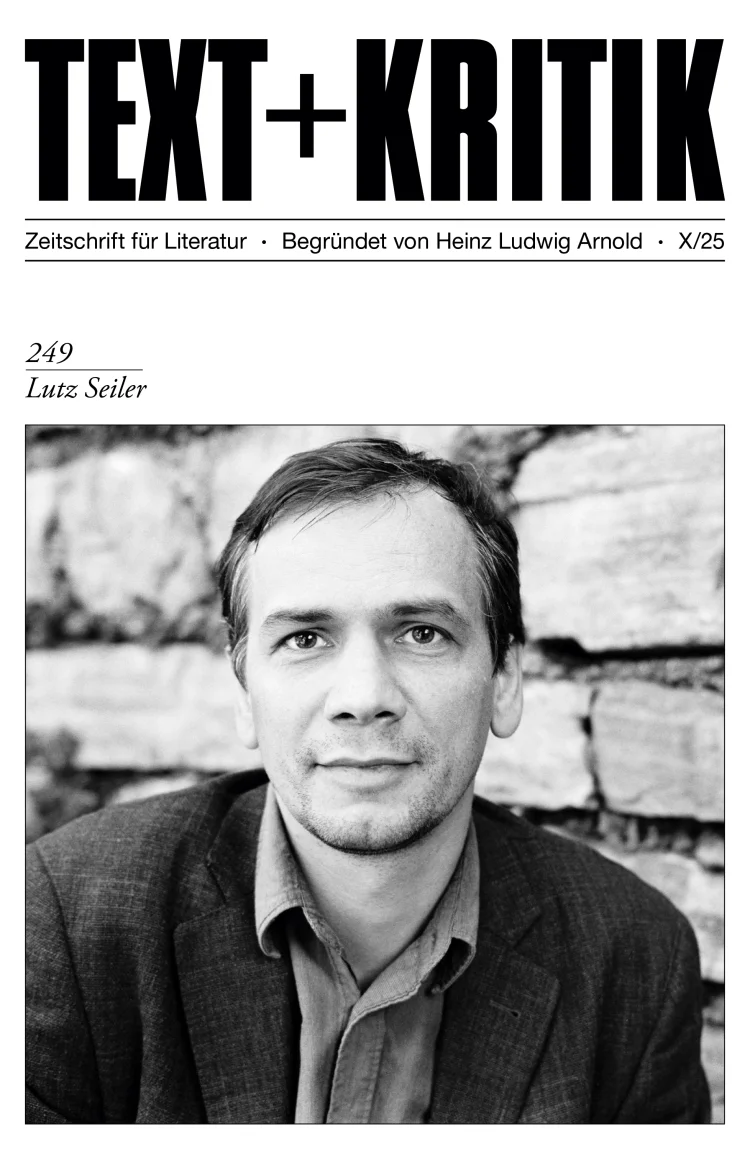
2025, 103 S., 1. Auflage
ISBN 978-3-689-30122-4
TEXT+KRITIK
Begründet von Heinz Ludwig Arnold
Herausgegeben von Meike Feßmann, Axel Ruckaberle, Michael Scheffel und Peer Trilcke
Leitung der Redaktion: Claudia Stockinger und Steffen Martus
Bernard Banoun / Carola Hähnel-Mesnard (Hg.)
Heft 249
Lutz Seiler
Letzte Änderung: 08.08.2025 | Erstellt am: 08.08.2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


