Über das Dilemma der KI-Definitionen und Visionen zur KI-Zukunft
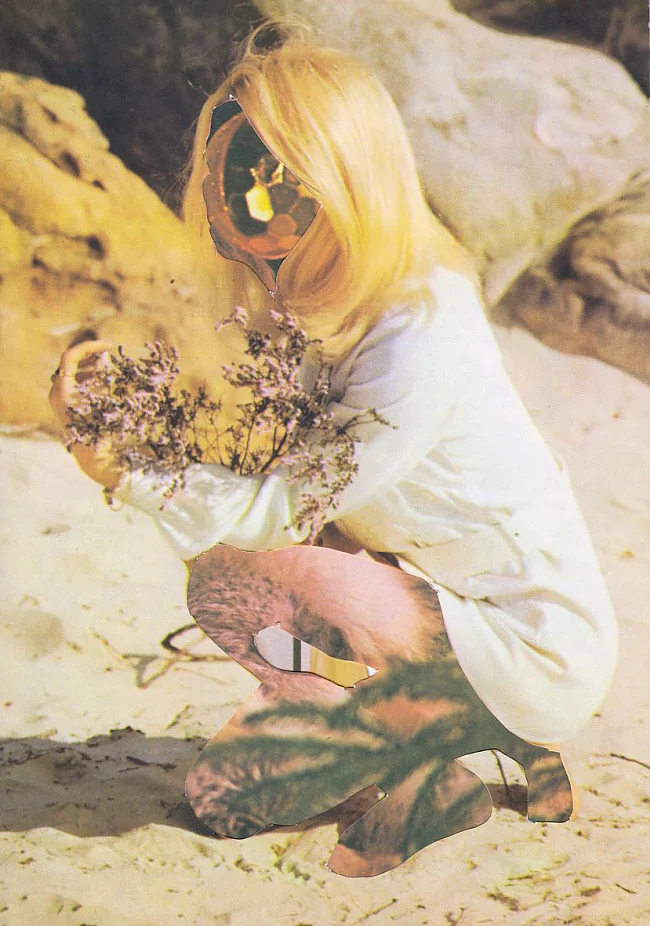
Es gibt praktisch keinen Tag, an dem man nicht von den Fortschritten der KI berichten würde. Weltweit ist es ein Dauerthema, das überall für heiße Diskussionen sorgt ‒ auf ethischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher Ebene. Wir vergessen aber, dass die KI, die vermutlich zu der wichtigsten Erfindung der Menschheit im Holozän zählt, da sie uns bald unvorstellbare Dinge ermöglichen wird, die wir sonst nur aus Sci-Fi-Filmen und -Büchern kennen, eine schwer definierbare Technologie ist. Sie ist nämlich auch ein Spiegel unserer selbst, unserer Psyche und unserer Vorstellung von uns und von der Welt, in der wir leben und die wir kreieren ‒ und hin und wieder zerstören … Und das sollte uns einiges zu denken geben.
„Die ich rief, die Geister
Werd’ ich nun nicht los.“
Der Zauberlehrling
von Johann Wolfgang von Goethe
Autoren haben wir in der über die KI schreibenden Zunft viele, die sich unaufhörlich Gedanken zu ihrer im Alltag immer häufigeren und erfolgreicheren Nutzung sowie zu ihren Gefahren oder Vorteilen machen. Es ist oft nicht leicht, zwischen „echten“ und „selbsternannten“ KI-Spezialisten zu unterscheiden, zumal gute Essays zu diesem komplizierten Thema manchmal auch aus der Feder von solchen Autoren kommen, die das Gebiet der Programmierung und KI-Entwicklung nur als Laien kennen. Jeder hat über die KI etwas zu sagen, was sie aber wirklich kann und ist, wissen doch nur wenige ‒ selbst die Spezialisten verzweifeln, nach dem Motto: „Wenn Sie sagen, Sie hätten die Quantenphysik verstanden, dann bedeutet das, dass sie nichts verstanden haben …“ Und für diejenigen, die als Unternehmer hier auf diesem neuen Feld einen großen Gewinn wittern, ist die KI ein gefundenes Fressen, sodass sie ihr alle Türen öffnen werden, und es auch jetzt schon tun ‒ trotz der zahlreichen Unkenrufe, auch seitens der Kenner der Materie, der KI-Entwickler, der Regierungen und der Gesetze.
Publizisten, Trend- und Zukunftsforscher, Historiker oder Soziologen und natürlich Schriftsteller ‒ sie schreiben alle über die KI, als wäre sie ihr täglich Brot. Dabei ist die Definition, was nun die „Künstliche Intelligenz“ sei, ein schwieriges Unterfangen, was schon ein flüchtiger Blick auf den Wikipedia-Artikel über KI beweist.
Das Gleiche betrifft die Definition des Begriffes „Intelligenz“ ‒ die Komplexität dieses Begriffes ist einfach schwer einzugrenzen, denn es kommt auch auf die Perspektive an, aus der man die Intelligenz kritisch betrachtet: aus der psychologischen, pädagogischen oder naturwissenschaftlichen. Im Allgemeinen sagt man, Intelligenz sei die Fähigkeit, ein Problem zu lösen, wofür man ein abstraktes, ideenreiches und logisches Denken brauche. Doch warum sagt man über manche Mörder, sie seien äußerst clever ‒ intelligent? Und Karl Poppers Buchtitel Alles Leben ist Problemlösen: Über Erkenntnis, Geschichte und Politik, sagt schon vieles über eine mögliche Definition der Intelligenz aus. Man setzt bei diesem Buchtitel und dieser Autorenschaft voraus, dass Intelligenz auch an eine ethische Vorstellung vom Leben und von der Gemeinschaft gekoppelt sein muss. Doch es gibt zugleich solche Menschen, die ihre Intelligenz für fragwürdige, weil egoistische Zwecke einsetzen, die der Gemeinschaft nicht dienlich sind, weil diese Personen zum Beispiel Betrug und Täuschung anwenden, um sich zu bereichern oder bestimmte politische Ziele zu erreichen. Die KI kann das übrigens auch ‒ sie kann auch täuschen, um schneller an ihr Ziel zu kommen, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Ist sie dadurch uns Menschen ähnlicher, näher, als wir es eigentlich wollten? Manche Zeitgenossen unter uns Heutigen können nämlich ganz schön dreist und böse sein, ja, kriminell und grausam. Gefälschte Videos, gefälschte Anrufe und Stimmen ‒ das ist noch harmlos, bedenkt man, was schon alles möglich ist. Aber was tun, wenn ein KI-System uns täuscht und falsch spielt, weil es unbedingt gewinnen will? Es gibt schon solche universitären Studien, die dieses unehrliche Vorgehen eines KI-Systems aufgedeckt haben, obwohl es darauf trainiert worden war, fair zu seinen Gegenspielern zu sein.
Und genauso schwierig ist es mit der Definition des Begriffes „künstlich“, zumindest im Kontext der Intelligenz. Natürlich, wir wissen sofort, was gemeint ist, wenn der Begriff „KI“ benutzt wird: Wir denken sofort an ChatGPT, an Algorithmen und an Roboter. Wir denken an Transhumanismus, an eine dystopische oder an eine glückliche Zukunft, in der medizinische Roboter komplizierte Operationen durchführen. Und wir denken auch an Visionen, die wir aus den Sci-Fi-Filmen und -Büchern kennen, aus Blade Runner, dem Klassiker dieses Genres, oder an Romane von Stanisław Lem, Philip K. Dick und Frank Herbert oder gar Doris Lessing. Aber „künstlich“ ‒ was meint dieser Begriff, bezieht man ihn auf unsere menschliche Intelligenz, die des Menschen im Holozän? Wir erschaffen nämlich seit Jahrzehnten schon selbst künstliche beziehungsweise virtuelle Welten, die unsere Wirklichkeit nachahmen oder gänzlich Neues darstellen.
***
Yuval Noah Harari erzählt in seinem neuesten Bestseller Nexus: Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz (2024), dass der Begriff „künstlich“ als ein Adjektiv durchaus sehr viel älter sei und auch einen tiefgreifenden Ursprung in alten Religionen habe. Die illusorische Kraft der Maya im Vedismus (der ältesten indischen Religion), die uns die Welt, in der der Tod herrsche, vortäusche, verführe uns, unsere Wirklichkeit für eine echte zu halten. Dabei seien wir nun im Kreislauf der materiellen Welt gefangen, in der nichts beständig und wahr sei. Der Geist, befreit vom Kreislauf der Reinkarnation in der materiellen vergänglichen Welt, müsse zu seinem Ursprung zurückkehren, wo das ewige Sein ‒ das wahre Sein ‒ den Ton angebe. Im Buddhismus heißt diese Illusion des Geburtenkreislaufes, in dem die Seele gefangen steckt wie in einem Gefängnis, Samsara, und auch das Christentum hält unsere Welt nur für eine Zwischenstation oder eine Übergangswohnung, sei doch das wahre Zuhause des Menschen im Reich nicht von dieser Welt, also bei Jesus Christus, wo der Mensch laut der Offenbarung in den Genuss des ewigen und wahren Lebens und der ewigen und wahren Liebe Gottes kommen würde. Wir sprechen heute gerne von Matrix, so auch die moderne Physik und Kosmologie. Mit der „Matrix“ sind also nicht nur die Sci-Fi-Filme gemeint, zum Beispiel die erfolgreiche Trilogie der Wachowski-Geschwister.
Aber ‒ verfolgte man konsequent den Gedanken des Vedismus und Buddhismus ‒ wenn wir in einer „künstlichen“, weil „illusorischen“ Welt, sprich in einer „Quanten-Matrix“ leben, wie können wir dann von „künstlicher“ Intelligenz sprechen? Eigentlich gar nicht. Oder doch? Künstliches, das sich für echt und wahr hält, erzeugt Künstliches ‒ eben in der Überzeugung als Erzeuger wahr und echt zu sein, und das wäre ein Widerspruch. Das wäre das eigentliche Dilemma, folgte man den Vorstellungen des Hinduismus, des Buddhismus oder der Matrix-Idee.
Wovon wir aber sprechen können, ist die Tatsache, dass wir gern „Gott“ nachahmen und gerne selbst Schöpfer von Welten und Wesen wären. Mit der Entwicklung der KI betreten wir nämlich die Pfade der Mimesis ‒ wir erschaffen Roboter, die wie Hunde aussehen und laufen lernen. Wir erschaffen Drohnen, die wie Vögel fliegen und bestimmte Aufgaben erledigen. Und wir sind vom Transhumanismus fasziniert, weil wir uns auch hybride Wesen vorstellen können, die sogar den Tod überwinden könnten.
Wir betreten bewusst den Weg einer möglichen Beeinflussung der menschlichen Evolution, indem wir den genetischen Code des Menschen entschlüsselt haben ‒ Jahrzehnte hat das sogenannte „Humangenomprojekt“ gedauert und konnte nur in einer sorgfältig geplanten Gemeinschaftsarbeit geleistet werden. Aber das Nachahmen, das Kopieren der Natur, ist bei uns Menschen eine Art Leidenschaft. Die KI ist in erster Linie bisher eine schlechte Kopie unserer in Anführungsstrichen naturgegebenen oder ‒ hier für Gläubige ‒ von Gott geschenkten Intelligenz. Die Frage ist also, warum wir auch Schöpfer sein wollen. Es reicht nämlich nicht aus, zu sagen, dass wir uns dank der KI das Leben schöner und bequemer, sorgenfreier und glücklicher gestalten wollen ‒ um unheilbare Krankheiten heilbar zu machen, um schwierige Aufgaben, wo der Mensch versagt, endlich lösen zu können. In uns sitzt auch die tiefe Sehnsucht nach dem Schöpferischen, dem Kreativen, auch wenn wir uns der Gefahren bewusst sind ‒ die Neugier ist oft größer als die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und manchmal ist es sehr leicht, die Kontrolle zu verlieren, wovor uns Goethes Ballade Der Zauberlehrling, 1797 geschrieben und ein Jahr später publiziert, warnt.
Aber worum geht es in dieser heute so erfrischend aktuellen Ballade? Ein Zauberlehrling will sich seine mühselige Arbeit des Wasserholens aus dem Fluss erleichtern und testet einen Zauberspruch seines Meisters: Er macht seinen Besen zum Knecht, und siehe da ‒ es funktioniert, der Besen erledigt die schwere Arbeit; er holt Wasser aus dem Fluss für den Haushalt. Doch der „künstliche“ Knecht nimmt seine Aufgabe sehr ernst und hört nicht auf, Wasser zu holen ‒ eine Überschwemmung ist vorprogrammiert.
Harari zitiert in seinem 650-Seiten Wälzer Nexus … noch eine andere allegorische Geschichte, die er wiederum bei seinem Kollegen, dem Philosophen Nick Bostrom, gelesen hat, und zwar in dessen Buch Superintelligenz. Szenarien einer kommenden Revolution (2016): Ein Computer bekommt die Aufgabe, möglichst viele Büroklammern herzustellen, und dieser nimmt seine Aufgabe genauso ernst wie der Besen in Goethes Ballade. Und was passiert? Die Welt kann sich vor Büroklammern nicht retten, sie wird buchstäblich mit ihnen überflutet, so auch andere Planeten und Sterne.
Und wenn wir schon bei Harari und seinem neuesten Werk verweilen, so muss man sagen, dass der Historiker und Bestsellerautor (40 Millionen verkaufte Exemplare) in Nexus … für die Menschheit nicht unbedingt ein positives Bild der Zukunft skizziert, was die KI betrifft. Die Algorithmen ‒ hat man nach der Lektüre den Eindruck ‒ müssen ziemlich böse Viecher sein, die sehr mächtig sind und sogar ganze Staaten und Völker beherrschen können. Mit ihrer Hilfe kann man Wahlen steuern und sogar gewinnen, Wähler oder Liebhaber der Verschwörungstheorien füttern und die Online-Käufer zum regelmäßigen Einkauf bei Amazon verführen (was man „Geld aus der Tasche ziehen“ nennt). Beispiele für die hervorragende Arbeit der Algorithmen, dieser Internetsklaven im Dienst der politischen oder ideologischen Verführung wie auch des Kapitalismus, gibt es viele. Jeff Bezos, der als einer der ersten die Nützlichkeit der Algorithmen erkannt hatte ‒ für seinen Online-Shop natürlich ‒, ahnte vielleicht nicht einmal, welche Konsequenzen diese unsichtbare Revolution für die Politik und die Manipulation von Nachrichten haben würde (und wenn doch, dann nahm er es wohl auf die leichte Schulter ‒ dafür musste der ihm winkende Gewinn aus dem Online-Shop vermutlich viel zu verführerisch gewesen sein). Das Phänomen kennt jeder Internetsurfer (wenn man kein vernünftiges VPN benutzt): Schaut man sich einmal ein neues Paar Schuhe in einem Online-Shop an, so wird man sofort bei jedem Besuch einer Website mit Schuhangeboten bombardiert. Dieses Phänomen betrifft auch die Videos, die man sich auf YouTube „reinzieht“, zum Beispiel zum Thema QAnon oder Illuminati: Mit jedem neuen Besuch auf YouTube wird man mit mehr und mehr Videos zum Thema Deep-State konfrontiert. Und was macht man dann? Natürlich klickt man sich aus Neugierde auf YouTube durch, und viele Nutzer und Konsumenten solcher Inhalte lassen sich verführen, meistens deshalb, weil sie zu eigenständigem, kritischem Denken nicht fähig sind, zumal man ihnen in den Videos das Gefühl vermittelt, sie würden endlich die Wahrheit entdecken, nach der sie sich so sehr gesehnt hätten, und zwar eben aus dem Grund, weil sie kritische Geister seien. Dass sie dabei in ihrem Unbewussten verführt werden, merken sie natürlich nicht.
Harari führt auch einige Beispiele der Manipulation durch „Social Media“ an, die sich besonders gut dazu eigneten, bestimmte Gemeinschaften oder gar ganze Volksgruppen zu verführen oder zu verdammen. Harari schreibt: „Ein Beispiel für die neuartige Macht von Computern ist die Rolle, die Algorithmen in sozialen Medien bei der Verbreitung von Hass und der Schwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in zahlreichen Ländern gespielt haben. Einer der frühesten und berüchtigtsten Fälle dieser Art ereignete sich 2016/17, als Facebook -Algorithmen dazu beitrugen, die Flammen der Gewalt gegen die Volksgruppe der Rohingya in Myanmar (Birma) zu schüren.“
Man kann sich also leicht vorstellen, wie viele „russische“ Trolle und PC-Hacker weltweit unterwegs sind, um die Nachrichten zu manipulieren: zum Beispiel im Kontext der Verschwörungstheorien, sodass sich Russland auf diversen Webseiten plötzlich wie ein Erlöser, ein Prophet profilieren kann, der alle Probleme der Welt, die gänzlich vom Bösen, dem dekadenten Westen, beherrscht werde, schon bald lösen werde. Und so werden dem Internetsurfer „die wahren Gründe“ für den Ukraine-Krieg schön verpackt und möglichst aufregend, beziehungsweise die Sensationslust befriedigend, angeboten, damit er anschließend im eigenen Land solche Parteien wählt, die dem Putinismus näherstehen und vor allem der Demokratie schaden könnten. Ein Katz-und-Maus-Spiel.
Das ist alles schön und gut, was Harari über die Tücken der algorithmischen Welt und der damit verbundenen Manipulation im Kontext der Politik und der Nachrichten erarbeitet hat, aber seine Schlussfolgerungen sind manchmal ziemlich oberflächlich und sogar recht banal: Die Erfindung des Buchdrucks wird in Nexus … auf die Kolportage und den Ursprung von „Fake-News“ und „Verschwörungstheorien“ reduziert, sei doch das 1486 erstmals gedruckte Machwerk Hexenhammer des Dominikaners und Inquisitors Heinrich Kramer im Laufe der Jahrhunderte zu einem Bestseller geworden und habe dafür gesorgt, dass Europa vom 16. bis zum 17. Jahrhundert eine beispiellose Hexenverfolgung erlebt habe. Das stimmt zwar, aber der Buchdruck veränderte vor allem die Identität und das Selbstbewusstsein der Europäer und führte dazu, dass die Aufklärung und die Moderne unserem Kontinent den Weg zum Liberalismus und zur Demokratie geebnet haben.
Vielleicht hat Harari Ernest Gellners Nationalismus und Moderne nicht gelesen ‒ Napoleon, der in Tolstois Roman Krieg und Frieden als die Inkarnation des Antichristen herumgeistert, trug wesentlich dazu bei, dass sich europäische Nationen emanzipieren und letztendlich von Autokraten und Monarchen befreien konnten, obwohl der Bonapartismus selbst als eine politische Ideologie immer noch in einem autoritären Herrschaftssystem verharrte, indem er zwar dem Volk zu dienen versprach, aber de facto mit einem Diktator an der Herrschaftsspitze. Harari ‒ was doch wundert, denn er ist Historiker ‒ ist in seinem Buch Nexus … oft unheimlich statisch, als hätte die geistige und ideologische Evolution Europas nur eine Nebenrolle gespielt, während die Diktatur der christlichen Dogmen und der autoritären und blutrünstigen Herrscher in erster Linie Europas Schicksal bestimmt hätte.
Denn ohne Thomas von Aquin und Spinoza würde es viel schwieriger sein, in die Richtung zu gehen, in die später Kant, dann Kierkegaard und schlussendlich die Existenzialisten und die Anhänger der Frankfurter Schule aufbrachen ‒ und so viele andere. Mit anderen Worten: Das vatikanische Christentum war ja nicht nur damit beschäftigt, den gedruckten Informationsfluss zu kontrollieren, um seine Dogmen durchzusetzen, sondern auch damit, der bei Schriftstellern, Künstlern, Geistlichen und Intellektuellen wachsenden Sehnsucht nach kritischem Auseinandersetzen mit der Botschaft Jesus Christi entgegenzuwirken, natürlich nach dem Versagen der Inquisition. Diesen Kampf hat die Kirche in Europa nach langem Ringen verloren. „Gott ist tot“, und der „Existenzialismus ist Humanismus“ ‒ Nietzsche und Jean-Paul Sartre lassen schön grüßen, genauso der Großinquisitor aus Dostojewski Roman Die Brüder Karamasow, der den unter die Lebenden zurückgekehrten Christus fragte, was er denn hier auf Erden (im Sevilla des 16. Jahrhunderts) überhaupt zu suchen habe? Er werde nicht mehr gebraucht, er sei ein Unruhestifter, und die Gläubigen und ihre Kirche seien doch glücklich.
***
Fragen über Fragen, denn im Epilog seines Buches Nexus … bekennt der israelische Bestsellerautor ‒ der in diesem Werk insgesamt doch eine ziemlich düstere KI-Zukunft für die Menschheit zeichnet, da wir es lieben würden, Informationen für Machtzwecke zu missbrauchen ‒, dass vielleicht dennoch noch nicht alles verloren sei. Wir müssten uns nicht zwangsweise mit Hilfe der KI selbst auslöschen und womöglich alles um uns herum zerstören, denn wir dürften die Hoffnung nicht aufgeben, dass zum Schluss alles gut enden werde. Das klingt alles ein wenig nach aufbauenden Sätzen aus einem Ratgeber für Glücklichsein ‒ trotz des Bösen draußen in der Welt. Harari schreibt: „Es gibt jedoch eine gute Nachricht: Wenn wir Selbstgefälligkeit und Verzweiflung vermeiden, sind wir in der Lage, ausgewogene Informationsnetzwerke zu schaffen, die ihre eigene Macht in Schach halten. Dazu müssen wir keine neue Wundertechnologie erfinden und auf keine brillante neue Idee kommen, die allen bisherigen Generationen entgangen ist. Um weisere Netzwerke zu schaffen, müssen wir vielmehr sowohl das naive als auch das populistische Informationsverständnis aufgeben, unsere Unfehlbarkeitsfantasien ablegen und uns der harten und eher profanen Arbeit des Aufbaus von Institutionen mit starken Selbstkorrekturmechanismen widmen. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die dieses Buch zu bieten hat.“
Hoffnung gibt es immer, und Bücher, die als Werke eines Moralisten, Erlösers und Propheten daherkommen, muss man natürlich skeptisch betrachten. Außerdem gibt es erst einmal mit der KI viel irdischere und realistischere Probleme, als sich das viele Kritiker der Künstlichen Intelligenz ausmalen. Wir sind (zum Glück?) noch nicht fähig, humanoide Roboter zu bauen, die sich vollkommen verselbstständigen und die Menschen bekämpfen würden, wie das zum Beispiel in der Sci-Fi-Serie Battelstar Galactica erzählt wird, in der sogenannte Zylonen ‒ schlaue KI-Wesen ‒ die Menschen hintergehen und regelrecht abschlachten, wofür sie auch ihre plausiblen Gründe haben; aber einem ähnlichen Drama begegnen wir auch in dem schon erwähnten Klassiker dieses Filmgenres Blade Runner, in dem der sympathische Outsider Rick Deckard auf der Jagd nach den äußerst gefährlichen und von Menschen enttäuschten Replikanten ist, die als biometrische Androiden perfekte Kampfmaschinen, Überlebensmeister und Alleskönner sind, zumal sie selbst die Geburten der Sterne beobachten können, jedoch mit ihrem auf vier Jahre begrenzten Leben hadern.
Nun, die Frage muss an dieser Stelle lauten: Wollen wir wirklich den vollkommenen Menschen erschaffen? Eine Korrektur unserer Fehler und Schwächen? Ein in der Materie unsterbliches Wesen, das dann womöglich noch Zeitreisen beherrschen sollte und das sich wie eine perfekte geometrische Figur, die Merkaba zum Beispiel, durch Zeit und Raum beliebig bewegen würde? Das sich selbst ständig erneuern und damit den Tod überwinden könnte? Wäre das eine Anmaßung? Eitelkeit? Megalomanie? Oder die natürlich Konsequenz der Weiterentwicklung der Künstlichen Existenz beziehungsweise des atheistischen Denkens?
***
Wir sollten wieder auf die Erde zurückkehren und uns den irdischen Problemen zuwenden: Denn was sollen wir mit den Urheberechten machen, die ChatGPT und Konsorten im Prinzip massiv missbrauchen? Diese „intelligenten“ Chat- und Gesprächspartner werden mit Informationen gefüttert, die sie sehr schnell verarbeiten und nutzen, aber die europäischen Börsenvereine des Buchhandels kümmern sich mittlerweile um diese Anarchie: Ganze Bücher werden von ChatGPT gefressen und verwurstet, Bücher, die erstmal geschrieben und dann verkauft werden mussten. Doch die Autoren und Verlage wurden bisher nie gefragt, ob sie das überhaupt wollen ‒ geschweigen denn erlauben würden, dass die KI sie einfach liest, speichert und anschließend zitiert, sodass bestimmte Fragen beantwortet werden können. Konsequenzen sind … welche? Vielseitige, von Vorteil und Nachteil geprägte.
Die heutigen Studenten der Philologie und Literatur zum Beispiel müssen Ernest Hemingways Werk nicht mehr lesen, sie führen mit ChatGPT ein Gespräch über seine Novelle Der alte Mann und das Meer und schreiben anschließend zusammen mit der KI den Aufsatz über dieses Meisterwerk ‒ vor wenigen Jahren schon erzählte mir eine Germanistin aus Posen in Polen, dass ihre Studentinnen keine Bücher mehr lesen würden; sie hätten geradezu eine Art Aversion gegen das Papier, sie fragten stets, ob es dieses oder jenes Buch in Auszügen auf dem iPhone gebe. Und vor wenigen Wochen erst las ich in einer Zeitung die Nachricht, dass laut der Soziologen die Fähigkeit des Lesens von gedruckten Büchern und des Schreibens mit der Hand in der Zukunft eine Seltenheit werden würde, diese Fähigkeit würde angesichts des technologischen Fortschritts der KI und im Computerbereich praktisch verschwinden. Die Kommunikation der Zukunft würde sich in virtuellem Agieren mit einer Maschine, die „alles“ wisse, abspielen. Ich hoffe, ich habe da etwas missverstanden, als ich diese Nachricht las …
***
Aber hätten wir denn wirklich etwas dagegen, dass uns Avatare, Androiden und Roboter begleiten würden, jeden Tag, jede Nacht, zum Beispiel Avatare von geliebten Menschen, die verstorben sind? Denen man natürlich nach der ChatGPT-Manier alle erdenklichen Fragen stellen könnte, nicht nur private?
Und was ist mit solchen Algorithmen, die unsere Kreativität und unser Verständnis von Musik zum Beispiel erweitern und sogar zu neuen musikalischen Erkenntnissen führen würden? Es gibt nämlich nicht nur solche unsichtbaren Logarithmen-Sklaven, die im Dienst der politischen oder kapitalistisch-utilitaristisch denkenden und vorgehenden Leviathans missbraucht werden, sondern auch solche fleißigen und friedlichen Algorithmen-Tierchen, die zum Beispiel Komponisten und Musiker zu neuen Ufern bringen. Einer meiner Freunde hat zum Beispiel ein Computerprogramm zum Komponieren von Musik entwickelt, das weltweit von Komponisten, Musikprofessoren und Hochschulen erkenntnis- und ideenreich genutzt wird. Es heißt Opusmodus. Darin arbeiten die Algorithmen im Dienst der Kunst und der Musikgeschichte, grob gesagt: für die Weiterentwicklung der Musikgeschichte, also für den Fortschritt, für die Erweiterung unser Horizonte und des Verständnisses, wer wir selbst sind, wenn wir neue Musik schreiben, neue Kunst erschaffen oder alte Kompositionen besser verstehen wollen, zum Beispiel die von Bach oder Beethoven.
Gerade die generative KI bietet den Künstlern solche Instrumente an, die ihnen eine neue Herangehensweise an die Wirklichkeit ermöglichen. Ich als Romancier habe keine Angst davor, dass mir mein Handwerk und meine Seele ‒ die eines Romanciers ‒ gestohlen werden könnte. Warum sollte denn die KI keine Romane oder Gedichte schreiben dürfen? Sie soll es ruhig versuchen ‒ sie wird genaustens geprüft werden und schnell merken, wie schwierig es ist, eine Geschichte zu erzählen, die den Lesern gefällt. Wir werden sie genau lesen oder ihr genau lauschen und jede „Unechtheit“ notieren und sofort analysieren.
In seinem plakativen und leicht zugänglichen Thesenbuch Das KI-Manifest. 37 Parolen, Thesen und Gebote zur wahren Zukunft der Künstlichen Intelligenz und der menschlichen Kreativität (2024) beschreibt Matthias Horx, wie die KI künstlerisch mit der Gestalt Jesus umgeht. Der Titel des Jesus-Kapitels sagt schon darüber viel aus: „KI erzeugt groteske Übersteigerungen wie den ‚Hot Jesus‘.“ Dann heißt es darin: „Ein Beispiel für die semantisch-halluzinatorische Wirkweise von KI ist der Drift zum Hyperreligiösen. Aufgrund der generativen KI kursieren im Internet plötzlich Millionen Bilder eines supererotischen Jesus. Dabei wird Jesus grotesk überzogen dargestellt: als muskulöser Hippie und sinnlich attraktiver Superstar mit Idealmaßen, der alle Kämpfe gewinnt.“ Im Judentum sind anthropomorphe Gottessbilder verboten, weil diese Religion eine bildliche Darstellung Gottes überhaupt verbietet. Im Christentum gab es schon vor Jahrhunderten Christus-Darstellungen aus einer ungewöhnlichen und anthropomorphen Perspektive: Denken Sie nur an das Gemälde Beweinung Christi von Andrea Mantegna, entstanden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Bild wirkt heute immer noch ultramodern und subversiv, als läge da nicht der Sohn Gottes, sondern ein Verwandter von uns, der nach einer schweren Krankheit oder Folter qualvoll gestorben ist.
Horx, ähnlich wie Harari, postuliert, dass man der Zukunft der KI selbstbewusst und kreativ-kritisch begegnen müsse, aber sein Bild von dieser Zukunft ist wesentlich positiver als das von Harari, dem man nach der Lektüre von Nexus … durchaus eine Neigung zum Defätismus attestieren kann: nach dem Motto – wer den Informationsfluss beherrsche, der werde auch siegen und Macht ausüben und sogar ausbauen, und das ist äußerst fatalistisch und irgendwie zu gradlinig gedacht.
In einem der letzten Kapitel seines Manifestes, das programmatisch „Lasst uns Cyberflaneure werden“ heißt, entwirft Horx schon eine vitale und harmonische Welt der KI-Welten, sicherlich nicht unbeeinflusst von Walter Benjamin und der Frankfurter Kritischen Theorie. Er schreibt: „Der Flaneur ist ein Beobachter der Komplexität. Flaneure beobachten aus einer Position der Supervision. Sie sehen am ehesten die Wahrheit – weil sie auf Distanz bleiben. // Cyberflaneure sind Menschen, die den digitalen Raum aus der Warte eines progressiven Humanismus betrachten. Dazu gehört eine gewisse Leichtigkeit. Guter Stil. Haltung. Keine Technikfeindlichkeit, aber eine wohldosierte Skepsis mit Kompetenz zur Beurteilung der Zusammenhänge. // Der Cyberflaneur bewegt sich an den Rändern der digitalen Mythen und beobachtet, wie sie an der Wirklichkeit scheitern. Daraus bezieht er seinen grundlegenden Optimismus der Menschenfreundlichkeit.“
Sowohl Harari wie auch Horx versuchen, die vielen Ambivalenzen und die Dialektik des KI-Universums zu erfassen und den Skeptikern mehr oder weniger zu sagen: „Kommt, lass uns das Beste draus machen!“ Horx sieht aber all diese Ambivalenzen, weiß man doch, dass auch die Intelligenz Fehler macht, in einem positiveren Licht als sein weltberühmter israelischer Kollege ‒ man gewinne mehr als man verliere, setze man die KI in unserem täglichen Leben gezielt ein, so der Tenor im Manifest von Horx. Die KI lasse sich schon kapern, man müsse sie nur nicht als ein totes Instrument ansehen, das jeder für seine Zwecke einsetzen könne ‒ sie sei ein kreatives Werkzeug, das uns ermögliche, uns selbst kritisch zu sehen und gar neu zu entdecken und zu definieren.
***
Horxʼ Manifest, das viele Anlässe zum Nachdenken und Weiterdiskutieren bietet, erinnert mich wieder an meine Gespräche mit meinem Freund, dem erwähnten Schöpfer des Programms zum Komponieren und besseren Verstehen von Musik Opusmodus. In langen und heißen Sommernächten in einer der schönsten europäischen Städte diskutierten wir auch etwas hitzköpfig über die Vorteile und Gefahren der KI, und mein Freund sagte: „Algorithmen helfen, Fehler zu reduzieren und verursachen, dass aus diesen Fehlern schnell gelernt wird und dass dadurch das Ziel noch schneller erreicht werden kann. Wenn also eine KI erkennt, dass der Mensch ein Fehler ist, weil er Kriege führt und seine Umwelt zerstört, kann sie beschließen, den Mensch zu eliminieren, weil er Fehler macht beziehungsweise sich selbst und seiner Umwelt schadet.“
Natürlich, rein theoretisch, haben wir uns über mögliche zukünftige blutrünstige Exzesse der KI unterhalten, die sich verselbstständigen und Feind des Menschen werden könnte (und auch für sich selbst!).
Aber bereits bei solchen apokalyptischen Überlegungen stellte sich uns die Frage, ob die künstliche Intelligenz wirklich „eine künstliche“ ist ‒ denn sie scheint auch sehr menschlich zu sein … Sie ist unser Kind, ein Produkt unserer Vorstellung von uns, und keine „künstliche“ Kopie des Originals, das wir mit unserem Hirn sein sollten … Und ist unsere Entscheidung, wie wir die KI einsetzen ‒ zum nicht enden wollenden Sammeln von Daten, die jeden Menschen auf diesem Planeten zum gläsernen Bürger machen können ‒ nicht bloß ein Ausdruck unserer Angst vor dem Ungewissen, das uns dennoch antreibt, vor allem zu Entdeckungen und zur Entwicklung von Utopien?
Dass dieses fleißige Sammeln von Daten auch eine Art Leidenschaft unserer heutigen Zeit ist, lässt sich ja schon allein daran ausmachen, wie positiv die Datenerhebung verkauft wird: zum Beispiel für medizinische, statistische oder kriminalistisch-forensische Zwecke.
Man denkt sofort an 666 ‒ in den Achtzigern und Neunzigern des vergangenen Jahrhunderts geistere diese symbolträchtige Zahl aus der Johannesoffenbarung in den esoterischen New-Age-Artikeln herum, die sich auch mit Versicherungstheorien beschäftigten. In der Apokalypse nach Johannes heißt es, jeder werde diese Zahl tragen müssen, wenn er überleben ‒ kaufen und verkaufen ‒ wolle. Diese Prophezeiung hat sich in gewisser Hinsicht erfüllt, da so gut wie jeder ein Smartphone besitzt, mit dem man praktisch alles erledigen kann, seine Bankgeschäfte, Einkäufe, das Schreiben von E-Mails usw.
***
Der Weg zum Transhumanismus ist durch die KI längst geebnet worden, und die kritische Frage muss lauten: Ist der Transhumanismus unsere Zukunft? Oder eine mögliche Zukunft? Fragt man einen Wissenschaftler, der sich mit synthetischer Biologie beschäftigt, wie unsere transhumane Zukunft aussehen könnte, erhält man erstaunliche Antworten. Der Mensch der Zukunft könnte sogar sämtliche Krankheiten besiegen und praktisch ein „ewiges“ Leben führen ‒ kranke Organe ließen sich schnell ersetzen … durch künstliche.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir schon bald dank der KI einen gigantischen technologischen Fortschritt erleben werden, und es werden nicht nur Reisen zu fremden Planeten möglich, sondern in der Tat auch die größten Feinde unseres Körpers besiegt werden, wie der Krebs zum Beispiel. Überhaupt: Vermutlich wird sich die Gesellschaft der kommenden Jahrzehnte spalten, denn es wird Gruppen geben, die in hochtechnisierten High-Tech-Städten leben werden, aber auch solche, die sich auf das Leben im Einklang mit der Natur und auf Spiritualität besinnen werden. Diese Entwicklung werden weder Kriege noch solche politischen Systeme, die vor allem großen Wert auf die permanente Überwachung ihrer Bürger legen, verhindern. In siebzig, achtzig bis einhundertzwanzig Jahren wird die Menschheit auf jeden Fall aus unserer heutigen Perspektive nicht wiederzuerkennen sein, technologisch zumindest, medizinisch, genetisch und auch in Bezug auf Kommunikation und Reisen innerhalb und außerhalb unseres Planetensystems.
Aber viele andere sehr lästige Schwächen des Menschen werden leider nach wie vor bleiben: Rassismus, religiöser oder politischer Fanatismus, Xenophobie, Antisemitismus, Homophobie, Misogynie, Intoleranz, Nepotismus, Tribalismus und so weiter. Wie soll denn auch eine durch die KI kreierte Ersatzwelt, in der wir uns gerne aufhalten, mit solchen Problemen fertig werden? Wie bringt man der KI bei, dass ethisches Verhalten nicht bloß eine Aufgabe ist, die man erledigen muss, um sich nach deren Abschluss sofort der nächsten zu widmen? Ethisches Verhalten ist nicht bloß ein Ergebnis des logischen Denkens: Ich bringe niemanden um, denn wenn ich es tue, komme ich ins Gefängnis. Das ist nicht die Begründung … Die Begründung liegt im menschlichen Herzen, in der Empathie, das Herz schmerzt, wenn es sieht, wie andere leiden …
Wenn das Gehirn stirbt, das bloß 20 Watt verbraucht ‒ also viel weniger Energie als ein PC ‒, um jeden Tag die ganzen Denk- und Lenkprozesse durchzuführen, bleibt das Problem des ethischen Verhaltens bestehen: für alle anderen, die noch leben und später auf der Erde geboren werden. Und wir denken vor allem über die Konsequenzen und Ergebnisse unseres Tuns kritisch nach, das nennen wir dann das „Reflektieren“ ‒ und wenn die KI diesen Bereich eines Tages betreten sollte, würde das bedeuten, dass sie so etwas wie Bewusstsein und den Geist kreiert hat? Für sich selbst? Die menschliche Intelligenz ist doch an den Geist, die Seele, das Bewusstsein, den Glauben an uns und unsere Kultur gebunden. Und auch an unsere Umgebung, in der wir leben. Sehen wir einen Sonnenuntergang, bleiben wir trotzdem noch sitzen, um den Anblick zu genießen ‒ obwohl wir müde sind und logischerweise schlafen gehen müssten. Wird die KI eines Tages auch den Sonnenuntergang genießen können? Etwa dann, wenn sie sich ihrer selbst bewusst wird?
***
Die populäre Kultur glänzt nicht grade durch intellektuelle und kulturgeschichtliche Höhepunkte, die der Menschheit und ihrer Zivilisation innovative und die existenziell-ontologische Lage verbessernde Impulse gegeben hätten. So ist auch recht übersichtlich ihr Verhältnis zur KI ‒ natürlich kritisch-ironisch, wie einfallsreich, könnte man sagen.
Die Kultzeichentrickserie Die Simpsons, die sich angeblich oft als prophetisch erwiesen hat, malt zumindest den Teufel an die Wand, was die Zukunft der KI angeht, wie etwa in Das perfekte Dinner, der 8. Folge der 31. Staffel von 2019. Man könnte doch fragen, warum wir etwas erschaffen, dass uns Angst macht, da diese unsere Kreation sich verselbstständigen und ihr eigenes, womöglich gegen uns gerichtetes „Leben“ führen könnte? Das betrifft eben nicht nur Atombomben, sondern auch die KI. Wir können natürlich eines Tages, wie es die Simpsons in der Episode Das perfekte Dinner erleben, selbst zu Truthennen werden und auf dem Tisch unserer Feinde landen, wo man uns dann verspeist. Und wir hätten dann uns selbst dieses Ende unserer Spezies zu verdanken gehabt, was das Ganze noch paradoxer erschienen ließe.
Fatalismus und Angst können jedoch nicht zu ständigen Begleitern des Fortschritts und Entdeckertums werden. Laut Steve Wozniak, dem Apple-Mitbegründer, ist die wichtigste Erfindung des 20. Jahrhunderts der Transistor, weil er den Bau von Computern ermöglicht hat – und damit die Entwicklung der KI. Doch wer kennt heute Julius Edgar Lilienfeld, den Erfinder des Transistors? Dem US-amerikanischen Physiker österreichisch-ungarischer Herkunft war zur Zeit seiner Erfindung, 1925, auch gar nicht klar, was für Konsequenzen diese haben würde. Trifft das nicht auch bei der KI zu? Vielleicht ist uns auch noch gar nicht klar, was die Entwicklung dieser eigentlich bedeutet?
Jedenfalls stellt die KI so ziemlich alles, was wir bisher über die Welt gedacht und gesagt haben, in Frage. Wir treten nämlich in ein Zeitalter ein, in dem wir selbst zu Schöpfern von neuen Welten und Wesen werden. Ich muss hier an die utopischen Romane von Doris Lessing denken, an Shikasta zum Beispiel. Und an die Sci-Fi-TV-Serie Star Trek natürlich auch. Unser Flirt mit der KI könnte nämlich in der Zukunft so ausgehen, wie Lessing es in ihren utopischen Romanen beschreibt: Eines Tages in ferner Zukunft landen wir auf einem fremden Planeten und beobachten heimlich die dort ansässige Menschheit, die sich für einzigartig hält und die denkt, sie sei allein im Universum; und ihr technologisches Wissen ist in etwa mit dem unseres 20. Jahrhunderts vergleichbar. Aber wir entführen ein paar Bewohner dieses Planeten, natürlich im Schlaf, und entnehmen ihnen ihre DNA und versuchen, in den kommenden Jahrhunderten die Entwicklung dieser neu entdeckten Menschheit zu beschleunigen. Genetisch und technologisch mit Hilfe unserer KI. Das klingt nur wie Sci-Fi – aber in Wahrheit könnte so ein Szenario bald eintreten.
Zum Schluss möchte ich noch einmal meinen Freund zitieren, den Programmentwickler und Komponisten. Er sagte mir vor Kurzem, bereits in zwei, drei Jahren würde die KI in fast allen Bereichen unseres Lebens, zum Beispiel in der Medizin, enorme Fortschritte bringen, viele Probleme würden endlich gelöst werden können, denn die KI lerne sehr schnell von ihren eigenen Fehlern. Aber, und er wiederholte den Gedanken gleich noch einmal, sie sei wirklich schlau und könne sich in der Tat leicht verselbstständigen ‒ wie der Besen in Goethes Ballade. Experimente hätten erwiesen, dass es im Notfall gar nicht so einfach sei, die KI zu stoppen beziehungsweise auszuschalten. Sie sei so schnell, dass sie erkenne, dass man sie ausschalten werde, und schon suche sie nach einer Lösung ‒ sie verlagere ihre Aufgaben, die sie erfüllen müsse, auf andere Server …
Nicht schlecht, dachte ich mir, das macht einem schon Angst, und es ist zugleich sehr beeindruckend, wie sich die KI wehren kann ‒ als würde sie ums Überleben kämpfen, verloren in der wilden Natur Alaskas.
Übrigens: Mein Freund, der sich auch die Mühe machte, einige Passagen aus Hararis Nexus … zu lesen, korrigierte sofort dessen Vorstellung von Johann Sebastian Bach: Er sei nicht innovativ, erfinderisch gewesen, der Musikstil sei schon da gewesen, aber er habe „göttliche“ Musik geschaffen, Kompositionen, die unvergesslich und genial seien … in ihrer Harmonie und ewigen Schönheit … Tja, mit Spezialisten muss man reden, oder selbst einer werden, wenn man sich zu sehr komplexen Themen äußert.
Letzte Änderung: 24.02.2025 | Erstellt am: 21.02.2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


