Die auratische Melancholie
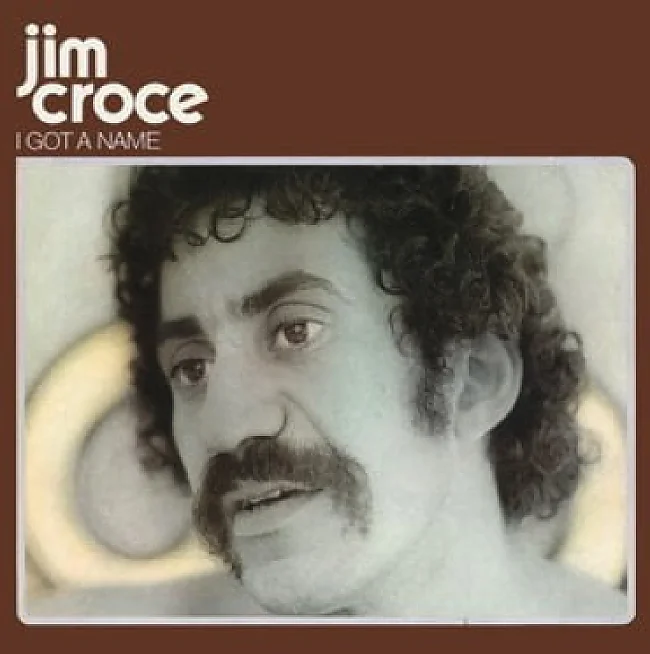
Am 20. September 1973 endet in einem Kleinstädtchen im US-Bundesstaat Louisiana ein markantes Musikerleben. Jim Croce, 30 Jahre alt, hat es nach zehn Jahren unermüdlicher Arbeit geschafft, von seiner Musik zu leben. Seine Alben und viele ungewöhnliche Singles landen in den Top Ten der Charts auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist erstaunliche fünfzig Jahre her. Paul-Hermann Gruner würdigt Croce als eine menschliche und künstlerische Rarität.
Die Zeit der Rock-Formationen schien vorbei. Die Beatles waren ein Beispiel: Nach ihrem Ende 1970 gab es vier eigenständig arbeitende Pilzköpfe, vier Singer-Songwriter mehr auf dem anspruchsvollen Pop-Markt. Die Zeit der Solisten war angebrochen. Auch die der schillernden Selbstvermarkter, der expressiven Ich-Darsteller. Im Gegensatz aber zu Ikonen der Ära wie Alice Cooper, Jimi Hendrix, David Bowie oder Frank Zappa war Jim Croce ein ganz anderes Kaliber: extrem bescheiden im Auftritt, intellektuell ohne Attitüde, ein musikalischer Volkskundler und präziser Introspektiver, ein völlig glitterfrei agierender Bühnen-Junkie.
Berühmt wurde er mit seinem Tod. Aber bitte – Lorbeer posthum gehört für Künstler seit jeher zum Berufsrisiko. Das Schicksal von James Joseph „Jim“ Croce mitten im Musikgeschäft der Medienmoderne ist also ein klassisches. Mit einem betont eigenwilligen, aber nie vordergründige Knalleffekte streuenden Personalstil zwischen ruralen Folkmotiven und metropolem Rock erwarb sich der Italo-Amerikaner in den zweieinhalb Jahren vor seinem Tod starke Reputation unter Kennern und tiefe Sympathie beim Publikum. 40 Songs für die Ewigkeit. Mehr wurden es nicht. Ruhm und Würdigung kamen nach einer steil aufsteigenden und jäh abgeschnittenen Karrierekurve. Croce-Produzent Terry Cashman beschrieb es im Plattentext zu „The Faces I`ve Been“ (1975) so: „Große Erwartungen mit einem unerfüllten Höhepunkt sind eine Tortur“.
Im Alter von sechs Jahren lernt Jim das Akkordeonspiel, als Zwölfjähriger wechselt er zur 6- und 12-saitigen Akustikgitarre. Publikum gibt es auch – bei jeder sich bietenden Gelegenheit singt er sein immenses Repertoire aus Fünfziger-Jahre-Hits so-wie Titel von Bessie Smith, Jimmy Rodgers oder Cisco Houston im Kreise der Familie. Obschon aufwachsend im Arbeitermilieu der aufsteigenden Mittelklasse in Pennsylvania, darf er College und Universität besuchen. Der in den 1960ern mit Macht aufsteigende Folk- und Folkrock-Boom zwischen Baez, Dylan und Donovan schafft sich derweil seine typischen Talentbörsen – die Coffeehouses, Bars und Clubs. Croce hört jedes Wochenende zu.
1963 ist er mit den „Spires“ zum ersten Mal auf einer Platte zu hören – die Villanova State University – an der auch der Freund und spätere Songschreiber-Kollege Don McLean studiert („American Pie“) – betätigt sich als Plattenproduzent für Gruppen der lokalen Szene. 1965 schließt Croce an dieser Universität sein Studium als Diplom-Psychologe ab. Die Familie drängt auf einen „normalen“ Beruf, die Musik aber bleibt zentrale Achse seines Selbstausdrucks. Zu Hilfe kommt Croce die National Student Association: Sie schickt ihn für mehrere Monate als musikalischen US-Botschafter auf eine Goodwill-Tour durch den Mittleren Osten und Afrika. Die Rolle des Diplomaten mit Gitarre versorgt ihn mit einer Menge internationaler, mitunter bizarrer Erfahrungen – einiges davon munitioniert sein Talent als balladesker Geschichtenerzähler. Aber noch zeigt sich sein musikalischer Gestus dominiert von Vorbildern wie dem frühen Gordon Lightfoot, Tom Rush oder dem Duo Ian & Sylvia.
Die musikalischen Suchbewegungen von Croce offenbaren in dieser Zeit: Es gibt keine echten Freunde und Berater, es gibt keinen Zugang zum „Business“, es gibt kein Geld. Für die Musik geht in der Regel der Hut rum. Und ja, Karrieren sind wesentlich schwieriger machbar in der alten Zeit – ohne Internet, YouTube und soziale Medien. Die Finanznot wird auch nicht besser nach der Heirat mit der musik-, und koch- und backbegeisterten Ingrid Jacobsen (1966). Aber sie gehen jetzt zusammen auf Club-Tournee, teilen sich Songwriting und Gesangsparts, wirken als Duo aber wie viele Liederschmiede damals im konventionellen, fast puristisch festgelegten Folk-Revival. Für ein Jahr leben die Croces in Mexiko, dann lockt sie ein Kontrakt nach New York. Sieht nach dicker Chance aus, endet aber im Fiasko. Der Vertrag mit Capitol Records bringt zwar 1969 die Produktion „Jim & Ingrid Croce“ zustande, betreut vom Produzenten Nick Venet, aber alles klingt ausschließlich nett, engagiert und komplett unaufregend. Marketing für das Album gibt es gar keins. Die Croces leben in einem Loch in der Bronx, bis alles Geld versickert ist. Der Moloch New York, in Kriminalität und Müll scheinbar erstickend, stößt sie ab. Sie verschwinden desillusioniert aus der Metropolis und ziehen aufs Land in den Flecken Lyndell, Pennsylvania. Population 138 verkündet das Ortsschild. Aber die Flucht aus der Stadt, das Landleben, die alternative Subsistenz – es ist auch ein Zeitgeistphänomen der frühen Siebziger, ein oft beschwörend besungenes, zivilisationskritisches Sehnsuchtsmotiv der posthippiesken Gegen- und Jugendkultur.
Das Leben im alten Farmhaus macht Croce zur Provinzpflanze und zum Volkskundler. Er kann mit Menschen. Und Geld muss her. Jim arbeitet auf dem Bau, im Steinbruch, im Krankenhaus, als Radio-DJ oder als Lastwagenfahrer („each Truck-Stop is like a Fellini-Film“ sagt er später dazu in „Trucker-Dialogue“). Direkte, derbe, illustre Einblick in die banalen Realitäten des Alltags gewinnt er, finanziell geht es dennoch so schlecht, dass er große Teile seiner Gitarrensammlung verkauft.
Psychisch angeschlagen und in der künstlerischen Sackgasse, schweigt Croce eine Weile. Stillstand und Schmerz dreht er mühsam, aber produktiv in Erkenntnis. Erkenntnis öffnet Türen ins tiefere Selbst. Mit der Nachricht, dass er Vater werden wird, ändert sich seine Musik. Noch vor seinem Sohn Adrian James (heute ein Pianist zwischen Blues- und Jazz) wird ein musikalischer Personalstil geboren: Croce-Songs sind plötzlich thematisch weniger allgemein und traditionalistisch, viel komplexer, aufrichtig, schmerzhaft persönlich, sehr ernst, aber gepolstert mit Ironie und einer Spur Sarkasmus. Die Besonderheit einer nicht lähmenden, sondern wehrhaften Melancholie entwickelt er zu seinem Markenzeichen und macht sie auratisch. „Plötzlich war da etwas ganz Eigenes und Individuelles in diesen Kompositionen“, erinnert sich Produzent Tommy West.
Mit dem sechs Jahre jüngeren Lead-Gitarristen Maury Muehleisen neu an seiner Seite – er sorgt von da an für die herausragend artistische und filigrane Gitarristik der Croce-Aufnahmen – wird im Herbst 1971 im eigentlich verhassten New York die LP „You Don`t Mess Around With Jim“ (#8) aufgenommen. Der Titeltrack klettert ebenso wie die Singles „Operator“ (#17) und „One Less Set Of Footsteps“ (#37) die Charts nach oben, das Album selbst steht im Sommer 1972 auf #1 der US-Charts. Croce hat seine musikalische Energie-Ader gefunden und angezapft. Die Rakete zischt ab.
Die Charts-Erfolge bringen Croce in die großen TV-Sender, die Talkshow-Gastgeber Johnny Carson und Dick Cavett laden ihn ein. Dabei sieht Croce im Grunde stets aus wie ein Lastwagenfahrer, den man mal kurz aus dem Führerhaus gerufen hat. Egal, der sanftmütige Melancholiker kommt an, weil er nicht zartbesaitet aussieht. Das markant-grobe Croce-Gesicht mit den schwarzen Löckchen, mit üppigem Schnauzbart und meist dicker Zigarre im Mundwinkel lässt sich ikonisch vermarkten. Für eine Serie von Standup-Comedy-Shows Ende 1972 in New York und Philadelphia wird Croce gebucht als Opener für einen durchweg nervös durchgeknallten Woody Allen, von dem Croce sagt: „Woody war hysterisch. Und allemal lustiger hinter der Bühne als auf ihr.“ Reporter verfolgen die Shows und fragen sich, was ein werdender Superstar mit einem Wortwitz-Komödianten so macht. „Woody, you were pretty fortunate to have Croce in front of you“, schreibt die Presse. Der Rolling Stone beschreibt den Eindruck von Croce in den Shows so: „He looks like a guerilla fighter just in from the hills.“ Passende Metapher: Croce wirkt wie ein Teil von Castros kubanischem Revolutionsteam.
Die Qualität der Ende 1972 in der New Yorker Hit-Factory aufgenommenen LP „Life & Times“ (veröffentlicht im März 1973) bestätigt die Flugbahn der Rakete: steil nach oben. Croce scheint nicht aufzuhalten. Er serviert, wie nebenbei, expressiv-feinsinnige Sonogramme einer Epoche – in einer Stil-Nische zwischen Protestsong und Gegenkultur auf der einen Seite und seriell-solider Unterhaltungsware auf der anderen. Sein rauh-wahrhaftiger Gesangsstil, Faktur und Melodik sowie das instrumentale Soundprofil machen Croce-Songs unverkennbar. Die Single-Auskopplung „Bad, Bad Leroy Brown“ erreicht im Juli 1973 #1 der Billboard-Charts. Im Dezember des Jahres wird Frank Sinatra die finstere Ballade covern.
Ingrid und Jim Croce wollen umziehen nach Kalifornien und im Gaslamp-District San Diegos ein Restaurant eröffnen. Die Adresse haben sie schon ausgeguckt. Ingrid möchte raus aus dem völlig abgeschiedenen Landleben. Aber Jim ruht nicht aus. Er kann nicht. Er bleibt bei sich. Unirritierbar. Erschöpft. Ein Getriebener. Sich selbst Treibender. Als mangele es an Zeit. „Lieber zwei Stunden singen als ein Zwei-Minuten-Interview geben“, zitiert ihn posthum der STERN (1974). Croce und Muehleisen touren ohne Unterlaß kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten. 300 Konzerte im Jahr. Im September 1973 schiebt eine ABC-Fernseh-Dokumentation Croces Reputation weiter an. Als Soundtrack ist sein Stück „Time In A Bottle“ zu hören, ein fast kammermusikalisch streng gestaltetes Folkpicking-Poem aus dem Album „You Don`t Mess Around With Jim“. Ein Tag nach der US-weiten Ausstrahlung gibt es derartig viele Nachfragen nach der Vignette (Länge: 2:24), das sich die Plattenfirma entschließt, sie nachträglich als Single auszukoppeln. Einen Monat nach Croces Tod steht dieses kleine, stille Chanson – im Grunde vollkommen deplaziert – in den lauten, schlagzeuglastigen Pop-Charts auf Platz #1.
Von Juni bis zum 13. September 1973 ziehen sich die Aufnahmen hin für die LP „I Got A Name“. Mit dem eingeschworenem Musiker- und Produktionsteam gelingt noch einmal ein Album voller Intensität, Wärme und subtiler, fast altersweiser Schwermut. Erneut sorgt eine Filmproduktion für noch mehr Aufmerksamkeit: Im Vorspann zu dem Hollywood-Streifen „The Last American Hero“ nach einer Kurzgeschichte von Thomas Wolfe singt Croce die Charles Fox/Norman Gimble-Komposition „I Got A Name“, die es auch als Single kurz darauf, im August 1973, zu etwas bringt (#10). Nach Beendigung der Studioarbeit in der Hit Factory in New York am 13. September gehen Croce und Muehleisen sofort wieder auf Tournee durch Clubs, Bars, Universitäten. Auftritte in studentischen Milieus kommen Croce zupass, da setzt er seine „unglaubliche Bühnenpräsenz“ (Tommy West) zwischen Stories und Songs zielsicher ein. Nach Konzertende, am 20. September 1973 spätabends, starten Croce, Muehleisen und vier weitere Passagiere mit einer zweimotorigen Chartermaschine vom Städtchen Natchitoches in Louisiana aus Richtung Texas. Die Maschine hebt zu spät ab, gewinnt zu wenig Höhe, streift die Wipfel von Walnussbäumen und stürzt ab. Niemand überlebt. Acht Wochen danach erscheint die LP „I Got A Name“. Im Song „The Hard Way Every Time“, letzter Titel der letzten LP, zieht Croce ein Resümee fürs eigene Leben und Arbeiten so, als texte er mit ominösem Vorwissen: „But in looking back at the faces I`ve been / I would sure be the first one to say / When I look at myself today / Wouldn`t have done it any other way.“
Die traurige Geschichte hat eine erwähnenswerte Coda. Croces Witwe Ingrid – die passionierte Köchin und Konditorin – eröffnet 1985 am vereinbarten Ort in San Diego „Croce’s Restaurant & Jazz Bar“ (Werbeslogan: „Great food, live music and inviting casual atmosphere“). Bis 2016, 31 Jahre also, existieren die Lokale als Institutionen der Erinnerung an Jim, der selbst nur 30 Jahre alt wurde. Viele aus der alten Kollegen-Garde musizieren dort live: Arlo Guthrie, Willie Nelson, Waylon Jennings, James Taylor. Ingrid ist fleißig. Sie publiziert unter anderem auch ein literarisches Kochbuch mit ihren Lieblingsrezepten und dem klangvollen Titel „Thymian in der Flasche“, englisch: „Thyme in a bottle“. Bezugsreicher kann man an eine Legende nicht erinnern.
Letzte Änderung: 06.08.2023 | Erstellt am: 06.08.2023
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


