Das Unheil hört nicht auf

Hector Berlioz fand nicht nur beim deutschen Publikum zwiespältige Aufnahme, die durch Ressentiments und Missverständnisse gefiltert war. Auch in Frankreich, wo ihm die akademischen Kunstrichter das Leben schwer machten, musste er sich gegen manche Widerstände behaupten. „Romantiker“ war das Etikett, das nicht nur die Zeitgenossen auf eine selektive Wahrnehmung festlegte. Das Realistische und zugleich Grenzüberschreitende seiner Musik wurde in der Berliner Philharmonie offenbar, wo Alban Nikolai Herbst die halbszenische Aufführung der „Trojaner“ erlebte.
Möglich, daß diese Präsentation für Hector Berlioz’ Gewaltoper die ü b er h a u p t angemessenste ist und eben n i c h t n u r eine „halb“ szenische, sondern ihre geradezu perfekte Aufführungsform – selbst wenn ihr Hans Scharouns Berliner Philharmoniegebäude einige Abstriche abgenötigt hat. Wenn auch nicht ganz so perfekt wie die Kleine Philharmonie nebenan, ist ihr Konzertsaal ja imgrunde Arena, hingegen die meisten gängigen Konzerthäuser Fronttheater sind. Auf solch eines, deutlich, sind Gardiners Trojaner zugeschnitten. So war denn am 1. September zu sehen, daß die Akteure – Solistinnen, Solisten, Chor – szenisch ein wenig überfordert waren: Die Salzburger Aufführung, nämlich die überhaupt zweite, fand eine knappe Woche zuvor statt; deshalb wird Tess Gibbs ebenso ungenügend Zeit gehabt haben, ihre sogenannte Bewegungsregie der nächsten Spielstätte anzupassen wie vor allem auch Dinis Sousa, der für John Eliot Gardiner eingesprungen ist, dies mit der Klangregie zu tun. Gustav Mahler, wenn’s irgend ging, hatte für solche Zwecke Alfred Roller zur Seite. Ohnehin meisterlich, wie Sousa das zumindest ungeplante Dirigat bereits in Salzburg in den Griff bekommen haben soll. Respekt, Respekt.
Obwohl also die, sagen wir, „Arena-Situation“ deutlich andere Anforderungen stellt, scheint mir Gibbs’ Regie dennoch von Peter Sellars’, zusammen mit Simon Rattle, Inszenierung der Matthäus-Passion beeinflußt zu sein; jedenfalls hat sie dieselben Stärken, und zwar besonders bei den Choristinnen und Choristen. Die gleichermaßen bekannte wie zurecht berühmte Schule gardinerscher Deklamationskunst ergänzte sich fulminant um Gestik und, ja, selbst um die Mimik; allein schon, Gänge einzustudieren, und eben nicht nur in den Gegebenheiten ein- und desselben Hauses, bedarf, wird zugleich gesungen, extremer Konzentration; bei von Aufführung zu Aufführung verschiedenen Sälen kann sich eine Routine kaum einstellen, die wenigstens ein wenig den Menschen helfen würde. Sie sind ja keine Automaten. Und was die Solistinnen und Solisten anbelangt, so sangen sie eben doch vorwiegend „von der Rampe“ – etwas, das die Berliner klangtechnisch geradezu perfekte Architektur in aller Regel auch für diejenigen aufzufangen wußte, die direkt überm Chor saßen oder, wie in meinem Fall, über den Pauken. Nur trat ein Sänger ganz von hinten im Publikum auf, entstanden doch schon mal Klanglöcher, so daß der vorgetragene Part zu einem morgensternschem Fisch ward, der stumm die Nacht besingt:
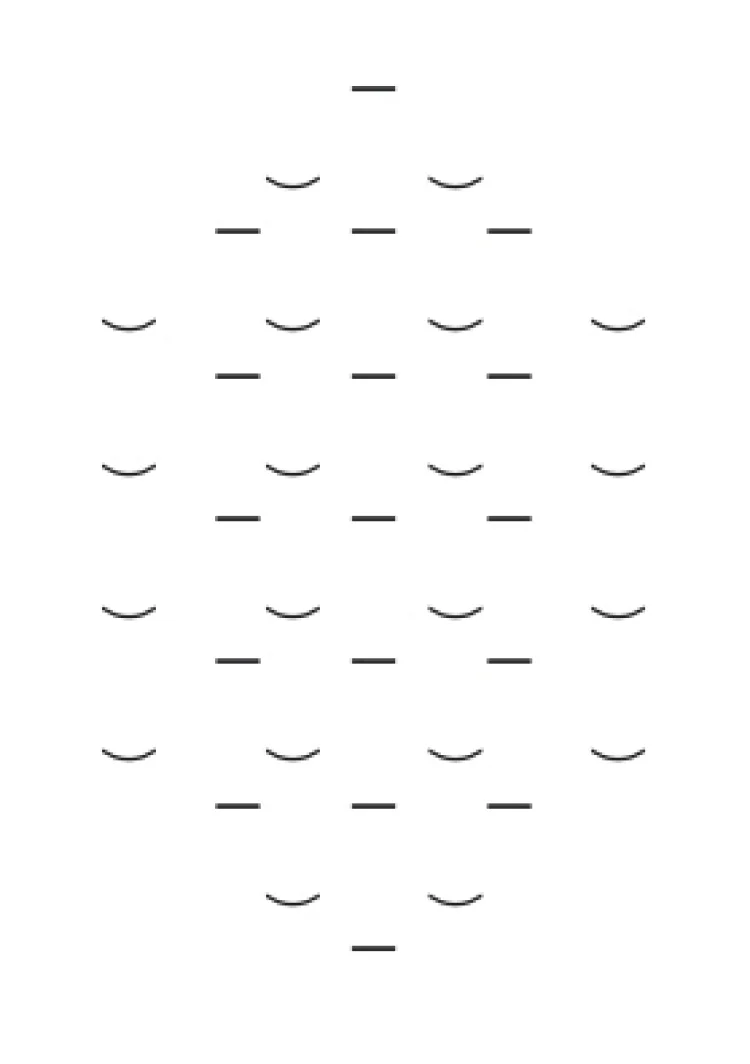
(Kein zweiter je, meinem Wissen nach, hat dieses Gedicht so eindrücklich zu rezitieren vermocht wie Gerd-Thalia-hab-ihn-selig-Fröbe.)

Vergessen Sie nicht, welch einen Lärm diese Oper veranstaltet und es auch tun muß, was nicht nur an den für eine Kriegsoper essentiellen Triumphhymnen liegt, sondern besonders für die, typisch Berlioz, weniger klang- als geräuschnah komponierten Instrumentalstellen. Da wird gequäkt, geknarrt, gerummst und, an den „schönen Stellen“, flageoletten geflirrt – Effekte, die plastisch eigentlich erst in Gardiners historischer Aufführungspraxis hervortreten können; sie ist das komplette Gegenteil des karajanschen Klanglacks: rauh, grob, widerspenstig, vor allem aber – brutal. Da wird denn, nach den für die damalige Pariser Oper obligaten Ballett-Einlagen (zu denen ein an sich höchst fantasie- und schwungvoller, doch sich ewig hinziehender Walzer gehört, der Gardiners erzählende Dramaturgie geradezu schmerzhaft, auf jeden Fall so stocken läßt, daß wir ungeduldig werden und fast schon Langeweile einsetzt) … wird denn das Liebesduett Ende Akt IV tatsächlich zur Erlösung, nicht nur als Erfüllung der beiden Liebenden, sondern auch unserer, und es spielt keine Rolle mehr, daß diese lange, wahrhaft himmlische Zweisamkeitsarie unter anderen Umständen ein ziemlich klebriger Kitsch wär, zumal es zu der angesungenen „Ekstase“ auch kompositorisch nicht kommt. Merkurs zum Krieg treibenden Schlußrufe hätten sie auch ganz zerhaun; zugleich aber – hier zeigt sich Berlioz’ Kompositionskunst ganz besonders – adeln sie den Kitsch, ex negativo nämlich: Die Schmerzlichkeit wäre um einiges milder, ja geschönt, brächte sie uns ein auf Klangsamt getrimmtes Orchester bei. Jetzt sind wir selbst verstört, nicht länger nur zuhörend, zuschauend mehr. Und kommen nicht umhin, an die Ukraine zu denken. So dass wir zu denken beginnen:
Sicher, diese Musik insgesamt läßt sich als frenetischer Jubel aus dem Geist des französischen Kolonialismus verstehen – wofür schon der Einsatz von Saxhorn und Ophikleïde, einer Vorart der Tuba, spricht; gerade erstres war zu Berlioz’ Zeiten typisch für französische Militärkapellen. Da, wenn die Numider angreifen – das von Karthago vertriebene Berbervolk also – und zurück- und niedergeschlagen werden, jubelt das Orchester ausgesprochen schlimm. Ob dies erst im postkolonialen Zeitalter gespürt wird, sei dahingestellt. Doch häßlich ist in dieser Oper sehr, sehr viel, was uns die Rauheit des historischen Instrumentenklangs überhaupt erst richtig, ja geradezu erschreckend wahrnehmen läßt. Wirklich schöne Musik gibt es eh kaum, vom schon erzählten Liebesduett, vor allem aber den beiden durch den hochlyrischen, ja zarten Ton Laurence Kilsbys vorgetragenen eher Weisen als Liedern abgesehen. Fast alles übrige steht unter dem fanatischen Diktat der Götter, die auf die Entsetzlichkeit des einen Krieges gleich die des nächsten folgen lassen wollen; wenn Aeneas „pflichttreu“ wie ein deutscher Landser nach Italien endlich aufbricht, wird er mit Rom den imperialsten Militär- und Schreckensstaat gründen, den die Welt bis dahin sah. So beginnen „Les Troyens“ mit größter, wenn auch grundloser Freude, und enden in der Depression, der Karthager nämlich, besonders der verlassenen Dido, nach deren Selbstmord das zusammengeströmte Volk, den Scheiterhaufen im Rücken, dem Geschlecht des Aeneas ewigen Haß und Rache schwört:
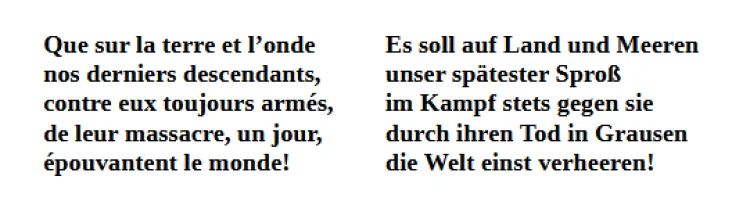
Doch wende ich den Blick in die Psychologie, erzählt mir die Oper genau das Gegenteil des affirmativen Waffenjubels, nämlich eine … eben: verheerende Schicksalslogik von Kriegen. Sie findet in den Seelen derer statt, die sie führen oder auch „nur“ an ihnen teilnehmen, selbst wenn sie’s müssen. Nun nämlich verlassen wir das nationalkolonialistische Pathos, das ich wohl allzu schnell gewittert hatte. Nämlich sind die antreibenden Götter innenbildliche Repräsentanzen geradezu Zwang gewordener Prägungen; so sehr ist Aeneas auf Gewalt abgerichtet worden. Da helfen ihm auch nicht die, bei Vergil, „Tränen der Dinge“ (sunt lacrimae rerum), die er wahrnimmt. In kaum einem mir bekannten Musiktheaterstück wird diese Art unerbittlichen Geworfenseins so deutlich wie hier, wenn Berlioz eben nicht auf klanglichen Hochglanz geputzt, sondern aufs Primat der Dramatik gewetzt ist. John Eliot Gardiners nun schon fast lebenslange Rekonstrukionsarbeit hat es mit diesen „Les Troyens“ derart erschreckend wie überwältigend aufs Podium gebracht, daß es geradezu körperlich spürbar wurde. Aeneas, endlich angekommen und sogar in eine große Liebe gebettet, bleibt der aufs Töten abgerichtete „Held“, einer, der weiter und immer weiter töten muß und schließlich selber „fallen“, wobei er Hunderte, Tausende mit sich reißt. Was er selber auch sieht: „Tu pars?“, Du gehst?, fragt Dido, und er antwortet: „Mais pour mourir“, Um zu sterben aber. Sogar das Elend und Ende seiner Geliebten sieht er voraus. Erst recht ist es egal, ob Karthago gleich zu Beginn des dritten Aktes als ein quasi Paradies gefeiert wurde, in dem selbst die einfachen Stände rundweg glücklich sind – eine hymnische Überhöhung zwar und insofern heikel („Heil dir, o Ackersmann! Dir, der uns erhält“), doch wird ihre dramatische Funktion hier unabdingbar klar. Die Menschen können sich wohlfühlen, wie sie nur mögen – rufen „die Götter“, hat man zu folgen. Hätte man aber (dieses beseite gesprochen) Aeneas unbedingt in ein Kostüm stecken müssen, das an russische Bauern nicht nur erinnert? Was soll diese Kleidung uns sagen?
Egal. Das Fürchterlichste ist, daß sich solch Geprägtsein überträgt. Nach Aeneas’ Abschied tobt Dido dermaßen, daß sie kurz sogar selbst in den Krieg, ihn ihrem Volk aufzwingen will, das doch derart beglückt war. Diesen Ausbruch und die sofortige Erschütterung darüber gestaltet Paula Murrihy mit solch massiver, wiewohl inniger Kraft, daß es mir quer durch den Leib fuhr. Sicher, sie besinnt sich noch – „Que dis-je? – Impuissant fureur!“ –, doch nach ihrer Selbsttötung hat sich der Krieg auf alle andern übertragen. Hier der letzte Satz der Oper, wieder in Simon Werles Übersetzung:
Es soll auf Land und Meeren
unser spätester Sproß
im Kampf stets gegen sie
durch ihren Tod in Grausen
die Welt einst verheeren!
Die Welt, die ganze Welt! Nicht einmal Wagners Nibelungen gehen schlimmer aus, schon gar nicht bei Chereau.
Und ist’s nicht mit uns selber so, verfallen der heldischen Sprache nicht auch schon wieder wir, hämen die einstige Friedensbewegung, die eine Bewegung des Hoffens war, und rufen „Ruhm der Ukraine!“ mit – statt „Україні Мир“? Wie also furchtbar „geworfen“ wir selbst sind, das führt uns Gardiner vor und läßt’s uns, vor allem, h ö r e n – und, um nun auch darauf zu sprechen zu kommen, auf den kleinen Skandal direkt nach der Premiere in La Côte-Saint-André, Hector Berlioz’ Geburtsort, wo Gardiner den Sänger des Priam geschlagen haben soll, weil der nach dem Applaus – wer kann’s überprüfen? – den falschen Ausgang genommen haben soll: Wissen wir denn, was wirklich die Ursache war, die den alten Maestro so ausrasten, es aber gleich bereuen – Que dis-je? Impuissant fureur! – und alle Dirigate des Stücks niederlegen ließ? Ist die grauenhafte Wähnung so falsch, es habe sich der Krieg da auch auf ihn übertragen? Und auf viele seiner Kritiker mit, die gleich das Ende des großen, wenn auch schwierigen Mannes herunter aus den Regenrinnen ihrer Redaktionen riefen? Alles, all das immer so weiter? „Im Kampf stets gegen sie durch ihren Tod in Grausen“? –
– Bitte, lassen Sie uns nüchtern sein. Käme es zu einem juristischen Prozeß, was hätte der Dirigent als Strafe zu erwarten? Ein Jahr auf Bewährung vielleicht? Plus Schmerzensgeld, geschenkt. Doch aber lebenslang, das „Ende der Karriere“ gleich? Und William Thomas, der Geschlagene, auch, sagte nun die Mitwirkung ab. Die Schraube dreht sich immer weiter. Das, genau das ließen sie mich sehen und hören und schmerzhaft verspüren, sowohl die Sängerinnen und Sänger dieser furchtbaren, gnadenlos guten Inszenierung, wie auch Gardiners revolutionäres Orchestre Révolutionaire et Romantique und ganz, ganz besonders der Monteverdi Choir, den es ohne diesen Mann gegeben niemals hätte. Wär das nicht ein bißchen mitzubedenken, allein aus Menschlichkeit?

P.S.:
Die letzte Aufführung fand am 3. September auf den BBC Proms statt. Doch immerhin, am 22. um 20.03 Uhr und am 23. September um 19.05 Uhr wird der Deutschlandfunk Kultur einen Mitschnitt übertragen. Lassen Sie uns hoffen, daß es eines Tages auch eine Filmaufzeichnung anzuschauen gibt.
Letzte Änderung: 18.09.2023 | Erstellt am: 18.09.2023

Hector Berlioz (1803 – 1869)
Les Troyens
Grand Opéra in fünf Akten (1856 – 1858)
Libretto von Hector Berlioz nach Vergils Aeneis
Besetzung
Cassandre Alice Coote
Énée Michael Spyres
Didon Paula Murrihy
Chorèbe / Sentinelle I Lionel Lhote
Ascagne Adèle Charvet
Panthée / Griechischer Anführer Ashley Riches
Anna Beth Taylor
Iopas / Hylas Laurence Kilsby
Hécube Rebecca Evans
Hector / Sentinelle II / Mercure / Narbal Alex Rosen
Priam Tristan Hambleton
Helenus Graham Neal
Un soldat Sam Evans
Monteverdi Choir,
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
Dinis Sousa – Leitung
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


