
Ein kontroverser Song, ein starkes Album, historische Meilensteine, überraschende künstlerische Konstellationen: Die Reihe Pop-Splitter gibt unkonventionelle Einblicke in die wundersame Welt der Popkultur.
Das Corona-Desaster hat dramatische Entwicklungen beschleunigt, darunter auch diese: Die Techno-/House-getriebene Clubkultur ist historisch geworden. Zunehmend wehmütig und ergriffen vom jeweils eigenen fantastischen Beitrag beginnen DJ-, Booker-, Feier- und Medien-Persönlichkeiten, auf gut drei Jahrzehnte Rave & Roll zurückzublicken. Während man in Frankfurt am Main bald ein Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) eröffnen will und mit „Electronic Germany“ schon einen Abriss der bundesrepublikanischen Technokultur vorgelegt hat, feiert „Blumenbar“, eine Marke des Berliner Aufbau Verlags, das 20-jährige Jubiläum von „Electronic Beats“ – der außergewöhnlichen Subkulturmarke des Telekom-Konzerns. „Electronic Beats“, Mitte März erschienen, entpuppt sich als schwergewichtiger Bild- und Essay-Band, der es in sich hat.
Für alle, die keine Lust auf längere Lesezeit haben, sondern einfach nur wissen wollen, ob das Buch meiner Meinung nach was taugt: Ja, es taugt was. Mit seinem raufasertapetenartigen Einband samt vieldeutiger Inschrift „Feelings aren’t final“ (Gefühle sind nicht endlich/endgültig/rechtskräftig) und dem teilweise starken Bildmaterial im Innenteil taugt es sogar zum eleganten Geschenk; aber natürlich sind es die Inhalte und die Leidenschaft für sein Thema, mit denen dieses Werk in erster Linie punktet. Als eigenwilliger Mix aus rauem Kunstband, schickem Coffeetable-Book und gehaltvollem Journalismus setzt „Electronic Beats“ der elektronischen (Club-)Musik ein gedrucktes Denkmal. Das kommt nicht ganz überraschend in einer Zeit, da Corona besiegelt, was sich vorher bereits abgezeichnet hatte: das vorläufige Ende einer Rave- und Clubkultur, wie sie in den Neunziger- und Zehnerjahren von Höhepunkt zu Höhepunkt eilte.
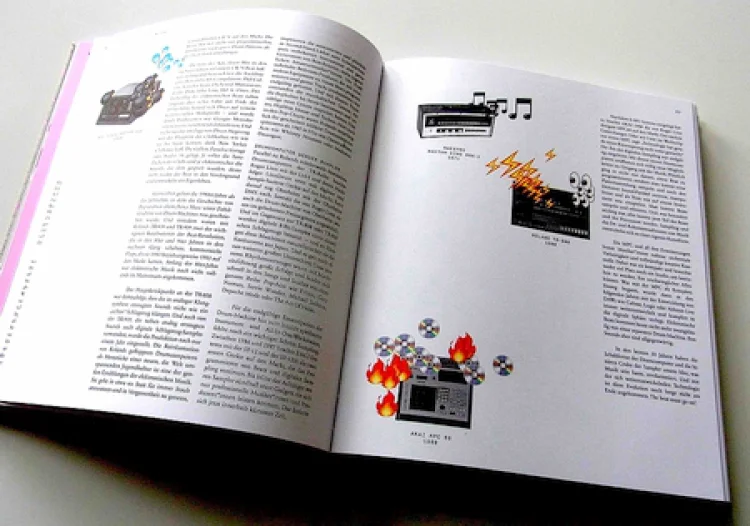
Die Marke „Electronic Beats“
Doch von vorn: „Electronic Beats“ ist kein irgendwie zufällig gewählter Buchtitel, sondern eine über 20 Jahre hinweg etablierte und gepflegte Marke. Dahinter steht, man glaubt es kaum, der Telekom-Konzern. Was im ersten Moment irritiert, folgt einer inneren Logik. Seit jeher versuchen große Konzerne, immer wieder neue und vor allem junge Zielgruppen zu erschließen. Und seit jeher bieten Lifestyle und Musik dafür gute Anknüpfungspunkte. Doch wo andere Unternehmen höchstens sponsern, eine Veranstaltung „präsentieren“ oder Stars für Promoaktionen gewinnen können, hat die Telekom spätestens seit Beginn der Digitalisierung und dem Siegeszug des Internets einen entscheidenden Vorteil: Sie war und ist unmittelbar in den popmusikalischen Austausch involviert. Wann immer räumlich getrennte Künstler:innen sich gegenseitig Soundfiles zwecks Komposition von Tracks zuschicken, wann immer Websites auf- und Podcasts abgerufen, Songs gestreamt oder Livekonzerte via Internet übertragen werden, liefert der deutsche Telekommunikationsriese die nötige Infrastruktur: Musik als Träger von Ideen – die Telekom als Trägerin von Musik. Was lag da näher, als selbst eine popkulturelle Marke ins Leben zu rufen, die sich vor allem auf elektronische Musik konzentriert: „Electronic Beats“ war geboren.
Die große Leistung der Telekom, über die man als kleiner Festnetz- oder Mobil-Kunde ja gern mal flucht, bestand nun darin, einen im Grunde simplen, aber oft ignorierten Sachverhalt zu beherzigen: Nichts ist wertvoller als Glaubwürdigkeit. Und so holte man kompetente Leute aus der Szene ins Boot, statt rasch ein seelenloses Marketingprodukt in die Welt zu setzen und die Zielgruppe noch rascher zu vergraulen: Musikjournalist:innen, DJs, Booker:innen oder Designfreaks, kurz: renommierte kreative Köpfe aller Disziplinen schlugen bei dem Branchengiganten auf und durften, tatsächlich, einfach machen. So nahmen unter dem Label „Electronic Beats“ fundierte DVD-Musikmagazine, Printmagazine, Festivals, eine Onlineplattform, Podcasts, virtuelle Konzerte oder ein Youtube-Kanal schillernde Gestalt an. Wo es kaum ästhetische oder inhaltliche Beschränkungen zu geben scheint, entsteht Raum zum Experimentieren, auch mal zum Scheitern oder zum Über-die-Stränge-Schlagen. Und so genießt „Electronic Beats“ bis heute ein hohes Maß an Credibility in der Szene. Die Angebote werden von den Fans genutzt, und nicht nur Underground-Helden wie Peaches, Carl Craig oder Hercules and Love Affair, auch Topstars von Gorillaz bis Billie Eilish, von Underworld bis The Prodigy gingen schon für die Telekom-Marke auf die Bühne. Entsprechende Festivals expandierten dann zunehmend nach Osteuropa, wo die Ravekultur auch Minderheiten, etwa der LGBT-Szene, die Möglichkeit bietet, sich auszudrücken, also verstärkt politische Kraft entwickelt. Diversität wird bei den Macher:innen von „Electronic Beats“ großgeschrieben – es ist in der Tat eine verwegene, zukunftsorientierte Marke, die der Kommunikationskonzern da unter seinem Dach hat erblühen lassen.

Kluger, abwechslungsreicher Mix
Nun könnte man erwarten, dass der Jubiläumsband zum 20-jährigen Bestehen ganz auf aufwendig gemachte Selbstbeweihräucherung setzt. Aber nichts da. Statt bunter Bildchen, gut abgehangener Porträts und euphorischer Rückblicke präsentiert das Buch einen klugen, abwechslungsreichen Mix aus Szene-Interviews, ungewöhnlichen Reportagen, taffen Gesprächsrunden und tiefschürfenden Essays. Dabei begibt er sich häufiger auf so etwas wie die Metaebene, um dem Lesepublikum Erkenntnisgewinn zu vermitteln. Letztlich bekommt man einen Eindruck davon, wie die Rave- und Clubszene tickt, was die Faszination des Auflegens, die Faszination des Kontrollverlusts beim Tanzen ausmacht, wie elektronische Beats musikhistorisch einzuordnen sind, welche Synthesen sie mit Computergames eingehen, sogar welchen Zwängen die mediale Berichterstattung über Clubkultur ausgesetzt ist und wie es nach der Corona-Pandemie weitergehen könnte. Es ist ein mit Herz und Verstand zusammengestellter Rundumschlag, der Interessierten die Augen öffnet und selbst Insidern noch einiges an interessanten Informationen bieten dürfte.
Zu Beginn erzählt eine geschickte Collage aus O-Tönen der Macher:innen, wie sich das „Electronic Beats“-Universum Schritt für Schritt entwickelt hat. Für gute Laune sorgt ein Elder-Statesman-Talk zwischen Bryan Ferry und Dieter Meier (Yello), bevor zwei unkonventionelle Reportagen nachdenkliche Akzente setzen: In Kalabrien gibt es unter dem Stichwort „Tarantella“ rituelle Lieder und vor allem Tänze, in denen Mitglieder krimineller Banden miteinander kommunizieren, auch Konflikte austragen. So etwas liest man nicht jeden Tag … Im repressiven Georgien wiederum hat sich ein wegen eines Bagatelldelikts verurteilter DJ und Veranstalter im Knast zu einem Producer entwickelt. Ein dezidiertes Musikkapitel beleuchtet unter anderem die interessante Geschichte der Drum Machine und nennt Pionierinnen der elektronischen Musik: Namen und Zusammenhänge, die zum Weiterrecherchieren anregen. Schauspieler Lars Eidinger wird dann auch noch interviewt, und ja, das ergibt Sinn – ist er doch selbst als DJ aktiv und genießt wegen seiner schrägen Auftritte in Musikvideos von Deichkind zusätzlichen Kultstatus. Allerdings: So wunderbar Eidinger spielt, so spätpubertär wirkt manches, was er jenseits von Bühne und Filmset von sich gibt. Das Gespräch mit „Electronic Beats“ ist einigermaßen informativ und erträglich, doch auch hier macht er selbstverliebt auf „Ich bin anders, ja beinahe selbst ein Kunstwerk“. Zitat: „Mir macht es am meisten Spaß, erst beim Reden Gedanken überhaupt zu verfassen. Ich fordere mich dabei selbst – und hatte schon immer Freude daran, mal die genaue Gegenposition einzunehmen von dem, was ich eigentlich denke. (…) Ich bewundere diejenigen, die im Lauf eines Gesprächs ihre Meinung ändern.“ Ach, Lars … Wie bodenständig und berührend sind dagegen die an anderer Stelle im Buch wiedergegebenen Erinnerungen von Ellen Allien oder die Aussagen und Lebensgeschichten einer Barfrau, eines Hausmeisters, eines künstlerischen Leiters und anderer Club-Persönlichkeiten, die von Heimatverlust und Existenzangst im Angesicht der Corona-Pandemie erzählen.

Starke Marken, starker Druck
Wieder aufschlussreicher wird es im Kapitel „Marken“: Wir erfahren, dass und warum klassische Musik-Labels an Bedeutung verloren haben; dass auch moderne Protestbewegungen wie „Fridays for Future“ und „Black Lives Matter“ als starke Marken funktionieren, obwohl ihre Repräsentant:innen das selten so sehen wollen; und dass selbst Superstar Beyoncé bei allen Ansätzen zum Ausverkauf einen Hauch an feministischer Inspiration ins Publikum rettet. Wie aufrechte Journalist:innen und Musikmedien bei sinkenden Reichweiten und geringeren Verdienstmöglichkeiten damit umgehen, dass große Unternehmen den PR-Druck erhöhen, erörtert eine spannende Diskussionsrunde, auch vor dem Hintergrund, dass heute via „Social Media“ praktisch jede:r als Medium senden kann – dass wir zu so etwas wie einer „redaktionellen Gesellschaft“ mutieren.
Daran knüpft nahtlos das Kapitel über Vernetzung und Kommunikation an. Die Ravekultur in Osteuropa als befreiender, als politischer Akt ist ein ebenso spannendes Thema wie der Aufstieg der Rapmusik an den herkömmlichen Medien vorbei. Nach dem Lesen dieses Beitrags versteht man etwas besser, wieso Gangsta-Rap regelmäßig an der Spitze der Charts rangiert, ohne dass das fragwürdige Zeug im Radio läuft. Von Honey Dijon hatte ich persönlich noch nie etwas gehört, ein von schicken Schwarz-Weiß-Porträts begleitetes Gespräch weckt aber Interesse an den Clubsounds und dem politischen Engagement des Transgender-Stars. „Wie die Musik aufs Handy kam“, „Vernetzte Musikproduktion“ und „Vom Buchdruck zum Stream“, das sind selbsterklärende Titel für lehrreiche Essays, die den historisch-theoretischen Background beleuchten und zeigen, welchen Veränderungen die Musik der letzten 20 Jahre unterworfen war.

Räume für die Zukunft
Den Aspekt des radikalen Wandels spinnt dann auch das letzte Buchkapitel „Räume“ weiter. Unter anderem erörtert es ein faszinierendes Konzertevent im Rahmen einer Fantasy-Computerspielwelt: Im April 2020 ließ Rapper Travis Scott tatsächlich seinen Avatar live im Rahmen des Onlinespiels „Fortnite“ auftreten, inklusive Präsentation eines neuen Tracks. Sage und schreibe 27,7 Millionen Menschen schauten zu, einfach unglaublich. Astronomical, noch heute auf YouTube zu bewundern, lässt erahnen, was im nächsten Jahrzehnt an weiteren verrückten Musikentwicklungen auf uns zukommen könnte. Skeptisch war ich bei einem Beitrag über Clubs als Kirchen von heute – der Text der aktuellen „Electronic Beats“-Chefredakteurin Whitney Wei stellt dann allerdings erstaunliche Bezüge und Assoziationen her. Damit unterstreicht er, was gerade durch Corona verloren geht. Werden sich nach der Pandemie die Gagen-Exzesse der letzten Jahre erledigt haben? Werden die Line-ups in Clubs regionaler? Und inwieweit wird die Clubkultur überhaupt überleben? Das sind Fragen, die eine abschließende Gesprächsrunde erörtert. Und dann ist der letzte Track verklungen. Das Licht geht an, wir müssen zurück in den Alltag. Ein schwermütiger, aber ehrlicher Kehraus.
„Keine Serendipität …“
Es sind der Mut zu unkonventionellen Ansichten, ein Bewusstsein für historische Kontexte, fundiertes Expert:innenwissen und eine klare politische Haltung, die dieses Buch so lesenswert machen. „Electronic Beats“ kommt mit einer Ernsthaftigkeit daher, die beeindruckt. Genau diese Ernsthaftigkeit aber, und damit sind wir bei den Schwachpunkten aus meiner Sicht, wirkt ab und an befremdend. In anderen Worten: Nur Bryan Ferry und Dieter Meier dürften dem Lesepublikum ein Schmunzeln entlocken, der Rest ist komplett humorfrei. Wo bleibt der Spaß? Und: Vielleicht hätte hier und da auch ein Schuss Selbstironie gutgetan. Dahinter, so mein Eindruck, steht das Bemühen, der elektronischen (Club-)Musik höhere Weihen angedeihen zu lassen, sie als würdigen Gegenstand akademischer Forschung zu etablieren. Vielleicht auch Stolz und das Bedürfnis, dem Auftraggeber gegenüber die eigene Daseinsberechtigung zu formulieren. À la: Ihr könnt sicher sein: Ihr finanziert da eine total wichtige Sache, ihr finanziert Hochkultur! Fun und Rausch, aber leider auch die Begleiterscheinung, dass man es in der Clubkultur gelegentlich mit einfach nur zugedröhnten jungen Menschen zu tun hat, werden da möglicherweise bewusst ausgeblendet. „Dass ausgerechnet der ehemalige Staatskonzern Telekom mit Electronic Beats eine der zentralen Plattformen der elektronischen Musikkultur etabliert hat, ist keine Serendipität und zugleich eine Geschichte voller interessanter Wendungen und glücklicher Entscheidungen“, schwelgt Ji-Hun Kim, Ex-Chefredakteur von „De:Bug“ und Redaktionsleiter „Das Filter“, im Vorwort. Als verantwortlicher Konzeptioner und Redakteur des „Electronic Beats“-Jubiläumbandes feiert er am Ende des kurzen Texts „das Entwickeln neuer Narrative und auch das persistente Führen aktueller Debatten“. Holla! Ich habe das Große Latinum und, hey, ein Studium absolviert, aber das Wort „Serendipität“ musste ich nachschauen. Es bedeutet „Zufälligkeit“. Wie banal. Mit Blick auf den schillernden Gegenstand von „Electronic Beats“ und die abgebildete Partyszene wirkt das Wort ebenso fehl am Platz wie das Geschwurbel um Narrative und persistente, sprich: anhaltende Debatten. Da schwört die Redaktion Stein und Bein auf Diversität und Gleichberechtigung, erhebt sich aber gerade sprachlich klar über das Durchschnitts-Clubpublikum. Bestimmt keine Absicht, aber auch eine Form von Ausgrenzung.
Richtig problematisch wird das bei Jens Gerrit Papenburg, seines Zeichens Professor für Musikwissenschaft und Sound Studies. Eigentlich beackert er in seinem Essay „Bewirtschaftung der Zukunft“ ein spannendes Thema, nämlich die Art und Weise, wie Big Data, Streamingdienste, Empfehlungsalgorithmen und aktive Kopfhörer unseren Musikkonsum verändern. Was er dann aber auf vielen Buchseiten über sogenanntes „Soundfilehören“ zu Papier bringt, ist anstrengendster elitärer Wissenschaftsjargon, hinter dem das Thema buchstäblich verpufft. Kostprobe: „Eine Bewirtschaftung des Musikhörens begreift das Hören als Ressource und als ökonomisches Problem. Als Ressource soll es exploriert werden, dabei aber nicht nur als Bestandteil einer vordergründigen Aufmerksamkeitsökonomie nutzbar gemacht werden. Zudem sollen die Ohren auch für die affektiven Hintergründe sensibilisiert werden. Jedoch umfasst Bewirtschaftung neben Ökonomisierung immer auch eine zweite Hälfte: die Kultivierung respektive Kulturalisierung. (…) Eine Bewirtschaftung des Hörens umfasst neben Ökonomie und Medien immer auch schon Kultur und Ästhetik.“ Uffz … Vielleicht lassen sich mit Texten dieser Art wissenschaftliche Fachpublikationen erfolgreich bewirtschaften – für „Electronic Beats“ hätte Papenburg seine Thesen in verständliche Sätze kleiden sollen.
Publikumsnäher, dafür ohne wirklichen roten Faden kommt ein Text des DJs, Label-Betreibers und Producers Daniel Wang daher. Wang versucht sich an einem „Plädoyer gegen das Mittelmaß auf dem Dancefloor“ und hat eigentlich im Spitztitel schon alles gesagt. Beim Versuch „die Evolution der populären Musik“ nachzuzeichnen, verzettelt sich der ansonsten sehr sympathisch wirkende Fachmann gehörig zwischen Trio, Wagner, Fela Kuti und YMCA. Das wirkt vor allem prätentiös, erst recht mit Blick auf die simple Message seines Beitrags: Mehr Musikalität, mehr Qualität in der Dance-Musik bitte! Der Wunsch nach einer strenger redigierenden Hand drängt sich schließlich auch beim Lesen des Interviews mit Billie Eilish auf. Klar haben wir es mit einer hochbegabten Teenager-Künstlerin zu tun – aber man muss dem Gespräch doch nicht diesen blödsinnigen BRAVO-/Onkel-Touch geben. „Wie geht es dir? Was machst du im Moment? Was sind die Namen deiner Welpen? Was war die beste Entscheidung, die du in deiner Karriere getroffen hast? Hast du konkrete Ziele oder Träume, denen du nacheiferst? Vielleicht sollten mehr Leute Pitbulls adoptieren?“ Derek Opperman stellt tatsächlich diese Fragen: Wo Herr Papenburg eine lupenreine Überperformance liefert, erreicht er unterirdisches Niveau.
Let’s talk about Handwerk
Das war’s aber auch schon an Beiträgen, die mich irritiert haben. Drei Ausrutscher? Auf 300 Seiten eine verschwindend geringe Zahl! Bleiben ein paar handwerkliche Dinge, die ich nicht schön finde, die aber letztlich zu verkraften sind: die fehlenden Porträts der Gesprächsrundenteilnehmer:innen – man würde doch gern auch mal sehen, wer da spricht; Doppelseiten, die nur aus Text bestehen und beim Lesen ermüden; gelegentlich weiße Schrift auf pechschwarzem oder leuchtend rotem Untergrund, eine Belastung für die Augen; schwarze Bildunterschriften über quietschbunten Fotos, nur durch Zufall zu erkennen – das hätte man von den renommierten Designern Meiré und Meiré nicht erwartet; und überraschend viele Kommafehler, der eine oder andere vertrackte Satz – bezeichnenderweise sind Lektor:innen im Impressum nicht aufgeführt. Dabei sind sie extrem wichtig für eine Buchproduktion, und auch sie brauchen Aufträge. In Corona-Zeiten mehr denn je.
Letzter Kritikpunkt: die auffällige Hauptstadtlastigkeit. Über die gesamte „Electronic Beats“-Produktpalette hinweg mag das anders sein, aber im Jubiläumsband wird sie spürbar. Die überwiegende Zahl der Mitwirkenden „lebt“ oder „lebt und arbeitet in Berlin“, großen Raum nimmt die dortige Szene ein, zum Beispiel der „Tresor“. Wenn aus dem Rest der Republik lediglich ein Augsburger Club oder das Offenbacher Housejuwel „Robert Johnson“ hier und da erwähnt werden, ansonsten London, Chicago oder New York und eben Berlin als „Electronic Beats“-Zentren erscheinen, muss man als Frankfurter schon mal schmunzeln. In der Mainmetrole, die einen nicht unbedeutenden Beitrag zur globalen Clubkultur der letzten 30 Jahre geleistet hat, entsteht gerade das MOMEM – das Museum of Modern Electronic Music –, und aus der Mainmetropole hat vor nicht allzu langer Zeit Christian Arndt die ebenfalls monumentale Buchveröffentlichung „Electronic Germany“ in die Welt geschickt. Weniger theoretisch, eher dokumentarisch, letztlich offener. Aber lassen wir das, über Blasen und den leichten Hang zum Nerdtum sollen andere urteilen. Feiern wir lieber die vielen anregenden, lehrreichen, erhellenden und beeindruckenden Seiten dieses Buchs, das in Anbetracht der Qualität, die es bietet, einen mehr als fairen Preis verlangt. 4 von 5 Sternen, 8 von 10 Punkten, 4 to the floor!
Letzte Änderung: 14.08.2021


Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


