
SEITENWECHSEL heißen Tagebuchnotizen aus dem Rheinland, aus Riga, Portland, Oregon; aus Barcelona und Kathmandu. David Oates ist einer von sechs Autorinnen und Autoren des aktuellen SEITENWECHSELS, der von Faust-Kultur aufgenommen wird. Ein Albtraum in der Silvesternacht verbindet sich auf wunderbare Weise mit der Erinnerung an eine lebensgefährlichen Szene und mit einem Gedicht, das er vor einem halben Jahrhundert hörte und vor dem Jahreswechsel wiederfand.
Ich beginne das Neue Jahr in einem Traum, in dem Steine fallen, einen Berg herunter auf mich zurollen.
Doch als ich zu mir komme, finde ich mich in Santa Fe, New Mexico, wieder: einer wohlhabenden Kleinstadt, die sich über ein mit Wüstenbeifuß bewachsenes und von höheren Bergen umgebenes Hochplateau verteilt. Die hiesige Geschichte ist eine von Konquistadoren, Unterjochung und Ausdauer. Erst die Spanier, dann die Mexikaner. Dann die Amerikaner.
Die frische Luft und die klar umrissenen Schatten von zweitausendzweihundert Metern Höhe. Überraschende Mengen von Geld hier, in peinlicher Koexistenz mit tief verwurzelter Armut bei den indianischen Ureinwohnern und Pueblos, die seit tausend Jahren an dieser Stelle stehen. Deren Bewohner weichen nicht zurück, noch zeigen sie sich gefügig, indem sie „verschwinden“. Sie werden hier sein, wenn wir endlich gehen.
Und heute überraschende Mengen von Schnee. Zehn Zentimeter Watte über Nacht, die Gehwege zu dieser frühen Stunde noch unberührt und alle Zaunpfähle wie Törtchen mit einem Turm aus Zuckerguß obendrauf.
Häuser im Adobe Stil mit abgerundeten Ecken, die etwas von breiten Hüften haben, und dicken niedrigen Gartenmauern säumen die Straße, alles im traditionellen irdenen Ocker oder rosafarbenen Orange, jetzt hübsch zur Geltung gebracht durch weiße Linien auf jeder geschwungenen Oberfläche. Kleine Tore in Mauern direkt am Gehweg. Alles mit Puderzucker bestäubt.
Und trotz meiner anstrengenden Traumnacht hallt es in meinem Kopf noch wider vom vergangenen Abend in „The Lensic“, Santa Fes charmanter großer kleiner Konzerthalle mit verschnörkeltem Stuck: ein gesponsertes, nur an Silvester auftretendes Orchester mit einem Dirigenten voller Energie und Präzision, Joe Illick, der in diesem Jahr ein irgendwo zwischen kitschig und genial angesiedeltes Programm zusammengestellt hat. Als Erstes die berühmte Finlandia von Sibelius.
Wer sich durch Finlandia nicht erbauen lässt, sollte keine Konzerte mehr besuchen.
Dann die geniale Kuriosität: eine „kuratierte“ Zusammenstellung nur für diesen Abend, bei der zwei getragene Sätze aus dem Mozart-Requiem als Einleitungen in dem berühmten vierten Chorsatz von Beethovens Neunter Symphonie, der „Ode an die Freude“, gipfelten. Da kamen das ganze Ausmaß und Streben dieses größer als großen Stückes zum Tragen. Die Solisten exzellent. Und der Chor im Höhenflug.
So wurde das neue Jahr mit einer Zuversicht – einem Optimismus – begrüßt, die kaum zu rechtfertigen ist. Doch für diese paar Stunden erschien die gesamte Menschheit erreichbar. Brüderlichkeit. Schwesterlichkeit. Kreatürliche Solidarität. Warum nicht?
***
Als ich ungefähr zwanzig war, arbeitete ich im Rahmen eines miserabel dotierten Programms, das sich lose an dem bekannten „Outward Bound“ orientierte, als Bergführer und Kletterlehrer in der kalifornischen High Sierra. Unser Ausbilder war ein charismatischer Bursche, der uns auf einen Granitgipfel in der Great Western Divide, einer Aneinanderreihung von Viertausendern, führte. Wir hatten einen Punkt erreicht, an dem ein Blockfeld in nackte Felswände überging. Es war die Art von „Steilwand“-Klettern, bei der man sich nicht unbedingt anseilen muss – allerdings nach der Maßgabe: „Bloß nicht fallen!“
Mein gestriger Traum stammt von diesem Tag, dieser Wand. Unser rund fünfzig Meter vor uns kletternder Ausbilder hatte einen instabilen Felsbrocken ausgemacht und beschlossen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, indem er ihn eine benachbarte Rinne hinunterschickte.
Er schubste ihn in eine Richtung, doch nachdem der Brocken auf den nächsten drei Metern beschleunigt hatte, prallte er (wie Sie sicher schon geahnt haben) in die falsche Richtung ab: geradewegs den Hang hinunter, an dem wir uns abmühten. „ACHTUNG STEIN!“, erscholl der entsetzte Warnruf unseres Anführers: STEIN STEIN STEIN STEIN STEIN!!!
Ich war der Oberste. Ich sah, dass der trudelnde Brocken geradewegs auf mich zustürzte. Dabei war ich in meinen Bewegungsmöglichkeiten durch steile Abhänge und Felsnasen stark eingeschränkt. Aber wir befanden uns nun mal an einem felsigen Hang. Meine Sicht verlangsamte sich zur Zeitlupe. Der Brocken flog in einem merkwürdigen, majestätischen Tempo. Es schien, als hätte ich jede Menge Zeit. Während das Ding näherkam, ließ ich mich hinter einen Felsen von der Größe eines VW-Käfers fallen. Ich hörte – und spürte – den Aufschlag, sah das immer noch intakte Geschoss über mir abprallen und den Berg hinabstürzen. Die anderen Kletterer verfehlte es ebenfalls.
So ein Traum, so eine Erinnerung. Ist das am Neujahrstag ein gutes oder ein schlechtes Omen?
***
Die andere Quelle des Steinschlagtraums letzte Nacht: ein alter Freund, der aus dem Nichts wieder auftauchte. Unverändert!
Am letzten Tag des Jahres war ich früh aufgestanden. In dem stillen, gemieteten Haus in Santa Fe erwartete mich ein normaler Wintertag. Noch kein Schnee. Ich packte mich warm ein, kochte mir starken Tee und setzte mich an meinen gewohnten Platz, um mir ein paar Gedichte genauer anzusehen.
In dieser Woche hatte ich mich eingehend mit dem schwedischen Dichter Tomas Tranströmer beschäftigt. Mehr als ein Jahrzehnt ist seit seinem Nobelpreis vergangen, und erst jetzt arbeite ich sein Werk (in Übersetzung) auf.
Und in einem Abschnitt mit Gedichten aus den Mittsechzigern entdecke ich ein Artefakt meines eigenen inzwischen steinalten literarischen Lebens, ein Gedichtfossil. Daran hängen, wie DNA von urzeitlichen Mammuts, immer noch Gefühle, die bislang nicht zu Fossilien geworden sind. Mit einem gewissen Erstaunen sah ich vor mir das Gedicht mit dem Titel „Allegro“, in dem der Dichter nach einem „schwarzen Tag“ die Hände in seine „Haydntaschen“ steckt und auf den Tasten so etwas wie eine „lebhafte, grüne … Stille“ entdeckt. Ruhe umgibt ihn.
„Ich hisse die Haydnflagge – das bedeutet:
‚Wir ergeben uns nicht. Sondern wollen Frieden.‘
Die Musik ist ein Glashaus am Hang,
wo die Steine fliegen, die Steine rollen.
Die Steine rollen quer hindurch,
doch jede Fensterscheibe bleibt ganz.“
Dieses Gedicht kannte ich. Ich hatte es fünfzig Jahre zuvor bei einer Lesung an meiner Universität gehört. Und seitdem immer wieder daran gedacht und mich gefragt … Was war das für ein Gedicht? Wer hat es uns vorgetragen? Die Taschen. Das Verlangen nach Frieden. Die Steine, die harmlos hindurch rollen.
Mein Gehirn arbeitet so. Es kann sein, dass ich mich an jemanden, den ich vor zehn Minuten kennengelernt habe, nicht erinnere. Aber Sprache haftet an mir wie Kletten an Socken. Man nenne mir ein gutes Wort, und es wird Jahrzehnte später genau dann wiederauftauchen, wenn der Satz, an dem ich arbeite, es verlangt. Das finde ich wirklich erstaunlich.
Heute am Neujahrstag greife ich das Gedicht, das ich erst gestern wiederentdeckt habe, noch einmal auf. Und ich denke an den Haydn, den ich in diesem vergangenen Jahr auf dem Klavier gespielt habe, mit seiner Tempoangabe von äußerstem Charme: Allegretto Innocente.
Das sind meine Marschbefehle für dieses neue Jahr. Lass die Steine rollen, wie sie wollen, wie sie müssen. Aber arbeite an Transparenz. Gelassenheit. Freude.
Lass die Unschuld beginnen. Das Allegretto Innocente.
Aus dem Amerikanischen von Juliane Gräbener-Müller
Letzte Änderung: 27.06.2022 | Erstellt am: 27.06.2022
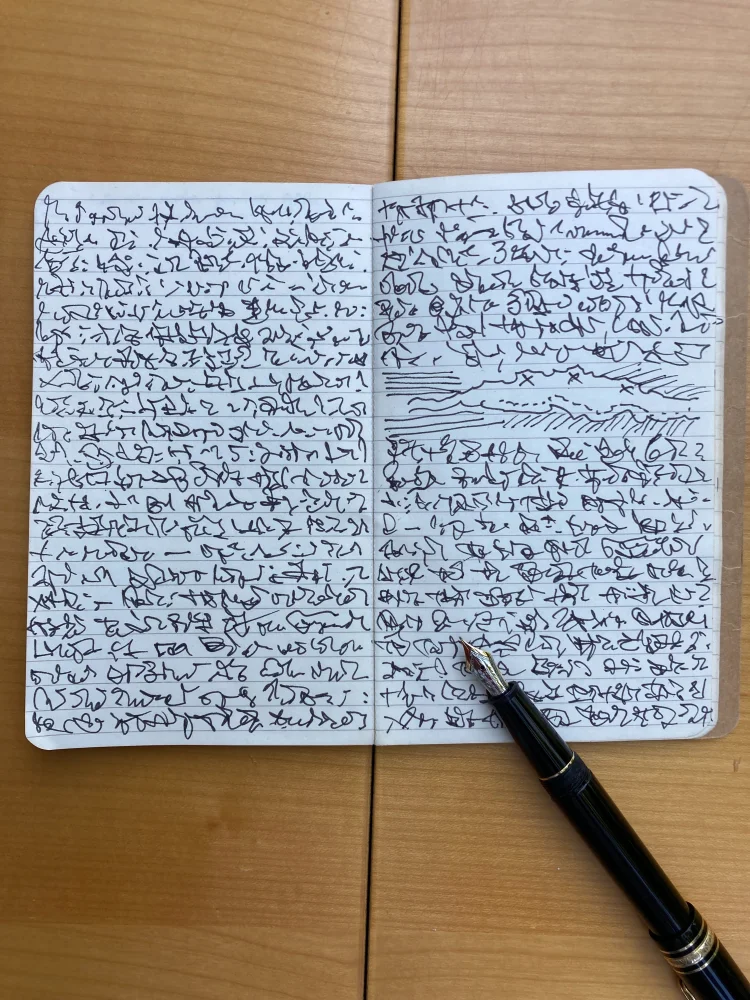
Geschrieben werden Tagebuchnotizen, die zeitgleich an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern entstehen und in der WORTSCHAU veröffentlicht werden. An einem bestimmten (vorgegebenen) Tag machen sich sechs Autorinnen und Autoren Notizen darüber, wo sie sich an diesem Tag aufhalten, woran sie arbeiten, was sie erleben, wie sie sich durch den Tag bewegen und was sie bewegt. Jeder und jede ist jedoch frei, eine poetisch-verfremdete Wahrheit oder wirklich an diesem Tag Erlebtes aufzuschreiben.
Auf diese Art entsteht simultan ein Tagebuch, das einen vielschichtigen Blick auf eine jeweils individuell erfahrene Welt wirft. Was alle vereint und auch den tieferen Anlass des Seitenwechsels ausmacht, ist der genaue Tag, auf den alle sich beziehen. Das öffentliche und private Geschehen dieses Tages an ganz unterschiedlichen Orten mit seinen Chancen und Gefahren geben den gemeinsamen Fokus vor.
Die erste Folge startete mit einem Montag (dem 19. Juli 2019), die zweite mit einem Dienstag etc. Dem sich wiederholenden Prinzip der festgelegten Tage, die sich dem Wochenablauf anpassen, entspricht der simultane Perspektivwechsel. Das macht den Reiz des Projekts aus.


