Textur der Vergänglichkeit

Der Einbruch der Leidenschaft in das behütete Leben, das ist nicht nur ein Werther-Thema, sondern unterliegt dem sogenannten bürgerlichen Roman wie ein unterirdischer Vulkan. Dass Thomas Mann diesem Sujet mehr als zugeneigt war, obwohl er sich selbst eher als Beobachter sah, machte das Spiel mit der Leidenschaft noch reizvoller. Otto A. Böhmer zum Selbstverständnis des Schriftstellers.
Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 als zweiter Sohn des Kaufmanns und Senators Thomas Johann Heinrich Mann und der „außerordentlich schönen“, aus Brasilien stammenden Julia da Silva-Bruhns in Lübeck geboren. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1891 muss die elterliche Firma aufgelöst werden, da der Senator, wie das Testament enthüllt, seinen Söhnen nicht zutraut, unternehmerisch tätig zu sein. Die Firmenschließung ist mit finanziellem Zugewinn verbunden; der Familie Mann geht es, zumindest was ihre ökonomische Existenzgrundlage betrifft, ein Leben lang gut.
Brüder-Konkurrenz
Zu seinem älteren Bruder Heinrich, der sich noch vor ihm für eine Künstlerlaufbahn entscheidet, baut Thomas ein besonderes Spannungs- und Konkurrenzverhältnis auf: Zunächst ist Heinrich deutlicher erfolgreicher, dann holt der Jüngere, der in der zehnten Klasse das Gymnasium verlässt und keinen ordentlichen Studienabschluss zuwege bringt, merklich auf und avanciert mit seinem Erstlingsroman „Die Buddenbrooks“, der 1901 in zwei Bänden erscheint und ihm 1929 den Literaturnobelpreis einbringt, zum berühmten Autor.
Thomas Manns Selbstfindung wird von frühen Erfahrungen auf den Weg gebracht: „Nach meinem Werden als Künstler, der Geschichte meines Künstlertums gefragt, frage ich mich nach seiner Wurzel, seinen frühesten Keimen und Regungen, und ich finde sie in meinen Kindheitsspielen.“
1897 in Italien, genauer „in Palestrina in den Sabinerbergen“, erfolgt eine erste litera-rische Ergänzung. Thomas Mann schreibt die Erzählung „Der kleine Herr Friedemann“, die ein Thema behandelt, das Mann in der Folgezeit nicht mehr losgelassen hat: „Diese melancholische Geschichte des kleinen Buckligen stellt auch insofern einen Markstein in meiner persönlichen Geschichte dar, als sie zum erstenmal ein Grundmotiv anschlägt, das im Gesamtwerk die gleiche Rolle spielt wie die Leitmotive im Einzelwerk. Die Hauptgestalt ist ein von der Natur stiefmütterlich behandelter Mensch, der sich auf eine klug-sanfte, friedlich-philosophische Art mit seinem Schicksal abzufinden weiß und sein Leben ganz auf Ruhe, Kontemplation und Frieden abgestimmt hat. Die Erscheinung einer merkwürdig schönen und dabei kalten und grausamen Frau bedeutet den Einbruch der Leidenschaft in dieses behütete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und den stillen Helden selbst vernichtet.“
Keine Existenz fügt sich auf Dauer ganz der Ordnung, die ihr auferlegt wird; eine Überzeugung, die Thomas Mann schon als junger Mann gewinnt. Es ist keine beruhigende, eher eine zwiespältige Überzeugung; man kann sich an ihr literarisch abarbeiten, kann ein Erzählwerk darauf gründen, das den Eindruck erweckt, als sei es aus sicherer Distanz geschrieben, obwohl eine solche Distanz nicht gegeben ist; sie wird nur vorgetäuscht, so wie jede Lebensordnung nur vorgetäuscht wird, wenn man übersieht, dass sie auf einer willkürlichen Übereinkunft beruht und, notwendigerweise, gefährdet bleibt.
Thomas Mann hat diese Gefährdung am eigenen Leibe gespürt; er weiß um eine heikle Veranlagung in sich und begegnet ihr mit künstlerischer Wertedisziplin. Die Familie hilft ihm dabei, mehr noch ein bis ins Kuriose durchreglementiertes Berufs- und Verfahrensethos, aus dem er schließlich ein gewaltiges Lebenswerk bezieht, in welchem sein Autor präsent ist und doch nicht mehr von sich preisgibt als ein versierter Fremdenführer, der davon ausgehen darf, unentbehrlich zu sein.
Vorbild Goethe
Die Gefährdung, die den Menschen begleitet, erweist sich als unverzichtbar; öde und fahl würde sein Leben, schlaubergerhaft abschnurren im Versorgungstrakt, würde ihm nicht gelegentlich der Boden entzogen und würden nicht bisherige Überzeugungen in Frage gestellt. In Thomas Manns vierbändigem Roman „Joseph und seine Brüder“ findet sich das dazugehörige Bekenntnis: „Wie geringfügig ist, verglichen mit der Zeitentiefe der Welt, der Vergangenheitsdurchblick unseres eigenen Lebens! Und doch verliert sich unser auf das Einzelpersönliche und Intime eingestellte Auge ebenso träumerisch-schwimmend in seinen Frühen und Fernen wie das großartiger gerichtete in denen des Menschenlebens – gerührt von der Wahrnehmung einer Einheit, die sich in diesem wiederholt. So wenig wie der Mensch selbst vermögen wir bis zum Beginn unserer Tage, zu unserer Geburt, oder gar noch weiter zurückzudringen: sie liegt im Dunkel vorm ersten Morgengrauen des Bewusstseins und der Erinnerung – im kleinen Durchblick sowie im großen.“
Thomas Mann entscheidet sich früh, ganz der Schriftsteller zu sein, der er schon immer sein wollte. Sein Vorbild, zu dem er häufig zurücklugt, ist Goethe, der nicht nur Schriftsteller, sondern Großschriftsteller war, ferner ein in sich ruhendes Gesamtkunstwerk und unanfechtbare moralische Instanz. Das dazugehörige Leben entfaltet sich, nachdem die Stürme der Jugend gelegt wurden, gravitätisch und mit rechthaberischer Bedachtsamkeit.
Ein solches Leben, dem innere Notwendigkeit keineswegs abzusprechen ist, kann von seiner äußeren Darstellungs- und Repräsentationsform kaum noch unterschieden werden; es hat den literarischen Geist zu Gast und lässt ihn nicht mehr gehen. Thomas Mann wird, nach Goethe, der deutsche Dichter schlechthin; er könnte Einzigartigkeit für sich beanspruchen, belässt es jedoch meist bei launigen Andeutungen.
Seine Literatenexistenz ist breit angelegt; sie dient der Person, steht aber, heißt es, vor allem für die jeweilige Sache ein. Mit Frau und fünf Kindern kommt er, nimmt man andere Schicksale zum Vergleich, merkwürdig unangetastet und ungeschmälert durch politisch brisante Zeiten. 1936 wird er tschechischer Staatsbürger, 1938 geht er in die USA. Auch dort ist er gefragt; er bewohnt wiederum ein repräsentatives Anwesen, muss nicht in eine schäbige Exilantenwohnung umziehen, und der literarische Geist macht gleich wieder Quartier bei ihm. Wahrscheinlich hätte Goethe, wäre er in seinem Leben gezwungen gewesen, nach Amerika zu gehen, also ein leibhaftiger „Ausgewanderter“ zu sein und nicht nur darüber zu schreiben, ähnlich gewohnt.
Seinen Lebensstil behält Mann bei, egal wo er sich niederlässt; Spott und Kritik, die sich an seinem Gehabe entzünden, konnte er ignorieren. 1944 wird er amerikanischer Staatsbürger. Nach Kriegsende braucht er seine Zeit, bis er Deutschland wieder einen Besuch abstatten mag; zu tief sind die seelischen Wunden, die ihm, dem äußerlich Unantastbaren, in seiner Heimat geschlagen wurden. Er lässt sich in der Schweiz nieder; das letzte große Haus, das er sich auf Erden zulegt, ist wiederum geräumig und ansehnlich und steht in Kilchberg bei Zürich.
Als er dort einzieht, hat er längst ein monumentales Lebenswerk zustandegebracht, das nicht nur von schier unglaublichem Fleiß, sondern auch von der Gelassenheit eines Künstlers zeugt, der sich beizeiten davon überzeugt hat, dass sich das große Erzählen auch aus kleinen, fast minderbemittelten Absichten ergeben kann, um dann geradezu herrisch, nach eigenem Gesetz und ohne Rücksicht auf das Kräftemaß des Ausführenden, seinen Gang zu nehmen: „Nicht immer sind es die größten Werke, die mit den größten Absichten geschrieben werden. Im Gegenteil halte ich es für die Regel, dass die großen Werke das Ergebnis bescheidener Absichten waren. Der Ehrgeiz darf nicht am Anfang stehen, nicht vor dem Werk. Er muss mit dem Werk heranwachsen und diesem mehr angehören als dem Ich des Künstlers. Es ist nichts falscher als der abstrakte und vorsachliche Ehrgeiz an sich und unabhängig vom Werke, der bleiche Ehrgeiz des Ich.”
Das Werk bricht sich selber Bahn und findet seine Entsprechung in der „eigentümlich ahnende(n) Seelenverfassung des werdenden Autors, aller werdenden Autoren: dieses geheime Wissen um das Vorhandensein von Kräften, die wohl ihre Zeit brauchen mögen, aber unerschütterlich vorhanden sind“. Wollte man spöttisch sein, so wie es viele waren, die sich an Thomas Mann rieben, der eine Größe hatte, die, aufgrund seiner Außendarstellung, erreichbar schien, bei jeder Annäherung aber zusätzliches Volumen bekam, könnte man sagen, dass er sich zum Vollzugsbeamten seiner selbst machte; er verstand sich auf das Wundersame, auf den Funkenflug der Gedanken, das Tiefe ebenso wie auf den scheinbar oberflächlichen Literaturdienst nach Vorschrift. Und: Er konnte warten.
„Ich ‚erlebe‘ keine Sensationen; im Gegenteil möchte ich sagen: mein Verhältnis zu den Eindrücken des Lebens ist wesentlich passiv, ein unbewusstes Aufnehmen, irgendwie sickern die optischen und akustischen Wahrnehmungen in mich ein, bildet sich in mir ein Fundus menschlicher Züge und Besonderheiten, aus dem ich, wenn die produktive Gelegenheit kommt, schöpfen kann.”
Aus dem Fundus menschlicher Züge und Besonderheiten zog Thomas Mann eine Betrachtungsweise ab, die ihn, mit geschärftem Daseinsblick, Einheit und Heimsuchung gerade dort ausfindig machen ließ, wo sich, in der Summe des Lebens, eigentlich nur noch schiere Notwendigkeit zu erkennen gab: „Das Leben, auch das Künstler- und Schriftstellerleben, ist kein Plan, der ausgeführt wird, es ist die Entwicklung eines Vorgegebenen, die sich vollzieht, und wie es mit einem gehen wird, darauf kann man in der Jugend nur ein dunkles Vertrauen haben; wie es mit uns gegangen ist, das kann man im Alter nur nachdenklich überschauen.“
Gerade der Altersrückblick, von dem man gerne annimmt, er sei gleichsam automatisch mit jener Altersweisheit getränkt, der traditionell unsere Hochachtung gilt, beseitigt liebgewordene Illusionen; zu ihnen gehört auch die Wertschätzung der Individualität. Da jeder Mensch einzigartig ist, verliert sich seine Einzigartigkeit an der der anderen; das individuelle Sein wird abgeschliffen: „Wie wir uns bei bestimmten Anlässen bewegen und benehmen, in welche Formen wir unsere Gefühle und Gedanken kleiden – das ist nicht erstmalige Improvisation, sondern – mehr oder weniger dunkle – Erinnerung, Rückbeugung in die unendliche Abfolge von Vergangenheiten, in die Zeitkulissen, die dem grübelnden Blick immer weiter zurückweichen, ohne dass er ihnen jemals ‚auf den Grund zu kommen‘ vermöchte.“
„Zeit ist Gnade“
Gerade dem Blick zurück, dem grübelnden zumal, bleibt die Zeit auffällig und als Bedachtsamkeitspol gegeben. Der Zeit sind wir unterworfen, auch wenn wir uns in ihr festen Stand zu sichern suchen, der sich am Fraglosen, am Hochglanz freigestellter Momente orientiert. In Gedanken kann sich der Mensch der Zeit entheben, das ist leichter, als man meint; er wird allerdings, aus seinen Besinnungsoasen im Kopf, unfreundlich-schmerzlich in die zeitliche Dürre zurückversetzt, wenn er sich klarmachen muss, dass er altert.
Der Alterungsprozess ist, bisher jedenfalls, jene Maske der Zeit, die sich nicht absetzen oder austauschen lässt; er bildet unsere zweite Haut auf der ersten. Darüber kann man klagen oder verrückt werden; es hilft nichts, und es ist auch nicht schlimm, denn Vergänglichkeit will nicht schrecken, sie will angenommen sein: Thomas Mann setzt sie sich als notwendige Herausforderung vor, die er für gewinnbringend hält.
Gerade dem Blick zurück, dem grübelnden zumal, bleibt die Zeit auffällig und als Be-dachtsamkeitspol gegeben. Der Zeit sind wir unterworfen, auch wenn wir uns in ihr festen Stand zu sichern suchen, der sich am Fraglosen, am Hochglanz freigestellter Momente orientiert. In Gedanken kann sich der Mensch der Zeit entheben, das ist leichter, als man meint; er wird allerdings, aus seinen Besinnungsoasen im Kopf, un-freundlich-schmerzlich in die zeitliche Dürre zurückversetzt, wenn er sich klarmachen muss, dass er altert.
Der Alterungsprozess ist, bisher jedenfalls, jene Maske der Zeit, die sich nicht abset-zen oder austauschen lässt; er bildet unsere zweite Haut auf der ersten. Darüber kann man klagen oder verrückt werden; es hilft nichts, und es ist auch nicht schlimm, denn Vergänglichkeit will nicht schrecken, sie will angenommen sein: Thomas Mann setzt sie sich als notwendige Herausforderung vor, die er für gewinnbringend hält.
„Zeit muß man haben“, lässt er seinen Goethe im Roman („Lotte in Weimar“) sagen. „Zeit ist Gnade, unheroisch und gütig, wenn man sie nur ehrt und sie emsig erfüllt; sie besorgt es im Stillen, sie bringt die dämonische Intervention …“ Und in einer Selbstauskunft fügt er hinzu: „Vergänglichkeit ist … die Seele des Seins, ist das, was allem Leben Wert, Würde und Interesse verleiht, denn sie schafft Zeit, – und Zeit ist, wenigstens potentiell, die höchste, nutzbarste Gabe, in ihrem Wesen verwandt, ja identisch mit allem Schöpferischen und Tätigen, aller Regsamkeit, allem Wollen und Streben, aller Vervollkommnung, allem Fortschritt zum Höheren und Besseren.“
Ohne Zeitlichkeit, die mal lockt und mal droht und sogar ihre eigene Demontage variantenreich durchzuspielen weiß, verliert sich die künstlerische Produktivität an langer Weile und verbrämter Belanglosigkeit; es ist demnach eine Kunst, vergänglich zu sein – und das Beste daraus zu machen: „Zu den wesentlichsten Eigenschaften, welche den Menschen von der übrigen Natur unterscheiden, gehört das Wissen (…) von Anfang und Ende und also von der Gabe der Zeit, – diesem so subjektiven, so eigentümlich variablen, nach seiner Nutzbarkeit so ganz dem Sittlichen unterworfenen Element, dass sehr wenig davon sehr viel sein kann. (…) So ist es mit der Zeit schöpferischer Menschen; sie ist von anderer Struktur, anderer Dichtigkeit, anderer Ergiebigkeit als die locker gewobene und leicht verrinnende der Mehrzahl (…) Die Beseeltheit des Seins von Vergänglichkeit gelangt im Menschen zu ihrer Vollendung.“
Auch das ist in seinen Grundzügen von Goethe her gedacht; er nämlich, Goethe, holte die Welt ein, vereinnahmte sie, hielt sie besetzt vor dem Prägegrund abstreichender Vergänglichkeit; nur so, im Licht, das gegeben wird und empfangen, war ihm Selbstfindung und Selbstbestätigung möglich. „Am Abglanz haben wir das Leben”, wusste Goethe und wollte bis zuletzt nicht nachgeben und nicht unterliegen. Thomas Mann hat es ihm gleichgetan, er bleibt mit seinem Vorbild auf so vertrautem Fuße, dass er an seiner Seite noch einmal das Spiel zu Würden gebracht hat: Er macht sich den literarischen Spaß, Goethes Lotte in Weimar zu begleiten, eine alte Dame, die, da sie merkwürdig klug geworden ist und mit dem Vergänglichen keine Probleme mehr hat, eine Devise verkünden darf, die ihr wohl gleich von beiden Herren, vom Geheimen Rat Goethe und seinem Bewunderer Mann, eingeflüstert worden sein könnte: „Der Erinnerung zu leben, ist eine Sache des Alters und des Feierabends nach vollbrachtem Tagwerk. In der Jugend damit zu beginnen, das ist der Tod.“
Wahrscheinlich hätte Goethe in Amerika ähnlich wie sein Nachfolger Thomas Mann gedacht, der 1938, als er erstmals ins „überhelle“ Kalifornien kam, seinem Tagebuch mitteilte: „Es ist ja wie immer. Ein Tisch ist da, ein Sessel mit Lampe zum Lesen, eine Bücherreihe auf der Konsole, – und ich bin allein. Was verschlägt es, dass ich ‚weit weg‘ bin? Weit weg wovon? Etwa von mir? Unser Zentrum ist in uns. Ich habe die Flüchtigkeit äußerer Sesshaftigkeit erfahren. Wo wir sind, sind wir ‚bei uns‘. Was ist Heimatlosigkeit? In den Arbeiten, die ich mit mir führe, ist meine Heimat. Vertieft in sie, erfahre ich alle Traulichkeit des Zuhauseseins. Sie sind Sprache, deutsche Sprache und Gedankenform, persönlich entwickeltes Überlieferungsgut meines Landes und Volkes. Wo ich bin, ist Deutschland.“
Letzte Änderung: 21.08.2023 | Erstellt am: 21.08.2023
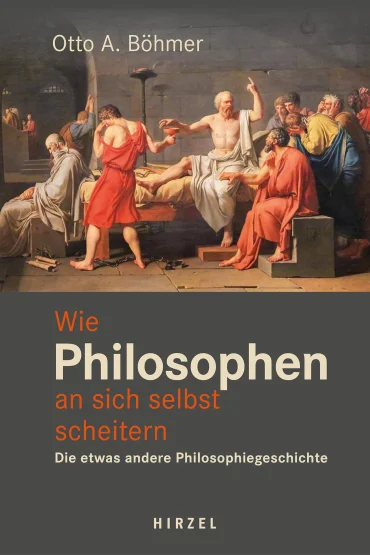
Otto A. Böhmer Wie Philosophen an sich selbst scheitern
Die etwas andere Philosophiegeschichte
220 S., geb.
ISBN: 978-3-7776-2959-9
Verlag Hirzel, Stuttgart 2023
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


