
Max Frisch äußerte einmal, Schriftsteller sei derjenige, dem das Schreiben besonders schwer falle. Wer fragt da nicht: Warum tut er es dann? Genau diese Frage ist offenbar von psychoanalytischem Interesse. Das Motiv und die Methode literarischen Schreibens zu untersuchen, hat am Beispiel des Romans „La Disparition“ von dem 1982 gestorbenen Georges Perec die Frankfurter Psychoanalytikerin Rotraut De Clerck unternommen.
Einbruch der Selbstliebe und ihre Widerherstellung im literarischen Schreiben
„Mit einer schönen Wunde
kam ich auf die Welt,
das war meine ganze Ausstattung“ (Kafka,1919)
Vorbemerkung:
„Ich, für mein Teil“, schreibt der Engländer John Sutherland im Vorwort zu seinem Buch mit dem Titel: Is Heathcliff a Murderer? Rätsel in der Literatur des 19. Jahrhunderts, „habe immer gefunden, daß die Frage, wieviele Kinder Lady Macbeth hatte, völlig berechtigt ist. Mich interessiert auch, wie alt Hamlet ist, welche Fächer er an der Universität von Wittenberg studierte und welche Noten er dafür von seinen Lehrern erhielt. ‚Is Heathcliff a Murderer’ erforscht dieses verbotene Terrain, den ‚hors-text’ – oder, genauer, jene implizite und doppeldeutige Welt, die jenseits der Wörter auf der Seite liegt“ (Sutherland 1965). Dieses Eingeständnis eines so namhaften wie populären Literaturwissenschaftlers, der in dem Ruf steht, seine Gelehrsamkeit mit der kühnen Spekulation eines Forschers zu verbinden, hat mich in dem Eindruck be-stärkt, dass sich nicht nur Psychoanalytiker für die Zusammenhänge von Biografie und literarischem Schreiben interessieren, also für die Person, die „hinter“ dem Text steht, den Autor. Freud nannte die allgemeine menschliche Neugier als die treibende Kraft, jedwede Manifestation der Psyche untersuchen zu wollen, und also auch den Schaffensprozess des Dichters (Freud, S. Der Dichter und das Phantasieren, 1908, S. 213).
Die Psychoanalyse hat es von Anbeginn dafür interessiert, woraus sich das Motiv für das Schaffen von Kunst speist. Freud räumte ein, dass dies selbst für uns Psychoanalytiker letztlich unergründlich sei. Aber es entwickeln sich bis heute immer wieder neue Theorien, den menschlichen Impuls zur Kreativität zu erklären (Döser, J 2021). Freud nannte die Neugier der Psychoanalytiker, ihren Forscherdrang. Ich füge hinzu: auch ihr Neid auf die Künstler, die Fähigkeit, „ihren Stoff so zu formen, daß es uns höchste Lust bereitet“ (a.a.o. S.223.).
Klassischer Weise sind es zwei theoretische Linien, die aber in ihren Grundannahmen sehr verschieden sind: Die eine Richtung (Freud) betont das Bedürfnis zur Wiedergewinnung der Selbstliebe als Balsam auf eine Wunde nach einer (schweren) Kränkung, etwa einer massiven Zurückweisung durch ein geliebtes Objekt. Das Kunstwerk diene dem Künstler als Mittel zur Gewinnung von Ehre, Macht, Reichtum, Ruhm und der Liebe der Frauen“, ursprünglich im Kindesalter erfahren als „Glanz im Auge der Mutter“ (Freud GW XI, 390).
Die andere Richtung (Klein) sieht im Gestalten des Künstlers und dem Kunstwerk selbst eine Nähe zum Vorgang der Wiedergutmachung für eine (phantasierte oder reale) Beschädigung am Liebesobjekt durch die eigenen aggressiven Impulse (Segal/Klein). Hier steht das Schuldgefühl gegenüber dem Anderen, nicht die eigne Kränkung, im Vordergrund. In dem Schaffen eines Kunstwerks können jedoch beide Impulse gleichzeitig vorhanden und aufeinander bezogen sein, da die Liebe und die Selbstliebe in Richtung auf das Primärobjekt, die Mutter, eng miteinander verbunden sind.
Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, diese berühmten und allen bekannten AutorInnen, illustrieren in ihrem Werk die Bedeutung der Wiederherstellung der Selbstliebe über das Schreiben. Aber, kann die Restitution der Beschädigung gelingen? Gelingt sie immer? Vollkommen? Der Lebensweg dieser Schriftstellerinnen und anderer zeigt, wie ihre Selbstliebe nie vollkommen restituiert wurde. Oft mündete er in einem Suizid.
Der französisch-algerische Künstler Kader Attia hat eine Skulptur geschaffen, einen Jutesack, an dessen einer Seite sich ein langer, scharf begrenzter Schnitt befindet, was die Assoziation aufkommen lässt, er stamme von einem Messer. Jetzt ist der Schnitt zugenäht, mit großen Stichen und einem groben stabilen Faden. Das verändert die Oberfläche des Sacks. Man versteht: der Sack ist wieder für die Arbeit tauglich gemacht. Nur, er ist anders als vorher. Er trägt die Spuren der Beschädigung. Die Schnittstelle bleibt fragil, sie kann wider aufplatzen, wie eine schlecht verheilte Narbe. Kader Attia untersucht nach seiner eigenen Aussage „die Dialektik zwischen Zerstörung und Reparatur“. Die in diesem Kunstwerk enthaltene Symbolik über den Zustand des französisch-algerischen Verhältnisses macht uns die Bedeutung mit einem Schlag klar: auch das algerische Volk ist durch die Kolonialmacht Frankreich versehrt, in seiner Ökonomie beschädigt und in seinem Stolz verletzt. Eine Reparatur wurde vollzogen, die Wunde geschlossen, aber es kann nie mehr sein wie davor.
Meine Arbeit wird sich auf ein Werk eines hierzulande weniger bekannten französischen Schriftstellers konzentrieren, Georges Perec, der den psychologischen Zusammenhang zwischen dem Verlust des Primärobjekts, dem Einbruch der Selbstliebe und der Restitution beider Seiten – von Objekt und Subjekt, in der Schaffung eines literarischen Kunst-Werks zur Darstellung gebracht hat. Ich spreche von seinem Roman „La Disparition“, wörtlich übersetzt als „Das Verschwinden“ – einem Roman, der gänzlich ohne den Buschstaben „e“ geschrieben wurde – ins Deutsche übersetzt als „Anton Voyls Fortgang“, ein Titel, der zunächst befremdet, dessen Bedeutung sich im weiteren Verlauf noch erschließen wird. Mein Thema berührt das Thema des Traumas. Ich bevorzuge aber – in meinem Kontext der Schaffung eines Kunstwerks – die Bezeichnung „Narzißtische Wunde“, weil sie besser verdeutlicht, dass der Verlust eines Liebesobjektes auch das Selbst bedroht in der Weise, dass der Verlust nicht nur als äußerer Mangel, sondern auch als Kränkung empfunden werden kann. Die Versuche der Wiederherstellung gelten dann sowohl dem Objekt – als auch dem Selbst.
Wenn ich erfahre, dass ein Autor einen ganzen Roman ohne den Buchstaben „e“ geschrieben hat, so mobilisiert das meine Neugier. Mich interessiert die schlichte Frage: Warum hat er das getan? Da ich Psychoanalytikerin bin, ist die Art meines Fragens von dieser Wissenschaft bestimmt, so wie die des Literaturwissenschaftlers von seiner: Ich sehe darin keine Konkurrenz, sondern eine wechselseitige Ergänzung beider Disziplinen.
In ihrer Arbeit mit Patienten nähert sich die psychoanalytische Methode im Wesentlichen auf drei Wegen: Erstens über das Erstinterview, das bedeutet der ersten Begegnung zwischen Patient und Analytiker und der „Szene“, die sich darüber entfaltet, mit den sich manifestierenden Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen, eingeschlossen das Agieren des Patienten und Gegenagieren des Analytikers, das, was als „Handlungsdialog“ bezeichnet wird (Klüwer 1983, S. 828–840 und Klüwer 1995, S. 45–70, Dammasch 1996, S. 443–469). Zweitens über eine psychoanalytischen Betrachtung der biografischen Daten, und Drittens über die psychoanalytische Untersuchung der aktuellen Beschwerden oder des aktuellen Konfliktes, des Symptoms, das der Patient mitbringt. Erst durch die Gesamtschau aller drei Bereiche und das Erkennen von darin enthaltenen analogen Mustern sind wir legitimiert, Hypothesen zu entwickeln, die wir mit einiger Sicherheit vortragen und auf sie unsere Deutungen aufzubauen wagen können.
Ich werde, im Folgenden, meine Überlegungen anstellen, wie die „narzisstische Wunde“ als Verletzung der Subjektivität des Autors und seiner Beziehungen in allen drei Bereichen sein Schreiben motiviert, es vorantreibt, es strukturiert und die Suche nach einer passenden Form, einer „significant form“, (ein Begriff des englischen Kunsttheoretikers Roger Fry), prägt. Ich werde dann auch begründen, warum in solchen Fällen dem Leser als Gegenüber, als Objekt, eine besondere, ja sogar konstitutive Rolle zukommt.
Erst durch die Gesamtschau aller drei Bereiche und das Erkennen von darin enthaltenen analogen Mustern sind wir legitimiert, Hypothesen zu entwickeln, die wir mit einiger Sicherheit vortragen und auf sie unsere Deutungen aufzubauen wagen können. Ich werde dann auch begründen, warum in solchen Fällen dem Leser als Gegenüber, als Objekt, eine besondere, ja sogar konstitutive Rolle zukommt.
I. Die Szene
In der Psychoanalyse nach Freud hat sich, unter dem Einfluss der Objektbeziehungstheorie von Melanie Klein und ihren Nachfolgern, eine Akzentverschiebung vollzogen, derart, dass nicht mehr der symbolischen Ausdeutung von mitgeteilten Inhalten, sondern der Art und Weise der Beziehungsaufnahme des Patienten mit dem Objekt das Hauptaugenmerk gilt. Für die psychoanalytische Behandlungstechnik bedeutet das eine sorgfältige Untersuchung der Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse und damit eine Sensibilisierung für sprachliche Strukturen, die auf innere Vorgänge jenseits sprachlicher Verbalisierbarkeit hindeuten. Dies räumt den gefühlsmäßigen und körperlichen Wahrnehmungen des Analytikers einen größeren Raum ein, weil nur darüber die entsprechenden Vorgänge im Patienten, die dieser nicht sprachlich zum Ausdruck bringen kann, erfasst werden können. Bei aller Problematik des Verfahrens die in der Subjektivität des Analytikers liegt, gilt diese Konzeption der Gegenübertragung inzwischen als „via regia“ zum Unbewussten des Patienten und hat darin die Deutung der Träume abgelöst.
Mit dem Text von Perec möchte ich meine Gedanken über das Schreiben von Literatur als Bearbeitung einer „narzißstischen Wunde“ an einem konkreten Beispiel, festmachen, denn sonst werden die Deutungsmuster zu allgemein und verlieren an Aussagekraft, so wie die klinischen Theorien einen Behandlungsfall zu ihrer Illustration benötigen.
Ich suchte einen Autor, über den ich selbst – oder man – noch wenig wusste, um daran unvoreingenommen demonstrieren zu können, wie der Analytiker zu arbeiten beginnt in Konfrontation mit einem Text. Eine Kollegin gab mir den Hinweis auf Georges Perec. Bei der Suche nach seinen Büchern und einer Biografie stieß ich in einer Frankfurter Buchhandlung auf ein Doppelpack im Sonderangebot: Den dicken Roman von G. Perec „Das Leben, Gebrauchsanweisung“, und darauf aufgebunden mit einem Papierband ein viel kleineres graues Bändchen mit dem Titel: „Anton Voyls Fortgang“, als Dreingabe, sozusagen. Mutter mit Kind auf dem Bauch war einer meiner ersten Einfälle. Dann las ich, dass es sich bei dem kleinen Bändchen um die Übersetzung eines Romans ohne Verwendung des Buchstaben „e“ mit dem französischen Titel „La Disparition“ handelte.
Wenn ich erfahre, dass jemand einen ganzen Roman ohne „e“ geschrieben hat, fällt mir als Analytikerin zunächst ein – nicht, dass dies ein Lipogramm ist, wie dem Sprachwissenschaftler – sondern, dass da jemand schreibt, dem etwas fehlt, worüber er aber nicht schreiben kann: Er kann scheinbar nur sagen, dass es ihm fehlt und darüber Mitteilung machen, wie er mit dem Fehlenden umgeht. Das Fehlende wird umschrieben, markiert, aber die Lücke selbst bleibt bestehen. Es wird also nicht versucht, Worte für das Fehlende zu finden, sondern es wird selbst, unmittelbar wahrnehmbar, sogar unumgänglich, hingestellt und dem Leser zugemutet. Das fehlende „e“ wird zur Chiffre für das Fehlende überhaupt. Das ist die Ausgangslage.
Dass das „e“ ein wichtiger Buchstabe ist, erfuhr ich gleich selbst, indem ich ausprobierte, so viele Wörter ohne „e“ zu bilden, wie mir einfielen. Das waren auf Anhieb nicht viele. Der Roman hat 300 Seiten, also laut seinem Übersetzer Helmlé 85.000 Wörter ohne „e“. Der Verfasser des knappen Umschlagtextes schreibt dann auch, es sei „Wahnsinn, er habe 79 „e“’s verbraucht“. Im Französischen ist das „e“ der zweit häufigste, im Deutschen sogar der häufigste Buchstabe.
Im Folgenden eine Kostprobe aus dem Roman in deutscher Übersetzung:
„Anton ging durch’n Korridor, wo wahnsinnig hoch war. Dort hing wandwärts das Buchbord aus Mahagoniholz. Und darauf Foliant an Foliant, achtundzwanzig Stück. D.h., Sollzahl war achtundzwanzig, doch wars schon Norm, daß ’n‘Band fort war, und zwar akkurat das Buch, wo als Inschrift „FÜNF“ drauf stand. Und das fällt nicht mal auf, da nichts kundtut, daß’n Foliant fort ist (daß z. B. auf Karton das Wort „a ghost“ stand, was in Londons National Library üblich ist); sichtbarlich gabs da nicht Loch noch Lück. Hinzu kam, und das macht stutzig: anordnungsmäßig sah man gar nicht, daß das Buch nicht da war, was daran lag, daß man absichtlich vorn mit Nr. fünfundzwanzig anfing und folglich Nr. fünf fast ganz am Schluß stand, wo kaum noch ’n Aas hinkam. Nur falls du am Schwanz anfängst – nach ‘m Motto, wonach man manchmal das Roß aufzäumt – und dich rückwärts von Buch zu Buch durchzählst und auch nichts davon ausläßt, dann fällt dir auf, daß Band fünf gar nicht da ist“ (S. 24).
Jemand, der einen ganzen Roman ohne „e“ verfasst, macht sich demnach eine un-geheure Mühe, auf diesem Wege darzustellen, dass ihm etwas fehlt, offenbar etwas Wichtiges und etwas, für das er keinen Ersatz gelten lässt; oder auch einen Mangel, der nicht kompensiert werden kann und auch nicht soll – etwas absolut Einmaliges und Grundlegendes. Wenn die Gedanken des Analytikers soweit gekommen sind, ist der nächste Schritt der unabweisbare Einfall, dass es sich hier um das Primärobjekt handeln muss – die Mutter, oder, weniger vorrangig, den Vater. Hier schreibt also einer davon, dass ihm die Mutter (oder der Vater) mangelt, und dass dieser Mangel nicht überwunden, weggemacht oder ersetzt werden kann: Er formt die ganze Spra-che und damit die gesamte Existenz. Er schreibt von diesem Mangel nicht in Worten der Enttäuschung, der Sehnsucht, der Trauer oder Wut – er lässt ihn als Leerstelle stehen.
Wenn jemand aber mit dem fehlenden „e“ einen ganzen Roman bestreitet, ein Buch zwischen zwei Buchdeckeln, so geht es ihm wohl auch darum zu zeigen, dass etwas, das den Anspruch und die Form trägt, ein Ganzes zu sein, Alpha bis Omega, auch mit dem Fehlenden möglich ist, dass es also doch möglich ist, ein ganzes Leben zu leben mit diesem Handicap, von Geburt bis zu Tod, und dass dieses Leben eine Gestalt hat, auch wenn ihm unausweichlich etwas Grundlegendes mangelt. So muss ein Roman über das fehlende „e“ eine Etüde über den Mangel sein und zugleich eine bewusste Auseinandersetzung mit einer Beschränkung.
Mein nächster Gedanke ist, dass im Französischen, das Perec schrieb, die Wörter für Mutter: mère, Vater: père, aber auch für seinen Namen: Georges und Perec, sehr reich an „e“’s sind; jedes Wort verfügt über zwei „e“’s – das ist ihnen gemeinsam – und alle beziehen ihre Stimmhaftigkeit über dieses „e“. Sie gehören also zusammen und haben ein gemeinsames Schicksal. Ein Buch, in dem diese Wörter vorkommen müssten, eine Autobiografie, ließe sich so zum Beispiel nicht schreiben. Dies unterstützt meine Vermutung, dass hier jemand zum Ausdruck bringt, dass er kein gewöhnliches Leben mit „mère“, „père“ und auch nicht mit sich selbst – franz. „je“ – hatte, und dass diese Erfahrung so grundlegend ist, dass er sich nicht der konventionellen Sprache bedienen kann, um sie zu repräsentieren. Macht es jetzt aber einen Unterschied, ob ihm etwas fehlt – also das „e“ – oder ob er bewusst darauf verzichtet? Ich meine ja, insoweit, er zum Ausdruck bringt, dass er das passive Erleiden des Fehlenden in Aktivität umgewandelt hat: Das passive Erleiden seines Schicksals in eine aktive Bearbeitung. Aus der aktiven psychischen Bearbeitung begründet sich seine literarische Produktivität.
Dem Fehlen des Primärobjektes, von dem ich jetzt ausgehe, tritt also ein Mangel auf der Seite des Subjekts an die Seite, für dessen Ausdruck es die „e“-lose Selbstbeschränkung wählt. Formal ausgedrückt: Anstatt den 26 Buchstaben des Alphabets stehen ihm jetzt nur 25 Buchstaben zur Verfügung. Dies ist eine gravierende Einengung, wie ich selbst erleben konnte. Auch kann sich die Sprache nicht mehr nach ihrem natürlichen Fluss entfalten, sondern sie muss konstruiert werden. Dadurch wird sie künstlich. Hier schreibt also einer, der sich zum Ausdruck seines Mangels nicht der natürlichen Sprache bedienen kann oder will weil er seine innere Situation und Erfahrung nicht angemessen in die konventionelle Sprache übersetzen könnte. Nur eine Sprache des Mangels, des Handicaps, und nur eine Kunstsprache scheint zur Repräsentation der inneren Welt dieses Autors zu taugen – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben. Dafür findet er das Lipogramm, eine Kunstsprache die aus dem Fehlen eine Kunst macht.
Als nächstes grübele ich über den Titel. Es ist klar, „La Disparition“ bezieht man unschwer auf den „verschwundenen“ Vokal, das „e“. Aber dieses Wort Disparition scheint mir mehr zu bedeuten, als die wörtliche Übersetzung hergibt: etwa „Das Verschwinden“. Immer wieder kehrt in mir die Frage zurück, und immer wieder schiebe ich sie weg, ob Disparition nicht auch soviel wie das Verschwundene – das Fortgegangene – das Tote – heißt. Aber hieße es dann nicht „disparu“? Als ich schließlich im Lexikon nachsehe, erfahre ich, dass Disparition auch heißt: „militärisch vermisst“; disparu heißt verstorben. Also ist meine vorbewußte Wahrnehmung, dass es auch um das Tote geht, zutreffend. Dies werte ich als Beleg, dass mein Unbewusstes mit den latenten Dimensionen des Textes in Beziehung getreten ist.
Die Übersetzung des Titels „La Disparition“ durch Helmlé als „Anton Voyls Fortgang“ erscheint, wie erwähnt, befremdlich. Zunächst gelingt auch ihm ein Titel ohne „e“, das Voyl bezieht sich auch hier unschwer auf den verschwundenen Vokal, aber auch auf »voix«, »vox«, die Stimme. Anton Voyl ist die Hauptperson, der Protagonist des Romans, der fortgeht. Damit ist aber die im französischen Titel offengelassene Frage, wer verschwindet, festgelegt. Außerdem ist etwas vormals weibliches, la disparition, zu etwas männlichem geworden, und drittens ist das Passive, das auch im Verschwinden steckt im Sinne von ‚sich auflösen’, einem betont Aktiven gewichen: Fortgang, was Intentionalität und Entschlossenheit voraussetzt. Also ein Fehlgriff Helmlés? Der Zusammenhang, den ich zwischen dem fehlenden Objekt und dem Mangel im Subjekt aufgezeigt habe, verweist eher auf einen Geniestreich: „Anton Voyls Fortgang“ ist das aktive Analogon zur Disparition. Helmlé unterstreicht mit seiner Übersetzung die andere Seite, die Aktivität, die vom Protagonisten gegenüber einem ohnmächtig machenden Schicksal eingenommen wird. Er hatte wohl intuitiv verstanden, dass für Perec mit dem Fortgang des Primärobjektes auch etwas von ihm selbst verloren – weg-gegangen war. Helmlé betont, von der Wahl der literarischen Form herkommend, die autonome Entscheidung des Autors, sich eine Selbstbeschränkung aufzuerlegen: Indem er nicht über die gesamte Klaviatur der normalen Sprache und ihrer Laute verfügt, gelingt es ihm, den Mangel selbst in die Hand zu nehmen und bis an seine Grenzen zu treiben. Dadurch gelingt ihm ein psychisch-literarischer Kraftakt, der im Sinne des „empowerment“, der Selbstausstattung mit Macht, die Auswirkungen des Traumas von Ohnmacht und Lähmung aufhebt.
&nsp;
Ich fasse zusammen:
Als erster Zugriff auf einen Roman mit dem Titel: „La Disparition“, der gänzlich ohne den Vokal „e“ geschrieben wurde, kann ich als Psychonalytikerin ohne Kenntnis der Biografie des Autors, folgendes festhalten, wenn ich mein Erleben in meiner Begegnung mit dem Text analog der „Szene“ im Erstinterview zwischen Analytiker und Patient verstehe:
– hier berichtet jemand von, nicht über einen Mangel,
– die Affekte und Erfahrungen, die mit diesem Mangel in Verbindung stehen, werden sprachlich nicht ausdifferenziert beschrieben und erläutert, sondern in Form der Lücke stehengelassen,
– der Mangel scheint etwas Grundsätzliches zu betreffen – was ich mit dem Verlust des Primärobjektes in Verbindung bringe,
– darüber entspricht dem Fehlen des Objektes, real oder als Repräsentanz, ein Loch im Selbst bzw. in der Selbstrepräsentanz,
– dieses Loch konturiert den gesamten Text, von Anfang bis Ende, analog dem Lebenstext – von der Geburt bis zum Tod,
– dadurch ist eine literarische Form gefunden, die es erlaubt, den Mangel zu repräsentieren und zugleich aktiv mit ihm umzugehen, eine eigene Kunst-Sprache zu kreieren, die den Mangel konstitutiv beinhaltet, und diese bis zur Perfektion zu treiben,
– die prinzipielle Anerkennung des Mangels und seiner Unauslöschlichkeit macht sogar diesen Griff auf eine neue Form, die Kunstsprache, wie auf eine Fremdsprache, zwingend und notwendig
– parallel dazu wird ein Graben markiert, der diese darin repräsentierte Erfahrung von aller anderen trennt,
– die „e“-Losigkeit als Tonlosigkeit bezeichnet die affektive Distanz zum Objekt und zum Selbst. Auf diese Weise habe ich als Analytikerin auch einen ersten Eindruck von der Art der Beziehungsformen und ihrer emotionalen Färbung gewonnen, die der Autor zu seinen Objekten und zu sich selbst aufnimmt. Die Übersetzung des Titels „La Disparition“ in „Anton Voyls Fortgang“ bezeichnet das Loch im Subjekt und ist somit die aktive Kehrseite zum verschwundenen Objekt.
Wir haben also als Frucht dieses ersten Zugangs über das szenische Verstehen etwas Fehlendes – so wie auch etwas Gelungenes – festzuhalten: Beides sind die Repräsentationen von psychischen Vorgängen, von spezifischen Konstellationen zwischen dem Selbst und seinen inneren Objekten im Kampf um das Überleben.
Die narzisstische Wunde ist eine Bildung im Inneren, im Selbst des Subjektes, ein „Loch“ in der Selbstliebe, das zu Gefühlen innerer Leere führt, was aber nicht ausschließt, dass wie beim Trauma, ihre Entstehung durch äußere Ereignisse angestoßen wurde. Der Verlust des Primärobjektes, z. B. zu einer Zeit, wo sich die psychische Struktur noch ausbildet, ist zugleich ein äußeres wie ein inneres Ereignis von katastrophischem Ausmaß: Es hat zugleich den Verlust einer nährenden versorgenden, Wärme und Geborgenheit spendenden äußeren Instanz, wie auch eine Lücke in der Bildung der inneren Struktur und damit der Symbolbildung, also auch in der Sprache, zur Folge. Dieselben Verhältnisse können demnach in Begriffen des äußeren Mangels als auch des eigenen Unvermögens beschrieben werden. Der Mangel ist vergleichbar – und wird oft auch so gefühlt – wie ein fehlendes Körperteil oder eine Amputation, von der ein Dauerschmerz ausgeht. Eine solche Wunde kann nicht verheilen, wenn die Bedingungen dazu nicht geschaffen werden. Manchmal können sie nicht geschaffen werden, wie in Situationen verhinderter Trauer oder bei einem endgültigen Verlust. Dann geht von dem Schmerz eine organisierende Kraft auf die gesamten Aktivitäten des Menschen aus, ohne dass die Wunde selbst sichtbar werden muss. Manchmal wird sie schamhaft verborgen oder mit manischen Manövern, z. B. Triumph, überdeckt. Aber sie bleibt weiter bestehen im Selbstbild als Gefühl des Defizitären und der Niederlage. Das beherrschende Gefühl, das aber auch verdrängt sein kann, ist das der Scham, eventuell auch der Schuld, auch wenn der narzisstisch Verwundete ein Opfer ist: Ein solcher Art verletztes Selbst erblickt im Wasser nicht ein vollkommenes Spiegelbild wie Narciss sondern ein beschädigtes, für das es sich schämt.
Die Traumaforschung hat ergeben, dass eine traumatische Reaktion dann am heftigsten und nachhaltigsten ausfällt, wenn die Verletzung durch eine nahestehende Person verursacht wurde. Ein plötzliches Verlassen werden durch Eltern oder nahe Verwandte kann ein solches nachhaltiges Trauma auslösen: Die innere Situation ist die von überwältigenden Ohnmachtsgefühlen. Im Bemühen, die Ohnmachtsgefühle abzuwehren, kann eine Wendung von Passivität in Aktivität darin bestehen, selbst die Schuld für das Geschehen zu übernehmen und damit scheinbar die Kontrolle über eine ansonsten unbegreifliche Situation zu erlangen. Die Überlebenden von Katastrophen oder auch die Überlebenden von Konzentrationslagern erleben diese Schuld in der Form der Überlebensschuld, die dann aber neuerlich innere Verfolgung als Bestrafung in der Form von schweren Depressionen und Suizidalität nach sich zieht.
Diese komplexe Situation macht sie in hohem Maße unartikulierbar. Forschungen an Traumatisierten im Zusammenhang mit einem Projekt am Institut für Sozialforschung in Hamburg haben gezeigt, dass es oft Jahrzehnte braucht, bis über die traumatisierende Situation gesprochen werden kann. Häufig wird sie in zunächst unkenntlicher Weise inszeniert. So versorgte beispielsweise ein Mann, der seiner Schwester im Konzentrationslager einen Kanten Brot gestohlen hatte, in seinem späteren Leben als Großbäcker die gesamte Region von New York mit Brot. Der unbewusste Zusammenhang der Wiedergutmachung war ihm Jahrzehnte verborgen geblieben, so wie die Begebenheit selbst. (Laub 1998, Laub & Auerhahn 1993)
Nach allem bisher Gesagten, scheint es Perec gelungen, durch eine Kunstgriff, die Einführung einer artifiziellen Sprache, der das Wesentliche der natürlichen Sprache fehlt – das stimmhafte „e“ – dieses Unsägliche konkret im Text zu repräsentieren und damit gerade die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Von der Oberfläche her gesehen, könnte man als Literaturwissenschaftler „La Disparition“ für eine manieristisch-intellektuelle Spielerei mit der Sprache halten. Aber die psychoanalytische Vorgehensweise hat hier Dimensionen aufgedeckt, die in unvermutete psychische Tiefe gehen; Begriffe dazu sind: – narzisstische Wunde – Leere – Tod.
II. Biografie
„Die Fakten“
Ich hätte selbst nicht erwartet, dass sich meine über die „Szene“ erschlossenen Hypothesen zur Struktur der dargestellten inneren Beziehungen derart konkret durch das biografische Material bestätigen würden: Als Georges Perec fünf Jahre alt war, waren seine beiden Eltern tot bzw. verschwunden. Georges war 1936 als einziges Kind seiner Eltern in Paris geboren worden. Der Vater hatte sich gleich bei Kriegsausbruch freiwillig zur Verteidigung Frankreichs an die Front gemeldet und fiel bei den ersten Kampfhandlungen 1940 an der Marne. Die Mutter wurde im Zuge der sich verschärfenden Pogrome in Frankreich ab 1941 in dem Lager Drancy interniert und von dort nach Deutschland gebracht. Sie starb im Konzentrationslager Auschwitz.
Es existiert über das Leben Perecs eine ausgezeichnete, ca. 800 Seiten starke Biografie des Engländers David Bellos, die ins Französische, bisher aber nicht ins Deutsche übersetzt wurde (Bellos 1993). Daraus geht hervor, dass Perec nach dem Tod der Eltern von der Schwester seines Vaters, Esther, und deren Ehemann, David Bienenfeld, in die Familie aufgenommen und allen äußeren Anzeichen nach liebevoll behandelt wurde. Die Familienmitglieder aus der Generation seiner Eltern, polnische Juden, waren nach Frankreich ausgewandert, um in dem Perlenhandel von David Bienenfeld mitzuarbeiten. Dieser Handel, auch wenn Krisen unterworfen, bescherte der Familie Bienenfeld und den Verwandten einen ausreichenden materiellen Hintergrund. Georges wuchs, nachdem er mit Vater und Mutter in dem ärmlichen Juden-viertel Belleville gewohnt hatte, nun im feineren XIII. Arrondissement in großbürgerlicher, kultivierter und atheistisch geprägter Atmosphäre auf.
Er wurde gefördert, auf gute Schulen geschickt, schließlich, nachdem es mit seinem Onkel David zu pubertären Konflikten gekommen war, in einem Internat in Nordfrankreich untergebracht. Dort lernte er einen Lehrer kennen, der Teil der intellektuellen, literarischen Kultur von Paris war, und der ihn in seinem Wunsch bestärkte, Schriftsteller zu werden, entgegen dem Willen seiner Adoptiveltern, die eine Zukunft für ihn im Perlenhandel vorgesehen hatten. So konnte Perec mit achtzehn auf die Frage, wie er sich seine Zukunft vorstelle, antworten: „Je serais écrivain.“
»Die Fantasien«
Perecs Familiengeschichte beginnt mit der Ableitung seines Namens, der nach keltischem Ursprung klingt, und ihm tatsächlich zeitweise als Versteck für seine wahre Identität gelegen kam, in Wahrheit aber das Ergebnis der Französisierung des polnischen Namens Peretz ist, was soviel wie Bretzel heißt. Seine unmittelbaren Vorfahren stammen aus der polnischen Stadt Lurbatow, deren gesamte verbliebene Bevölkerung – 3500 Menschen – 1942 in einer einzigen Aktion von den Nazis deportiert und vergast wurde. Perec erzählt selber, dass Péretz im Ungarischen schoschperetz heißt, was so nah wie irgend möglich an seinen Namen: Georges Péretz, herankommt. Im Hebräischen heißt perec Loch, so dass er scherzen konnte, er sei „der Mann mit zwei Löchern“.
Sein Leben beginnt also mit einem Bruch, einem Bruch in der jüdisch-polnischen Identität – und einem Sprachrätsel: Perec = Peretz = Bretzel = Loch. Hier ist ein Bezug zu seiner späteren Vorliebe für Kreuzworträtsel und Puzzles zu sehen, aber auch zu seiner Neigung, mit den verschiedenen nationalen Identitäten zu spielen.
Der Abschied vom Vater, der sich, soweit sich das rekonstruieren läßt, verpflichtet fühlte, auf der Seite der Franzosen gegen den gemeinsamen Feind Deutschland zu kämpfen, muss für ihn überraschend und unfasslich gewesen sein: Ein Fünfjähriger begreift nicht die politischen Verhältnisse und neigt dazu, sie im Sinne seiner eigenen Welt zu interpretieren. Danach geht jemand von einem weg, weil er einen nicht mag oder weil man böse war oder beides. Psychoanalytisch gefasst: weil man kein guter Sohn war – oder weil man die Mutter begehrte: Die ödipalen Tötungsfantasien gegen den Vater können so erlebt werden, als seien sie auf schrecklichste Weise Wahrheit geworden. Dazu würde passen, dass Perec in späteren Jahren – für seine Freunde unverständlich – immer wieder von sich sagte: „Ich bin ein schlechter Sohn.“
Wir können das Innere des Jungen über die biografischen Daten nicht alleine erschließen, aber die klinische Erfahrung mit ähnlichen Schicksalen legt nahe, dass durch dieses Erleben der Grundstein für die Bildung einer „narzisstischen Wunde“ gelegt und kumulativ durch die weiteren Ereignisse vertieft wurde. Denn zwar können wir auch nicht erschließen, welchen Einfluss der Tod ihres Ehemannes auf Perecs Mutter hatte, aber auch hier legt die klinische Erfahrung nahe, dass sie ihr Leben als zerstört erlebte und eine depressive Reaktion die Folge war. Depressive Mütter sind abweisend – unzugänglich für die Bedürfnisse und die Fragen des Kindes – sie sind emotional taub. (vgl. Green 1983)
Wenige Monate später ging ihm auch diese Mutter verloren: Da sie alleine einen Friseursalon unterhielt und ganztags arbeiten musste, hielt man es für das Beste, Georges zu der Verwandtschaft in die französischen Berge nahe Grenoble zu schicken, gleichzeitig verbunden mit dem Gedanken, dass er sich dort in Sicherheit befinden würde, denn der Süden Frankreichs war zu dieser Zeit noch nicht von den Deutschen besetzt. Der Abschied von der Mutter auf dem Gare de Lyon ist seine letzte Erinnerung an sie. Sie wurde 1943 ermordet. Da sie aber offiziell bei den französischen Behörden als Vermisste galt, solange ihr Tod durch die Deutschen nicht bestätigt war, gab es für Georges niemals eine Beerdigung oder andere Formen der ritualisierten Trauer, lediglich einen administrativen Vorgang, der in einer Akte festgehalten wurde, ausgestellt erst nach Kriegsende am 19. August 1947.
„Das Werk“
Perec hat in seinem kurzen Leben mindestens zwanzig Bücher, dazu fünf Bücher in Kooperation, über dreißig Erzählungen, ca. 85 Beiträge zu literarischen und intellektuellen Zeitschriften, 25 Texte für Bücher und Kataloge sowie 20 Manifeste verfasst und publiziert. Er hat sieben Hörspiele, ca. zwanzig Film- und Fernsehspiele, fünf Theaterstücke oder Bühnenadaptionen realisiert und eine Vielzahl von Vorträgen und Ansprachen gehalten. Die Aufzählung seiner Werke in Bellos Biografie umfasst dreißig Seiten, allerdings einschließlich der Auflistung der Übersetzungen seiner Werke in andere Sprachen: Er wurde ins Deutsche, Englische, Polnische, Spanische, Catalanische, Portugiesische, Griechische, Ungarische, Italienische, Japanische, Tschechische, Norwegische, Hebräische, Holländische, Schwedische, Finnische und Bulgarische übersetzt. Er dokumentierte in mehreren Fragmenten und Publikationen die Geschichte seiner beiden Herkunftsfamilien Peretz und Bienenfeld (L’Arbre, Je me souviens, W ou le souvenir d’enfance, 53 jours). Die Geschichte der Familie seiner Mutter ließ er jedoch unerforscht, nicht weil es schwierig gewesen wäre, Informationen zu sammeln, sondern weil, so muss man annehmen, er sie nicht kennen wollte: Das Innere wäre durch äußere Fakten nicht zu repräsentieren gewesen. So klafft die Geschichte der Familie seiner Mutter, der Szulewiczes, als sprechende Wunde in seiner Familiengenealogie.
Perec hatte: zwei Berufe (Schriftsteller und Archivar in einem Labor) zwei Ehen, 3 Psychotherapien, genauer: eine Psychotherapie bei Francoise Dolto wegen einer adoleszenten Depression, ein Jahr Analyse bei Michel de M‘Uzan im Alter von zwanzig Jahren wegen Schreibhemmung und vier Jahre Analyse bei J. B. Pontalis zwischen den Jahren 1971 und 75 wegen Suizidalität und Depressionen. Das sind alles klangvolle Namen der französischen Psychoanalyse. Es wäre ein eigenes Thema, aufzuarbeiten, was diese Behandler von ihm verstanden haben konnten, aber was auch nicht.
Perec war: Teil der französischen Studentenbewegung vom Mai 68 (am Rande), dafür jedoch fester Bestandteil der marxistisch-sozialistischen linksintellektuellen Kultur der Pariser fünfziger, sechziger und siebziger Jahre, Mitglied von Ouvroir Littérature Potentielle OuLiPo in Paris (Raymond Queneau) und OuLiPo an der Saar (Helmlé, Ludwig Harig), Jazzfan, Kinogänger, exzessiver Raucher, leidenschaftlicher Spaziergänger in den Straßen von Paris, Kenner deutscher Literatur und Kultur von Brecht bis Mahler und Mann, weitgereist in mehreren Kontinenten, zwei- (Französisch/Englisch) oder dreisprachig (wenn man das Deutsch/Polnisch/Jiddisch seiner Ursprungsfamilien hinzuzählt), an mehreren Orten in Paris und außerhalb zu Hause – und nirgends. Keine Kinder. Er starb 1982, sechsundvierzigjährig, an Lungenkrebs, inoperabel. Ein rasendes, rasantes und fraglos immens produktives Leben.
III. Der Text
Für den Psychoanalytiker gehört die Untersuchung sprachlicher Prozesse zu seinem Handwerk. Aber in seinem Kontext ist die Sprache unmittelbar gesehen, Träger einer Botschaft oder Selbstaussage – Offenbarung oder Verschleierung von Befindlichkeiten und Sachverhalten. Die Sprache wird nicht betrachtet wie ein Ding mit eigenen Gesetzen und eigener Geschichte – einer Schreibtradition und einer historisch gebundenen Ästhetik. Das macht die Schwierigkeit aus bei der Anwendung psychoanalytischer Beobachtungen, die sozusagen zeitlos sind, auf konkrete Texte. Andererseits ist der Autor auch ein Mensch mit inneren Konflikten und emotionalen Befindlichkeiten, die in seinem Werk nach Ausdruck drängen. Nach Perec begründet das Bedürfnis, zu sprechen und gehört zu werden, der Wunsch zu erforschen und zu wissen, das unbegrenzte Vertrauen in Sprache und Schreiben, welches die Basis für Literatur ist. Insofern ist die Zugehörigkeit zu einer literarischen Gruppe oder Schule, neben dem Interesse an der Weiterentwicklung oder Neuschöpfung formaler Strukturen, immer auch ein Ausdruck davon, dass, um es etwas pathetisch zu sagen, die Seele hier ihren Platz gefunden hat.
„La Disparition“ ist Perecs viertes Buch: Es wurde Anfang 1968 begonnen und Ende des Sommers abgeschlossen. Perec war 32 Jahre alt und außer sich vor Freude über sein Gelingen. Er hatte es nach einer Phase, die er selbst als Schreibhemmung bezeichnete, in Angriff genommen. Äußerlich hätte man nicht auf den Gedanken an einen „writers block“ kommen können, denn er war aktiver und hatte mehr Aufträge als viele seiner Künstlerfreunde. Er hatte bereits einen literarischen Preis gewonnen und war von Raymond Queneau in die Gruppe OuLiPo aufgenommen worden, die sich, im Grenzgebiet von Literatur und mathematischen Wissenschaften bewegend, mit formalen Sprachexperimenten und Sprachspielen beschäftigte – vor allem in der Form des Sammelns und Katalogisierens vergangener, vergessener oder, wie sie fanden, nicht genügend gewürdigter antiker Traditionen. Den äußerlich festzumachenden Anstoss für das Buch gab Raymond Queneau bei einer Versammlung von OuLiPo, dass nämlich der französischen Literatur noch ein Sprachexperiment fehle, ein Lipogramm, bei dem ein ganzer Roman unter Auslassung des Buchstaben „e“ geschrieben würde.
Nachdem Perec den Entschluss gefasst hatte, diese Herausforderung anzunehmen und die Lücke zu füllen, ging er gleich ans Werk. In einer Kladde, die er immer bei sich führte, begann er, eine Sammlung „e“-loser Wörter anzulegen, unterteilt in die verschiedenen Bereiche des Alltagsleben, wie: im Zug, im Café, auf der Straße, im Laden usw. Die Idee elektrisierte ihn. „Von Anfang an war ich in einem Zustand des Jubels. Ich fühlte mich wie ein Maurer, jemand der einen Ziegelstein legt, dann Zement, dann wieder einen Stein und Schritt für Schritt ein Haus baut“ (Bellos S. 399). Er bezog alle seine Freunde ein, das, was er zunächst als Spiel ausgab, mitzuspielen. Jeder, der in seine Nähe kam – er lebte damals überwiegend in Moulin d’Andé, einem Versammlungsort französischer Literaten und Intellektueller auf dem Lande – musste ihm einige „e“-lose Sätze oder ganze Passagen beisteuern. Bei den förmlichen Abendessen in Moulin d’ Andé beherrschte er mit seiner Manie, zu der sich die Sache ausweitete, die Gesprächsrunden als König und Clown zugleich. Letztendlich verriet er aber niemandem, auch keinem seiner Freunde, um was es ihm wirklich ging: Eine Arbeit an der Lücke, die das Verschwinden der Mutter gelassen hatte. Auf der Akte, die er von den französischen Behörden ausgehändigt bekommen hatte, die er aber seitdem fest verschlossen in seinem Schreibtisch verwahrte, stand die Aufschrift: „L’ Acte de Disparition“.
Der Roman selbst ist eine wüste Kriminalgeschichte, die von Geheimnissen, falschen Spuren und Rätseln, für die es nie eine Auflösung gibt, nur so wimmelt. Zugleich ist er in seiner Form das größte Sprachrätsel, das Perec hervorgebracht hat. Es ist eine Geschichte, wo erst der Protagonist Anton Voyl und dann nacheinander seine Freunde, die ihn suchen, verschwinden. Daraus ergibt sich eine auf mehreren Ebenen angesiedelte Tätersuche, mit der latenten Implikation, dass es einen Täter in diesem Sinne nicht gibt: Ein immer wiederkehrender Refrain aller Beteiligten ist, dass es „nicht Sinn, nicht Signifikation gebe“. Es ist eine Welt von Verfolgung, ohne dass Aufklärung, von Chaos, ohne dass Beruhigung oder Ordnung gewährt wird. Die Vielfalt der möglichen Bezüge und Anspielungen auf literarische und psychoanalytische Versatzstücke lässt sich hier gar nicht ausschöpfen.
Am Anfang steht ein Mann, Anton, der nicht schlafen kann: Seine Schlaflosigkeit verfolgt ihn, was ihn in die Hände von sadistischen Ärzten treibt, die ihn nun ihrerseits verfolgen, ihn an der Stirnhöhle operieren und ihm die grauenvollsten Schmerzen zufügen, ohne dass dadurch seine Schlaflosigkeit gelindert wäre:
„Anton Voyl hat Schlaf nötig, doch Anton kommt nicht an und macht Licht. Auf Antons Uhr ist’s null Uhr zwanzig. Anton ächzt laut, wälzt sich mal so rum, mal so rum – Antons Schlafcouch ist hart –, stützt sich dann auf, griff sich ’nRoman, schlug ihn auf und las: doch lange ging das nicht gut, da Anton vom Inhalt absolut nichts schnallt und ständig auf ‘n Wort stößt, wovon ihm Sinn und Signifikation total unklar ist“ (S. 15).
Es wird angedeutet, dass die Schlaflosigkeit ein Fluch, eine Bestrafung für ödipale Wünsche sei und die Operation eine von „Frau Doktor“ durchgeführte Kastration. Schließlich erscheint Anton Voyl als einzig möglicher Ausweg das Verschwinden. Anton verschwindet also. Was zurückbleibt, ist sein Tagebuch, das seinen Freunden und dem Detektiv Rätsel über Rätsel aufgibt:
„Nicht Mann noch Frau brachts raus, was Voyls Wahl nun war, womit Voyl’n Tod sich gab, ob Voyl auch wirklich und wahrhaftig tot war. (…)
Doch als zwo Tag darauf’n Kumpan, von Antons Notiz voll Unruh, zu ihm ging, um nachzuschaun, war das Haus kahl und nackt und mannslos. Da war nicht Anton noch Voyl. Und das Auto stand da, wo’s auch sonst stand, im Autopavillon nämlich. Anzug an Anzug hing im Schrank. Nichts war fort. Auch Blut gabs nicht.
Doch Anton Voyl war fort“ (S. 51/52).
Verschwinden – Disparition = „Schwund“: Was schwindet sind die Menschen, aber mit ihnen auch die genaue Erinnerung an sie. Die zurückgebliebenen Dokumente suggerieren eine Spur, wecken eine Hoffnung, die sich dann doch nicht erfüllt. Zurück bleibt Ratlosigkeit, „Obskurität“ und Leere – „nicht Sinn nicht Signifikation“.
Hier werden selbst die haarsträubendsten Begebenheiten affektlos – tonlos – erzählt. Nur selten werden Angst und Entsetzen direkt benannt, nur indirekt wird der Text so konstelliert, dass der Leser sich vorstellen kann, dass der Protagonist vor Angst und Entsetzen starr wird. Da kommt es wie eine Erlösung für alle, auch den Leser, als ihnen plötzlich ein Licht aufgeht, nämlich dass der eigentliche Verursacher von all dem Schrecken das „blanc“, das „Weiß“ ist, was im französischen auch die Bedeutung von „die Leere“ hat:
„’Das Blank!’ ruft Augustus B. Clifford laut und schon fällt ihm das Glas mit Aquavit hin und macht Olgas Fuß naß.
‚Das Blank!’ röhrt Arthur Wilburg Savorgnan und schluckt fast das Zigarillo auf.
‚Das Blank!’, blökt Oma-Squaw so spitz im Ton, daß vor ihr das Glas bricht.
‚Das Blank, ja, das Blank’ sagt Amaury noch mal: ‚nur darum gings, nur ums Schwarz und ums Blank.
Doch worauf will Anton hinaus, sobald Anton blank sagt?’
Augustus B. Clifford ging zum Schrank, macht ihn auf, nahm ‘n Album in Großformat mit Haifischhautbindung raus.
‚Da’, sagt Augustus, ‚da ist das Album, das Anton uns ‘n Monat zuvor, aufn Tag, postalisch zugeschickt.’
‚Zwo Tag vor Antons Fortgang also’, sagt Amaury scharfsinnig.
‚Ja. Doch im Album stand nicht Satz noch Wort: wortlos wars, nur’n Plakat, das Anton, glaub ich, im Tagblatt fand und ins Album pappt.’
Man trat zu Amaury, wo im Album rumsucht. Da gabs fünfundzwanzig Blatt, und nichts stand drauf, nur auf Blatt fünf das Plakat, länglich, illustrationslos, das Amaury halblaut vorlas“. (S. 109/110)
Schwarz und Weiß sind die Farben der Depression. Die Deutsche Übersetzung als „das Blank“ gibt die doppelte Bedeutung (blanc = weiß = die Leere) nicht her. Deshalb hier nochmals die französische Version:
„Du Blanc: clama Augustus B. Clifford laissant choir son hanap d’akvavit qui macula son blanc tapis.
Du Blanc: cria Olga fracassant dans sa commotion un lampion.
Du Blanc: hurla Arthur Wilburg Savorgnan avalant plus qu’au quart son cigarillo.
Du Blanc: brailla la Squaw d’un ton suraigu qui brisa trois miroirs.
Du Blanc, oui du Blanc raffirma Amaury: tout tournait autour du Blanc. Mais quand Anton Voyl dit Blanc à quoi fait-il allusion?
Augustus B. Clifford alla à un bahut, ouvrit un tiroir dont il sortit un album format grand raisin qu’un joli galuchat gainait.
- Voici, dit-il, I’album qu’Anton nous posta il y a un mois, jour pour jour.
- Trois jours avant sa disparition, donc, calcula Amaury.
- Oui. Mais il n’y a pas un mot dans I’album, sinon un placard qu‘ Anton, croyons-nous, trouva dans un journal, puis qu’il colla.
On s’approcha d’Amaury qui parcoursit l’album. Il comportait vingt-six folios, tous blancs, sauf, au folio cinq, un placard oblong, sans illustrations, qu’Amaury lut à mi-voix“ (S. 112) (Hervorhebungen R.D.C.).
(Die Fünf korrespondiert mit dem Alter, in dem Perecs beide Eltern „verschwanden“.)
Worin besteht nun die Wirkung der „e“-Losigkeit auf den Text und den Gang der Handlung des Romans? Zunächst können bestimmte Inhalte nicht mitgeteilt werden, die auf das „e“ angewiesen sind: Gefühlsbereiche, eben Emotion oder Sensation, die mit „sensualité“, „sexualité“ oder „tendresse“ zu tun haben, bleiben ausgespart. Ferner wird die Sprache selbst eintönig, lakonisch bis zur Monotonie. Dies wird darauf zurückgeführt, dass mit dem „e“ alles Weiche, Verbindliche, alle fließenden Übergänge entfernt werden. Helmlé schreibt: „Des E beraubt, präsentiert uns die Sprache mit einem mal eine Welt, die nichts mehr von Unschuld und Reinheit hat, eine Welt, in der Mißgunst und Haß, Wahnsinn und Wut, Ignoranz und Dogmatismus herrschen“ (S. 305-306).
Aber auch der Gang der Handlung nimmt eine von hier bestimmte Form. Noch einmal Helmlé: „Der Verzicht auf den im Deutschen wohl am häufigsten vorkommenden Buchstaben, das E nämlich, treibt die Handlung fast automatisch ins Düstere und Ausweglose, sie beschreibt Zustände, die gerade wegen der amputierten Mittel, mit denen sie beschrieben werden, etwas zusätzlich Inhumanes bekommen. Sätze der Anteilnahme, des Mitgefühls, des persönlichen Interesses an einer Person, die im täglichen Umgang so ungemein zählen und die menschlichen Beziehungen einigermaßen erträglich gestalten, sind in dieser Sprache nicht mehr möglich“ (S. 305-306).
Perec hat selbst erklärt, dass in „La Disparition“ nicht der Autor sich der Sprache, sondern die Sprache sich des Autors bemächtige. Hierin sehe ich, zusammen mit der Schilderung Helmlés über die Auswirkungen der „e“-Losigkeit auf den Gehalt des Mitgeteilten, die Repräsentation eines totalitären Systems, welches das Individuum der Gestaltungskraft seines Schicksals beraubt. So wird von Perec das Ausgesetztsein gegenüber einem Schicksal thematisiert, das man nicht in der Lage ist zu steuern, außer – scheinbar paradox – doch wieder über die Sprache – die Schaffung einer Kunstsprache.
Es herrscht unter den Kritikern große Einigkeit, dass „La Disparition“ als Sprachexperiment ein herausragender Text ist. Perec erklärt selbst in seinem Postskriptum, dass er damit einen „Prototyp“ schuf, vergleichbar Frank Lloyd Wright, wenn dieser ein Haus baut. Perec sagte sich damit – für ihn ganz wichtig – vom „nouveau roman“ los, um dem Roman das zurückzugeben, „wovon man glaubt, dass das längst kaputt ist, nämlich Allmacht und Innovationskraft von Narrationsausrüstung, vom Drum und Dran im Roman“. (im Nachwort S. 291).
Aber kaum jemand ist bereit – Hand aufs Herz – den Roman auch wirklich Wort für Wort zu lesen. Denn mit dem „e“ fehlt ihm nicht nur die Verbindlichkeit und die Weichheit, es fehlt auch an Kontinuität einer Handlung, der sich ohne allzu große Mühe folgen lässt und die Personen bleiben als Charaktere blass und stimulieren nicht zur Identifikation. So wird – könnte man im Sinne dessen, was ich über die projektive Identifizierung gesagt habe – dem Leser eindrücklich erfahrbar gemacht, welche Mühsal und Qual jeder Augenblick eines solchen „e“-losen Lebens dem Autor bereitet hat.
Man muss sich bewusst auf das Künstliche und Kunstvolle des Textes einlassen, denn es sind ganz andere Dinge als Handlung oder „Plot“, die an diesem Roman faszinieren. Vielleicht muss man selber eine spielerische Natur sein, um die Sprachspiele zu genießen – oder – man muss über eine ähnliche psychische Erfahrung verfügen, um dem Roman das abzugewinnen, was er zu bieten hat: Denn über die schrei-bende Repräsentation hat Perec seine Würde wiedergewonnen – Würde gegenüber der Scham, der Impotenz, dem Terror und dem Gelähmtsein.
IV. Schlussbemerkung
Der Roman ohne „e“ „La Disparition“ von Georges Perec ist – scheinbar paradox – die Repräsentation einer unsäglichen Erfahrung in Sprache. Es geht hierbei nicht nur um eine Trennungserfahrung, die sich psychisch überbrücken liesse, wie beispielsweise durch ein Spiel, wie es Freud an seinem Enkel mit dem „foooort-da“ Spiel, der Garnrolle, die verschwindet und wieder herangeholt werden kann, beschrieben hatte. (Freud 1929, S. 11ff).
Es geht auf der individuellen Ebene um die Existenz einer bleibenden Lücke durch das verschwundene Primärobjekt, ein Verlust, der zugleich ein Loch im Selbst des Subjektes bedingt, hier repräsentiert über den fehlenden Vokal, das fehlende „e“. Es geht aber auch um die Darstellung einer kollektiven Lücke – des Krieges, der Vernichtung und Ausrottung ganzer Populationen von verschwundenen „e“’s, den europäischen Juden, mit bleibenden Folgen.
Der anrührende „unterirdische“ Effekt dieses Romans (von dem Jörg Drews gesprochen hatte), besteht darin, dass dies ein Buch ist über einen kleinen Jungen, der unwiederbringlich den Klang der Stimme seiner Mutter vermisst – wie sie ihn zärtlich bei seinem Namen ruft – ein Name mit dem Buchstaben „e“. Zugleich ist es aber ein Buch über eine Verfolgung, die von paranoid-schizoiden Fantasien geprägte Welt eines fünfjährigen Jungen, der sich, der mütterlichen Funktion beraubt, weder einen Reim auf die Ereignisse in der Welt, noch auf das Verschwinden seiner beiden Eltern, und schon gar keinen Reim auf seine eigenen inneren Zustände und Befindlichkeiten machen kann: Die bösen Mächte, die ihn verfolgen als Projektionen seiner eigenen destruktive Wünsche, kehren zum Selbst zurück und drohen es zu zerstören im Sinne eines „Einbruchs der Selbstliebe“. Es fehlt das Gegenüber, welches das Erlebte und die Fantasien aufnimmt, sie transformiert und darüber zu etwas Erträgli-cherem werden lässt – ein Prozess, der in der Terminologie von Bion mit der mütterlichen Funktion der „revierie“ beschrieben wird. Dieser Vorgang der Transformation, die Reparatur, die Wiederherstellung, kann nicht vom traumatisierten Subjekt allein vorgenommen werden, weil ihm dazu die Voraussetzungen im Ich fehlen. Der Vorgang lebt vom Austausch zwischen einem Subjekt und einem Objekt.
Ich sehe in der Beziehung zwischen Subjekt–Autor und Objekt–Leser auch die Beziehung von „container und contained“. Das setzt allerdings einen „durchlässigen container“ voraus, einen aufnahmebereiten Leser, dessen Unbewusstes mit dem Unbewussten des Autors in einen Austausch zu treten bereit ist, ein Ohr, welches die beta Elemente aufnimmt und transformiert alpha Elemente, in psychische Realität (Bion 1990). Deshalb kommt dem aufnehmenden Leser eine konstitutive Rolle bei der reparativen Funktion von Literatur zu. Die Literatur, die Psychoanalyse, Psychoanalyse und Lieratur L gemeinsam – haben das Potenzial, das Unsägliche als psychische Realität hörbar zu machen und als gesellschaftliche Erkenntnis zu etablieren.
„La Disparition“ handelt von etwas, das fort ist, das tot ist, die Stimme Mutter, der Seele als einer Instanz, die das Fortleben garantiert. Zugleich ist das Buch auch eines der bedeutendsten Werke der modernen Literatur (Perec erhielt mehrere Preise, darunter den renommierten den Prix Médicis) und lebt auf diese Weise fort.
So gesehen ist „La Disparition/Anton Voyls Fortgang“ ein Meisterwerk der Darstellung der „narzisstischen Wunde“, deren Zentrum die Leere ist, ein Ort, wo es keine mildernden Worte gibt. Man könnte sagen, das Unsägliche könnte nicht treffender in Sprache gebracht werden. Darüber ist es – als universelle menschliche Erfahrung – nun in der Welt.
Literatur
Adorno T.W. (1970). Ästhetische Theorie, Frankfurt/M. Suhrkamp
Argelander, H. (1970). Die szenische Funktion des Ich und ihr Anteil an der Symptom-und Charakterbildung. Psyche 24:325-345.
Argelander,H.(1970b). Das Erstinterview in der Psychotherapie. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Bellos, D. (1993): Georges Pérec. A Life in Words. London (The Harvill Press).
Bion, W. (1990): Angriffe auf Verbindungen . In: Bott- Spillius (Hg.): Melanie Klein heute. Stuttgart (Klett, Verlag Int. Psychoanalyse)
Dammasch, F. (1996): Gegenübertragung als Erkenntnisinstrument – Szenisches Verstehen der Anfangssequenz einer therapeutischen Begegnung. AKIP Heft 96, XX VII, Jg. 4/1997, S. 443–469.
De Clerck, R.(2006). Von der Unerzählbarkeit traumatischer Erfahrung. Der Roman ohne „e“ „La Disparition“ von Georges Perec. In: De Clerck R. (Hg) (2006) Trauma und Paranoia, Gießen, Psychosozial
De Clerck, R. (1996). Die Freud – Klein Kontroverse, London 1941.45. In: Klein – Bion: Perspektiven Kleinianischer Psychoanalyse.
Drews, J. (1987): Warum Barbara ’n Madrigal von Aragon sang. Süddeutsche Zeitung Nr. 49, 28. Februar.
Drews, J. (1999): Zwillingsbeeren von Joh. Wolfgang Goethe. Vortrag gehalten am Frankfurter Psychoanalytischen Institut, 09. Okt. 99. Fischer,
G. & Riedesser, P. (1997): Lehrbuch der Psychotraumatologie. UTB.
Freud, S. (1908): Der Dichter und das Phantasieren. G.W. VII.
Freud, S. (1922): Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. G.W. XI.
Freud, S. (1929): Jenseits des Lustprinzips. G.W. XIII.
Fry, R. (1920): Vision and Design. London (Chatto&Windus).
Green, A. (1983): La mère morte. In: Narcissisme de Vie, Narcissisme de Mort. Paris (Minuit), Kap. 6. Dt.: Die tote Mutter. In: Psyche 47, S. 205ff.
Grubrich-Simitis, I. (1981): Extreme traumatization as cumulutative trauma: psycho-analytic investigations of the effects of concentration camp experiences on survivors and their children. Psychoanal. Study Child 36, S. 415–450.
Grunberger, B. (1976): Vom Narzißmus zum Objekt. Frankfurt/M. (Suhrkamp).
Helmlé, E. (1991): Nachwort zu »Anton Voyls Fortgang«. a.a.O. Kennel, R. &
Reerink, G. (Hg.)(1997): Klein-Bion. Eine Einführung. Tübingen (edition discord).
Kertesz, I. (1966): Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Hamburg (Rowohlt).
Klüwer, R. (1983): Agieren und Mitagieren. Psyche XXX VII, S. 828–840.
Klüwer, R. (1995): Agieren und Mitagieren – Zehn Jahre später. Zeitschrift f. psych. Theorie und Praxis X, S. 45–70.
Laub, D. & Auerhahn, N. (1993): Knowing and not knowing massive psychic trauma: Forms of traumatic memory. Int. J. PsychoAnal 74, S. 287–302.
Laub, D. (1998): Zur Artikulierbarkeit des Traumas. Vortrag am Frankfurter Psychoanalytischen Institut.
Lorenzer, A. (1970). Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt a.M. Suhrkamp
Lorenzer, A. (1083). Sprache, Lebenspraxis und szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Psychotherapie. Psyche 37:97-115.
Lorenzer, A (1986). Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. In: König,H.D.et al: Kulturanalysen. Frankfurt, Fischer.
Matt, P. von (1979): Die Opus-Phantasie. Das phantasierte Werk als Metaphantasie im kreativen Prozeß. In: Psyche 3/79.
M’Ulzan, M. de (1965): Apercus sur le processus de creation litteraire. Revue Francaise de Psychoanalyse 1965, 43.
Pérec, G. (1969): La Disparition. Paris (Edition Denoel). Ins Deutsche übertragen von E. Hemlé (1991): Anton Voyls Fortgang. Reinbek (Rowohlt).
Pines, D. (1993): A Woman’s unconscious use of her body. London (Virago Press).
Reemtsma, J.Ph. (1999): Überleben als erzwungenes Einverständnis.- Gedanken bei der Lektüre von Imre Kertesz „Roman eines Schicksallosen“. Vortrag gehalten am Frankfurter Psychoanalytischen Institut ,09.Okt.1999.
Sutherland,J.(1965): Is Heathcliff a Murderer. Puzzles in 19th Century Fiction. Oxford, New York ( Oxford University Press).
Schmidt-Hellerau (ed) The Analyst as Story Teller, IPA in Culture Committee; Int.Psych.Books (IP Books). New York; http://www.IPBooks.net
In dieser Fassung wurde auf Fußnoten verzichtet.
Der Vortrag war Teil der Reihe „Liebe“ 2021 an der Universität Hamburg
Letzte Änderung: 23.03.2022 | Erstellt am: 18.03.2022
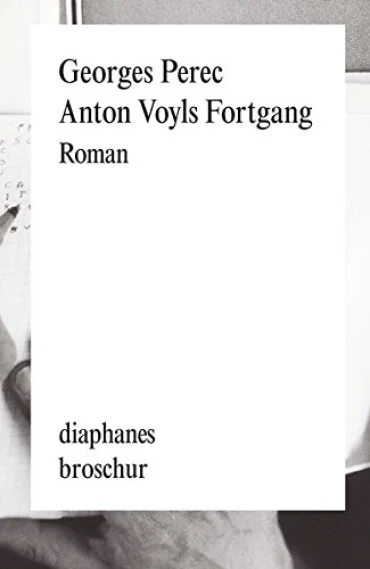
Georges Perec Anton Voyls Fortgang
Roman
aus dem Französischen von Eugen Helmlé
480 S., brosch.
ISBN-13: 978-3037343227
Diaphanes, Zürich 2013
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


