
„Es war ein klarer, lauer Morgen – dafür, dass der Frühling erst anfängt.“ Es ist der Morgen des Tages, an dem der Erzähler seine Familie zum letzten Mal sieht. Und so beginnt der „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész, mit dem er in Deutschland bekannt geworden ist. Das Buch war Anlass anhaltender Diskussionen über die Beschreibbarkeit eines Vernichtungslagers wie Auschwitz oder Buchenwald. Marli Feldvoß hat 1998 in Frankfurt mit dem Autor gesprochen.
Marli Feldvoß: Herr Kertész, soeben ist ein neues Buch von Ihnen auf Deutsch erschienen mit dem offensichtlich Rimbaud entliehenen Titel „Ich – ein anderer“. Sie schreiben, daß Sie in dreißigjähriger, geheimer, fruchtbarer und im Grunde harmloser Arbeit ein anderer geworden seien. Sie hätten aus einem Kokon die Seidenraupe hervorgebracht, die Sie heute sind. Wie ist das zu verstehen?
Imre Kertész: Ich habe mich als ein anderer vorgestellt und habe mich dafür gehalten. Also, ich habe mich als ein Schriftsteller vorgestellt. Das war damals in Ungarn ganz absurd. Ich habe insgeheim gearbeitet und langsam ist aus dem, was ich gemacht habe, ein Werk entstanden. Das ist die einfachste Ebene, um nicht von anderen Sachen zu reden, wo man auch ein anderer ist.
Und wenn Sie doch noch von den anderen Sachen reden?
Ich denke daran, daß das Problem unseres Jahrhunderts ist, wenn man Totalitarismen durchlebt oder überlebt, daß wirklich eine große Kluft, ein Abgrund entsteht zwischen dem Bewußtsein eines Menschen und den Handlungen eines Menschen; so eine große Kluft, daß man sich nicht einmal erkennt oder erkennen will. Es kann passieren, daß einer in einem Totalitarismus lebt und nach einer Logik handelt, die gegeben ist – alle Lebenssituationen haben eine gewisse Logik. Und danach zerbricht diese Logik einfach und damit auch eine gewisse Welt, die Welt, wo er gelebt und gehandelt hat. Es entsteht eine andere Logik. Und man fängt an, sich entweder zu rechtfertigen oder, wenn man die richtige Rechtfertigung und die richtige Lüge nicht findet, dann wird man wirklich ganz verstört.
Sie haben zum Teil, finde ich, behauptet, daß diese Kluft nicht zu überwinden ist, daß man eigentlich immer gezeichnet bleibt, wenn man in einem solchen System aufwächst, und daß man sich eigentlich nicht davon befreien kann. Andererseits sind Sie eine Seidenraupe geworden, und zum andern beziehen Sie sich auch immer auf Camus, der eigentlich davon spricht oder mit der Hoffnung schreibt, daß immer ein Rest bleibt.
Also bei mir sind diese Erfahrungen im Totalitarismus grundlegend. Davon bin ich ausgegangen als Schriftsteller. Das halte ich für die wichtigste Erfahrung für meine Generation und für mich selbst auch. Und das dauert. Das ist eine lebenslange Arbeit, einen Grund herzustellen, wo man alles, was man durchlebte und überlebte, annehmen, für sich selbst akzeptieren kann. Das ist eigentlich meine schriftstellerische Arbeit.
Heißt das, daß Sie sich auch angenommen haben als ‚Schicksalloser’? Oder sind Sie gar kein Schicksalloser?
Einerseits bin ich ein Schicksalloser. Man muß ganz verloren sein. Man muß ganz tief sinken, damit man in der Tiefe dann etwas erkennt – wenn die Möglichkeit da ist, und für mich war Gott sei Dank! die Möglichkeit da. Ich konnte arbeiten, jahrzehntelang – von der Tiefe kann man sich hinaufarbeiten. Aber diese Wanderung, das Sinken in die Tiefen, das braucht man dazu. Und mein ganzes Werk ist von diesen Tiefen entstanden, die ich dort erfahren habe. Und durch diese Werke habe ich mich, wenn Sie so wollen, so hinaufgearbeitet. Ja, wenn Sie so wollen, bin ich durch diese Arbeit vom Kokon zur Seidenraupe geworden.
Sie sagen auch, Ihre Welt sei eben Auschwitz. Auschwitz ist auch eine Metapher, denn Sie waren nicht so lange in Auschwitz. Aber Sie haben auch vieles im Konzentrationslager erlebt – als Junge noch, fast noch als Kind. Kann man das auch nicht überwinden? Ist das wirklich der Rahmen, in dem man dann leben muß?
Na ja, Auschwitz ist eine Grunderfahrung. Jetzt klären wir etwas. Ein Künstler, ein Schriftsteller kann nicht unfroh, aus Un-Freude schreiben. Schreiben bedeutet, – also Schriftsteller, Künstler zu sein, bedeutet eine überschießende Vitalität. Es wäre ganz falsch, das Schreiben so aufzufassen, daß man sich nur peinigt, und durch diese Peinigung entsteht das Schreiben. Natürlich peinigt man sich, aber es ist auch eine Freude. Also, ich schreibe immer aus Freude. Und wenn ich ein Werk schaffe, und wenn es für mich erfolgreich ist, also wenn ich sehe, es stimmt alles und die Welt entsteht, wie ich sie vorstellen und darstellen will, und die Sätze liegen gut, usw. – das bedeutet für mich eine Freude. Es wäre eine Lüge, das Gegenteil zu behaupten.
Was Auschwitz betrifft, ist das vielleicht ein Paradox. Diese Welt ist mir gegeben worden. Jeder Mensch hat seinen Erfahrungskreis, jeder Mensch hat sozusagen sein Schicksal. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich erlebt habe. Es gibt natürlich andere Schriftsteller, die völlig in der Phantasie leben. Ich habe diese Schriftsteller immer beneidet, die ganz unabhängig von ihren Erfahrungen fabulieren, schöne Märchen schaffen und schöne Geschichten usw. Ja, das kann man auch tun. Ich bin nicht der Mensch, der das macht. Ich bin existentiell eingestellt. Ich möchte die Welt und auch mich in der Welt deuten. Na ja, ich suche etwas. Was sucht man? Man sucht immer den Gott, den es vielleicht nicht gibt. Man gibt das aber nicht auf. Man sucht etwas, und ich bin einer, der sucht. Und darum kann ich nur von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Und meine Grunderfahrungen sind die beiden Totalitarismen, die Nazi-Welt und der Stalinismus. Und ich deute diese Erfahrungen immer in einer künstlerischen Form, die aber den Menschen, wie ich es hoffe, etwas, wenn auch nicht viel Heiterkeit, aber eine gewisse Freude geben kann. Warum lesen sonst die Menschen dieses Buch? Sie wollen sich nicht nur quälen. Sie wollen auch ein gewisses Vergnügen haben. Nicht?
Also Vergnügen, – das ist das Leiden am Schmerz. Das ist das Vergnügen, das man an diesem Buch hat. Aber ein anderes …
Ich glaube, ohne zu deuten wären diese Erfahrungen ganz unerträglich. In der künstlerischen Darstellung macht der Mensch etwas. Nietzsche sagt in der „Geburt der Tragödie“ etwas ganz Grundsätzliches. Er schreibt eine Widmung an Richard Wagner. Ich habe dieses Buch übersetzt. Und er schreibt „Die eigentliche metaphysische Tätigkeit der Menschen sehe ich“, also Nietzsche, „in der Kunst“. Und in einer Welt, wo die Religion nicht mehr absolut ist, aber die Empfindlichkeit für die Kunst noch da ist, hat die Kunst wirklich diese Rolle der metaphysischen Tätigkeit des Menschen inne. Und diese metaphysische Tätigkeit bedeutet, daß wir unsere Taten in einer anderen Welt dargestellt sehen. Und auch, wenn diese andere Welt nicht schön ist, ist es in einem gewissen Sinne doch eine Welt, wo wir unseren Trost finden. Eine Art von Trost. Eine Art von Erhebung, wenn auch nur für einen Moment.
Sie haben aber auch sehr an dieser Stilfindung gearbeitet. Zum Teil hatte das wohl wirtschaftliche Gründe, aber ich nehme an, es hatte auch inhaltliche Gründe.
Ich hatte es sehr schwer mit diesem Roman. Ich bin sehr langsam auf die Form gekommen. Und dann, damals, in den 60er Jahren, habe ich überhaupt nicht so leicht gelebt. Ich mußte auch andere Arbeiten machen. Und als ich schon die Komposition meines Romans, den philosophischen, literarischen Hintergrund hatte – und dazu gehört auch, daß ich mich von der Realität, in der ich lebte, von diesem realen Sozialismus, wo alles dieses Werk und auch mich selbst persönlich leugnete, ganz unabhängig machen mußte. Sie können sich vielleicht nicht vorstellen, wie bedrückend, wie schwer es ist, sich in einer geschlossenen Welt zu behaupten, daß man überhaupt lebt und ganz unabhängig denkt. Also diese Arbeit mußte ich machen. Und als ich zu dieser endgültigen Form kam – und das dauerte Jahre, Jahre, viele Jahre lang –, dann habe ich eine Sprache ausgearbeitet, die eigentlich nicht meine eigene Sprache ist und der ich sehr, sehr schwer folgen konnte. Ich brauchte manchmal zwischen zwei Kapiteln Jahre, bis ich das nächste Kapitel anfangen konnte. Das sind aber rein künstlerische Probleme gewesen.
Das glaube ich Ihnen jetzt nicht, daß das nur künstlerische Probleme waren.
Sie wollen mich als ein geschädigtes Opfer darstellen. Das bin ich nicht. Das gehört zu meiner Leistung, daß ich kreativ aus diesen Erfahrungen herausgekommen bin. Ich weiß, daß es in Deutschland ein Bild vom guten Opfer im Konzentrationslager gibt. Ich bin es nicht gewesen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und habe daraus eine künstlerische Arbeit geleistet. Ganz frei. Ich bin kreativ aus diesen Erfahrungen herausgekommen. Warum sollen wir das leugnen?
Sie sind jetzt erst entdeckt worden. Sie beschreiben auch in ihrem Tagebuch, 1973, daß das Thema zu spät käme. Als Sie mit Ihrem Thema in Ungarn herauskamen – zu spät. In Wirklichkeit war das Thema offensichtlich zu früh. Und das gilt nicht nur für Ungarn, sondern zumindest auch für Deutschland. In Deutschland gibt es ja wirklich eine Renaissance, wenn man so will, der Beschäftigung mit dem Holocaust, vielleicht seit Spielberg, spätestens aber auch seit Daniel Goldhagen. Also jedenfalls ist dieses Thema wieder hoch aktuell. Können Sie sich das eigentlich erklären?
Ja. Ganz leicht. Was Sie vom „Galeerentagebuch“ zitiert haben, ist ganz genauso beschrieben: Mir wurde gesagt, daß das Thema verspätet ist. Und ich habe darauf gesagt und gedacht: Wenn es wirklich verspätet ist, wenn der Mensch das vergessen hat, dann ist es vergeblich, ein geistiges Leben zu führen. Dann ist alles verloren. Das ist die Dekadenz hundertprozent. Aber ich habe das nie geglaubt. Ich habe im-mer geglaubt – und das habe ich auch damals, in den siebziger Jahren, geantwortet : Die Söhne und die Enkel müssen das noch aufarbeiten, mindestens noch drei Generationen. Und wenn es so ist, dann sind noch Hoffnungen da. Da existiert noch irgendwie eine moralische Tätigkeit. Jede Generation muß sich irgendwie mit ihrer Nation identifizieren. Das bedeutet eine Arbeit. Sich mit der Geschichte zu identifizieren, bedeutet eine gewisse Arbeit. Die große Schande der Vergangenheit wirft auch einen dunklen Schatten auf die Zukunft. Und in diesem Schatten zu leben bedeutet, die Sonne zu suchen. Das bedeutet eine Arbeit. Man muß sich irgendwie identifizieren, auf Deutsch sagt man, die Vergangenheit zu bewältigen. Das ist kein gutes Wort, aber eine Art solcher Arbeit ist doch vorhanden, wenigstens in höheren Kreisen. Damit meine ich, in intellektuellen Kreisen, wo die Werte entstehen oder verloren gehen. Also, ich glaube nicht, daß ich verspätet gekommen bin mit meinem Werk. Aus der historischen Perspektive betrachtet, wenn man das wirklich abschätzt, ist Auschwitz ein unvergleichlich großes, wenn nicht das größte Ereignis, das in Europa geschehen ist. Und wie ich das in einem Essay erörtert habe, ist das kein historisches Ereignis. Das ist viel mehr als ein historisches Ereignis. Das ist nicht so wie die Schlacht bei Stalingrad. Das ist ein Ereignis, das die Grundfragen der Moral, der uralten Gesetze aufwirft, wo man sich fragen muß, ob der Mensch noch diese zehn Gebote hat. Oder kann man auch ohne die moralischen Gesetze leben?
Warum sind Sie eigentlich immer in Ungarn geblieben?
Das ist eine gute Frage. Nach dem Krieg bin ich von Auschwitz nach Hause gekommen. Und 1946 war ich 16, 17 Jahre alt und sympathisierte mit den Linken, mit den Kommunisten. Ich wußte natürlich nichts von der wahren Geschichte der Sowjetunion und habe dort, wie viele andere Intellektuelle, Hoffnungen gehegt, daß hier ein gerechtes Leben eingeführt wird, wenn es überhaupt ein gerechtes Leben gibt. Damals, im Stalinismus, war ich in diesem Land völlig eingesperrt, hoffnungslos. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Die nächste Gelegenheit, wo ich hätte flüchten können, war 1956, bei dem Aufstand. Aber damals hatte ich schon angefangen zu schreiben, und zwar ganz ernsthaft. Ich habe, wenn ich das so sagen darf, eine Lebensentscheidung getroffen. Und es war mir ganz klar, wenn ich jetzt weggehe von hier, dann hätte ich auf Ungarisch überhaupt nicht schreiben können, dann wäre ich als Schriftsteller ganz verloren. Und darum bin ich geblieben. Nur der Sprache wegen.
Es gibt eine Bemerkung – ich glaube, das ist auch noch in dem „Galeerentagebuch“, ziemlich am Ende –, über Osteuropa: Bürgerliche Revolution ohne Bürgertum. Was kann daraus entstehen? Das gilt jetzt für eine ganze Reihe von Staaten, auch für die DDR, auch für Ungarn. Haben Sie jetzt schon eine Idee dazu, was daraus entsteht?
Ja. Das sehe ich, was entsteht. In Ungarn ist das eine Massengesellschaft, die ihre Möglichkeiten überhaupt nicht ausnützt, – die also unter diesen Möglichkeiten leben und sich ganz ausgeliefert fühlen, noch mehr als vorher. Das Leben hat sich so geändert, daß eine, sagen wir Mittelklasse – das bedeutet aber keine bürgerliche Klasse, das bedeutet die Intellektuellen, die kleinen Technokraten usw. –, eine ganz schlimme Erfahrung machen. Materiell sind sie niedergesunken. Es geht ihnen immer schlechter. Alle Belastungen, was die Umstellung betrifft, sind ihnen, dieser Klasse, aufgebürdet. Sie zahlen sehr hohe Steuern, das Gesundheitswesen ist zusammengebrochen, ein soziales Netz gibt es überhaupt nicht. Alles, was eine – das sage ich wieder in Anführungszeichen –, Errungenschaft im Sozialismus war, also das Gesundheitswesen, das Kulturwesen usw., ist heute kaputt. Und man fühlt sich wirklich ganz ausgeliefert. Andererseits sind die Leute, die jetzt statt der Nomenklatur des alten Systems dastehen, ganz unverhüllt, wie die wilden Tiere, geldsüchtig. Es gibt eine reiche Schicht, die keine Verantwortung für die Gesellschaft fühlt und ihr Geld nicht in die Wirtschaft des Landes investiert, damit man das Gefühl hätte, daß sie eine Oberschicht bildet, die für das Land arbeitet. Also, es herrscht ein Gangstersystem. Es sind sehr viele Mafias da. Es gibt keine Gesetze, keine Sicherheit usw.. Das können Sie für Übergangserscheinungen halten. Aber das wird so, daß die Menschen eine Nostalgie für die Ära Kádár, für das alte System, fühlen. Und das ist tragisch. Das muß ich Ihnen sagen. Das ist tragisch, das ist unkreativ. Und daraus wird nichts entstehen. Also es fehlt wirklich ein Bürgertum, aber ein couragiertes Bürgertum, das mit seinen Rechten und mit seinen Möglichkeiten den Rahmen, den die Demokratie bietet, ausfüllen und ausnützen könnte. Das fehlt jetzt noch.
Wie finden Sie sich jetzt heute in Ungarn zurecht?
Ich habe alle literarischen Preise, die es in Ungarn gibt, schon bekommen. Das bedeutet aber gar nichts. Ich fühle mich als Schriftsteller weiter genauso isoliert wie vorher. Diese Sachen, mit denen ich mich beschäftige, sind im Bewußtsein des Landes nicht vorhanden. Und außerdem sind meine Bücher nicht zu bekommen. Das ist vielleicht das Traurigste. Aber das ist nicht absichtlich, wie vorher, als es eine zentrale Zensur gab, sondern das Verlagswesen ist in Ungarn einfach zusammengebrochen. Und wenn ein Buch vergriffen ist, dann druckt man nichts mehr nach.
Sie schreiben über Kafka: „Kafka ist das Vorbild für jede radikale Kunst, den Weg angewidert bis zu Ende gehen. Dieser Widerwille bedeutet Ablehnung von Selbstbetrug (von Schönheit) und Verurteilung von Konformismus, der Ausschmückung des Bewußtseins in Kleinbürgerart (Lobpreisung des Eigentums und der Mythos von der Seelentiefe.)“
Sehen Sie sich in diesem Erbe von Kafka, wenn Sie das schreiben?
Ja, das ist es eben. Angewidert bis zum Ende. Ja, das ist es, was Kafka gemacht hat und wo Kafka ein Vorbild ist für die modernen Schriftsteller. Für mich zumindest.
Wenn man nochmal daneben stellt oder auch vielleicht dagegen stellt: Camus, der sagt, der Mensch in der Revolte ist der Mensch, der Nein sagt. Wo stehen Sie da?
Ich habe auch diesen Satz von Camus zitiert. Das kann als Paradox erscheinen. Aber die Paradoxien muß man ertragen. Das Leben ist voll mit Paradoxien, und das Denken ist voll mit Paradoxien. Man muß, man soll in und mit Paradoxien leben. Aber man soll nicht und ich kann nicht in Kompromissen leben. Das Leben beruht auf Paradoxien. Man ist angewidert und man sagt Nein, man lehnt sich auf. Man ist ausgeliefert. Doch man lehnt sich auf. Das sind Paradoxien, aber keine Kompromisse. Wir sollen keine Lösung haben. Wir sterben sowieso. Das ist die Lösung. Bis zu dem Moment brauchen wir diese Paradoxien, und wir müssen bei diesen Paradoxien ausharren.
Das Gespräch wurde im April 1998 in Frankfurt am Main geführt und im Mai 1998 im Bayerischen Rundfunk gesendet.
Letzte Änderung: 09.03.2022 | Erstellt am: 09.03.2022
Zum Autor:
Imre Kertész wurde 1929 als einziges Kind jüdischer Eltern in Budapest geboren, im Sommer 1944 mit 14 Jahren nach Auschwitz deportiert und 1945 in Buchenwald befreit. An seinem Hauptwerk „Roman eines Schicksallosen“, das auf diesen Erfahrungen basiert, hat er dreizehn Jahre lang gearbeitet. Die erste Veröffentlichung 1975 in Ungarn verschwand bald wieder aus den Buchhandlungen. Die deutsche Übersetzung, erschienen 1996, wurde zu einem beispiellosen Erfolg. Imre Kertész erhielt im Jahr 2002 den Nobelpreis für Literatur für sein Gesamtwerk.
Kertész schreibt 1965 in einer Notiz: „Roman einer Schicksalslosigkeit“ – als möglicher Titel … Was bezeichne ich aber als Schicksal? Auf jeden Fall die Möglichkeit der Tragödie. Die äußerste Determiniertheit aber, die Stigmatisierung, die unser Leben in eine durch den Totalitarismus gegebene Situation, in eine Widersinnigkeit presst, vereitelt diese Möglichkeit: Wenn wir also als Wirklichkeit die uns auferlegte Determiniertheit erleben statt einer aus unserer eigenen – relativen – Freiheit folgenden Notwendigkeit, so bezeichne ich das als Schicksalslosigkeit.“
Imre Kertész ist am 31. März 2016 in Budapest gestorben.

Imre Kertész Roman eines Schicksallosen
aus dem Ungarischen von Christina Viragh
288 S., kart./brosch.
ISBN-13: 9783499225765
Rowohlt Verlag, Hamburg 1999
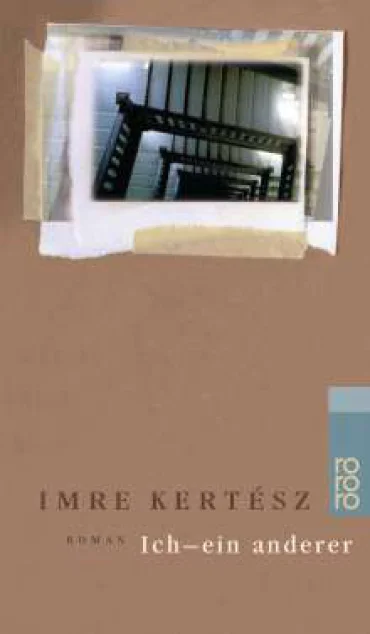
Imre Kertész Ich, ein anderer
Roman
aus dem Ungarischen von Ilma Rakusa
128 S., Kart./brosch.
ISBN-13: 9783499225734
Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1999

Imre Kertész Galeerentagebuch
Roman
aus dem Ungarischen von Kristin Schwamm
320 S., Kart./brosch.
ISBN-13: 9783499225758
Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1999


