Hundert Blumen

Weil man im deutschsprachigen Bereich als zeitgenössischer Lyriker nahezu unbeachtet bleibt, wurde Robert Schindel 1992 mit einem Roman bekannt, und zwar gleich so sehr, dass ihn die Verfilmung des Romans im Jahr 2001 noch bekannter machte. In „Gebürtig“ spiegelt er die 1980er Jahre, da Deutsche und Österreicher mit ihrer Vergangenheit als Täter und Opfer noch konfrontiert wurden – oder sie ignorierten. Auch in dem Roman „Der Kalte“, der 2014 erschien, geht es um das Zusammentreffen von KZ-Überlebendem und KZ-Aufseher in der Waldheim-Ära. Nach den ersten sechs Gedichtbänden, die im Band „Fremd bei mir selbst“(2004) ungefähr zusammengefasst wurden, veröffentlichte Robert Schindel noch drei Gedichtbände, zuletzt „Scharlachnatter“ (2015). Bernd Leukert erzählte er, wie bei ihm Gedichte entstehen. Das Gespräch fand am 26. März 2016 in Wien statt.
Bernd Leukert: Bei einer Gedichtlesung bemerken Sie ja Reaktionen im Publikum. Es gibt auch falsche Reaktionen.
Robert Schindel: Die gibt es natürlich. Aber das Entscheidende bei einer Lyriklesung ist, dass so gut wie immer eine Atmosphäre entsteht. Man merkt es den Leuten an. Man spürt, wie sie zuhören und dass sie zuhören. Das klingt zwar irgendwie rätselhaft, aber man hat das Publikum irgendwie im Gefühl, – vor allem, wenn ein Publikum zu einer Lyriklesung kommt, das sich für Lyrik auch interessiert, und nicht ein Publikum, dass zu irgendeiner Lesung, was weiß ich: Roman oder so etwas, kommt und dann auch noch Gedichte hören muss. Man merkt einfach den Unterschied in der Art und Weise, wie es aufgenommen wird.
Das ist eine andere Art der Wahrnehmung, eine verschärfte Art der Wahrnehmung?
Ja, so ist es. Oder eine andere Art der Wahrnehmung, vielleicht vergleichbar, wie wenn man einer Bachschen Fuge zuhört. Da hört man anders zu als beim Donauwalzer.
Ein Komponist erzählte mir einmal von einem Fehler, den en er gemacht hat. Er wollte nämlich beim Zuhörer einen Schauder erzeugen. Da merkte er, dass es der falsche Schauder war. Seine Studenten hielten das für wunderbar, aber er sagte, es ist falsch. So etwas gibt es auch in der Poesie?
Genau.
Das Publikum kann etwas missverstehen oder falsch reagieren, aber man kann es auch falsch provozieren.
Das stimmt. Aber ich habe natürlich 40 Jahre Erfahrung im Vorlesen von meinen eigenen Texten. Und da kriegt man schon einiges mit und kann einiges vermeiden, was zu Missverständnissen oder zum Falschhören führt. Aber es kann immer wieder passieren. Das ist ja auch nicht weiter schlecht.
Haben Sie bestimmte Zeiten, in denen Sie schreiben? Tageszeiten?
Meistens vormittags, wenn der Tag noch jungfräulich ist, wenn noch nicht zuviel vom Gerede der Welt in mich eingedrungen ist.
Aber schon genug Aktivität im Kopf vorhanden ist.
Ich bin ein Morgen- und ein Abendmensch. Ich bin am Nachmittag ein bisschen ruhiger.
Ich habe gesehen, dass sehr viele Ihrer Gedichte von Wahrnehmungen handeln, etwas Flüchtiges aufgreifen oder etwas, was sonst nicht der Verkehrssprache entspricht. Sind es Erlebnisse, die Gedichte auslösen oder sind es Worte?
Meistens sind es schon Worte. Aber eigentlich kann man es nicht sagen. In den vielen Jahren gab es die unterschiedlichsten Ursachen und die unterschiedlichste Herangehensweise, um einen Text zu Papier zu bringen oder ein Gedicht zu schreiben. Es gibt eigentlich keine festen Regeln für mich. Manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es eine Stimmung – eher selten. Manchmal ist es ein Vorsatz, aus einem Worthaufen, den ich im Notizbuch habe, einen Satz herauszuziehen und zu schauen, ob daraus etwas zu machen ist, ob ein Gedicht entstehen könnte oder ein kristallisierter Gedanke, ein Aphorismus, oder ob das wieder in den Worthaufen zurückgeworfen wird.
In manchen Ihrer Gedichte kommen mehrere Szenen vor, die aber nicht so aussehen, als ob die eine aus der anderen hervorginge. Sondern es erscheint etwas wildwüchsig.
Die poetische Reflektion folgt nicht unbedingt der Logik, etwa einem logischen Sachverhalt, dass eines aus dem anderen unbedingt hervorgehen muss. Manchmal setzen sich auch zwei Sätze in Gegensatz und bilden einen leeren Raum dazwischen. Auf den kommt’s dann an, so ähnlich, wie es auf den Text hinter dem Text ankommt. Deswegen entstehen verschiedene Verfahrensweisen, den sogenannten herrschenden Gedanken des Gedichts auf eine nonverbale Weise zum Ausdruck zu bringen.
Sie waren nie den Formalisten unter den Poeten nahe?
Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Was die konkrete Poesie, also die Wiener Tradition anlangt, bin ich ja neben ihnen und mit ihnen aufgewachsen und habe mich immer mit ihnen auseinandergesetzt. Mich unterscheidet von ihnen, dass ich kein Programm gemacht habe. Ich hatte in meinen politischen Organisationen Programm genug. Ich brauchte nicht noch in der Literatur oder Poesie manifestartige Regeln, die dann das wahre Gedicht ausmachten und ähnliches. Daher bin ich zwar immer mit den konkreten Poeten aufgewachsen, aber ich bin ihnen nicht beigetreten.
Hat es da Feindschaften gegeben oder Auseinandersetzungen?
‚Feindschaften’ ist zuviel. Aber es gab im Zuge von 1968 Auseinandersetzungen zwischen der Konkreten Poesie und der engagierten. Das lag in der Zeit, und damals waren die natürlich stolz auf ‚désengagée’ und keine Politik, nur Sprache und Wittgenstein, und noch einmal Wittgenstein und Sprachkritik und ähnliches, wie keine Inhalte transportieren – ich drücke das jetzt ein bisschen zugespitzt aus. Und wir haben das für einen puren Formalismus gehalten oder für L’art pour l’art. Und wir waren eben in einer anderen Richtung oft zu inhaltistisch. Für uns war sozusagen das Wichtigste, dass der Inhalt transportiert wird. Und die Form sollte halt dazu taugen, dass der Inhalt wohlfeil ankommt – eben dann auch zu wohlfeil. Das waren damals die Auseinandersetzungen, nicht nur in Wien, sondern überhaupt in der deutschsprachigen Literatur. Eine Folge von 1968. Inzwischen gleicht sich das an. Und mir selber ist von allen literarischen Richtungen alles recht, wenn es zum Gedicht, das ich gerade schreibe, passt; wenn es das erheischt. Ich bin weder ein Dogmatiker, noch ein Antidogmatiker der Form. Lasst hundert Blumen blühn!
Sie schreiben autobiografische Texte, Romane, Prosa. Wo fängt bei Ihnen das Gedicht an?
Damit beschäftigt sich ja die Literaturwissenschaft, seitdem es sie gibt. Früher hatten sie’s leichter. Da war ein Gedicht etwas, was sich reimte oder einen bestimmten Rhythmus hatte und ein bestimmtes, festgelegtes Versmaß. Inzwischen gibt es ja die freien Rhythmen. Und die sind aus vielen Gründen die vorherrschende Art des Gedichtes geworden, oft aus Unvermögen, weil viele Autorinnen und Autoren es gar nicht anders können, und weil es leichter ist, ein Gedicht zu schreiben in freien Rhythmen oder überhaupt nicht in Rhythmen, sondern in abgekürzten und abgerissenen Zeilen. Würden sie es reimen müssen, dann würde an der Art des Reimes auch die Qualität des Gedichtes sichtbar werden. Und daher gibt es natürlich auch viel Hochstapelei in der zeitgenössischen Lyrik. Aber dennoch – das ist halt die Entwicklung zu den freien Formen. Und ich verwende sie natürlich auch. Aber ich glaube, den freien Formen tut es auch gut, wenn man mal Oden geschrieben hat und Sonette und in strengen Terzinen und in Alexandrinern sich ausgedrückt hat, einfach gelernt hat, inhaltliche – einfach Sachverhalte in eine ganz bestimmte Form zu geben, und damit auch dieses Wechselspiel von Form und Inhalt zu trainieren. Und das tut einem auch gut und nützt dann auch den Texten, die dann ganz frei gestaltet sind.
Da die Form auch einen Einfluss auf den Inhalt hat, stellt sich die Frage, wie entsteht bei Ihnen die Form? Aus dem Inhalt?
Das kann ich nicht sagen. Ich schreib einfach was auf. In meiner Jugend habe ich mich natürlich mit der Form herumgeschlagen und hab versucht, bestimmten Formen Inhalte anzudienen, um zu schauen, wie das überhaupt geht. Und mit der Zeit erlernt man, dass Inhalte Formen erheischen, quasi unter der Bewusstseinsebene. Wenn ich etwa einen Text schreibe, und es wird ein Sonett, dann wird’s einfach ein Sonett. Das habe ich mir vorher gar nicht vorgenommen. Ich habe nur versucht, einen bestimmten Sachverhalt auf den poetischen Begriff zu bringen. Und in der ersten, zweiten Zeile merke ich, das geht in die Richtung Sonett, oder es bleiben freie Rhythmen. Das ergibt sich sozusagen meistens erst bei den ersten Entwürfen des Textes, welche Form er sich gibt. Es wird halt auch erheischt. Das Sonett eignet sich für bestimmte Inhalte, der Alexandriner für andere, und der Haiku wieder für andere. Und die freien Rhythmen eigenen sich auch nicht immer für alles, auch wenn das manchmal geglaubt wird.
Der Unterschied zwischen einer lyrischen Prosa kann eigentlich nur fließend sein?
Ja, fließend. Es sollte – aber das ist inzwischen schon lange nicht mehr der Fall – ein Gedicht poetisch sein. Und wenn ein Gedicht nicht poetisch ist, ist es eigentlich auch kein Gedicht, auch wenn es eine Gedichtform hat, finde ich. Aber das ist vielleicht auch altmodisch.
Um zum Punkt zu kommen, der das Gedicht entstehen lässt: Was ist das Poetische?
Ich würde sagen, ein verdichteter Sachverhalt, schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt – nicht im Sinne einer bestimmten Ästhetik, sondern treffend ausgedrückt, so als könnte man’s nicht anders sagen: Über allen Wipfeln ist Ruh’. Das kann man nicht anders sagen. Eine Poesie ist einzigartig, wenn sie gelungen ist. Schläft ein Lied in allen Dingen – dafür kann man kein anderes Wort verwenden. Das sind dann die wenigen gelungenen Gedichte in der deutschsprachigen Literatur. Es gibt ja nicht so viele. Auch Goethe hat nicht viele wirklich gelungene Gedichte geschrieben. Es gibt wenige gelungene Gedichte, und jeder Lyriker – ich auch – hofft, dass in seinem Leben eines wirklich gelungen ist, dass eines vielleicht überlebt in irgendeiner Weise.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, Gedichte zu schreiben? Es wird einem ja nicht in die Wiege geworfen.
Ja, das hat schon damit zu tun, dass ich nicht zeichnen konnte. Und wenn man nicht zeichnen kann, was macht man zum Muttertag, wenn alle zum Muttertag der Mutter was zeichnen? Und man selber kann nicht zeichnen? Dann steht man irgendwie blöd da. Eine fremde Zeichnung hätte die Mutter ja bemerkt. Da muss man eben was anderes, Eigenes machen. Denn die Mutter freut sich immer, wenn das Kind etwas Eigenes macht. Da habe ich halt Muttertagsgedichte geschrieben, statt zu zeichnen. Und auf diese Art bin ich halt hineingeschlittert in die Lyrik. Und das ist dann nicht mehr abgerissen. Mit Acht hat’s begonnen, und, ich glaub, mit 24 hatte ich das erste Gedicht, das so einigermaßen geworden ist. Dazwischen sind sicher Tausend geschrieben worden. Na, es gibt auch vorher eines, das gelungen ist. Das ist dann auch in dem Lyrikband drinnen. Das war mit 18. Das war so ein Rausreißer. Unter so vielen, vielen schlechten Gedichten war eines dabei, das eigentlich schon nach vorne gezeigt hat.
Sie haben immer vom Schreiben gelebt?
Nein. Das wäre auch gar nicht gegangen. Ich habe zuerst von zuhause gelebt, wie viele Studenten. Und dann habe ich von Stipendien gelebt, dann von Nebenjobs. Ich habe schon sehr früh angefangen zu arbeiten, Ferienarbeiten oder manchmal auch während des Studiums schon. Dann habe ich überhaupt gearbeitet. Ich habe ja nach der Buchhändlerlehre die Matura gemacht, aber dann neben dem Studium auch richtig gearbeitet für die Agence France Presse und in der städtischen Bücherei. Da habe ich sechs Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich Aufträge bekommen für Theatertexte oder Programmtexte für eine Politgruppe, eine Band, die politische Texte gesungen hat, die „Schmetterlinge“. Und so bin ich sukzessive ins freie Schreiben hineingekommen. Und da habe ich das eine oder andere Stipendium erwischt. Wenn man dann schon was hat, dann reicht man das ein. Dann bekommt man ein Staatsstipendium oder ein Projektstipendium. Und dann kommt das erste Buch. Dann kann man mit den Lesungen überleben. Denn wenn man ein Buch hat, bekommt man Lesereisen und kann von den Honoraren leben. Und so wurschtelt man sich fort. In der Zusammenarbeit mit den ‚Schmetterlingen’ habe ich auch gelernt, sogenannte Gebrauchstexte, Songs zu machen. Ich habe das dann nachher wenig gebraucht, weil ich nicht in Kontakt mit Musikern kam, die Texte von mir gebraucht haben. Aber es war trotzdem eine gute Übung.
Mit Theatertexten ging das dann besser?
Ich habe nicht so viele Theatertexte verfasst. Ich habe ein Libretto geschrieben, das ist auch komponiert worden von Dirk d’Ase, „Joseph Herzog“. Das war eine Oper, die leider nicht aufgeführt wurde. Das liegt aber nicht am Libretto. Eine Oper wird wegen der Musik aufgeführt. Und die modernen Opern haben es ja schwer. Ich habe also ein Libretto geschrieben und ein Theaterstück, „Dunkelstein“, das jetzt im Nestroy-Theater aufgeführt wurde. Das war ursprünglich eine Auftragsarbeit vom Volkstheater. Das Volkstheater hat’s dann nicht genommen, weil es vom Holocaust handelt. Das hat man gewusst. Aber das war dann zu scharf. Das Volkstheater hat einen großen Zuschauerraum. Und da hat der damalige Intendant Schottenberg Angst gehabt, dass er die Hütte nicht voll kriegt und dass das ein Flop wird. Dann hat er mich lieber ausgezahlt. Das ist es neun Jahre gelegen, und jetzt hat’s das Nestroy-Theater gemacht. Es ist seit Wochen ausverkauft und ein großer Erfolg. – Aber sonst gibt’s bei mir nicht viele Theaterstücke und nicht viele Aufführungen. Es gibt hauptsächlich Lyrik und Prosa.
Letzte Änderung: 16.08.2021
Robert Schindel, Lyriker, Romanautor, Essayist und Regisseur, wurde 1944 in Bad Hall bei Linz geboren. Als Kind jüdischer Kommunisten – der Vater wurde in Dachau umgebracht, die Mutter überlebte Auschwitz und Ravensbrück – entkam er unter dem Namen Robert Soel der Deportation. Nach Gymnasium, Buchhändlerlehre, politischem Engagement, Philosophie- und Jurastudium gründete er die Kommune Wien mit und die Literaturzeitschrift „Hundsblume“. 1970 veröffentlichte er seinen Roman „Kassandra“, arbeitete bei Post, Bahn, Wiener Hauptbücherei und als Nachtredakteur bei Agence France-Presse, sowie als Gruppentrainer für Arbeitslose. Seit 1986 arbeitet Robert Schindel als freiberuflicher Schriftsteller.
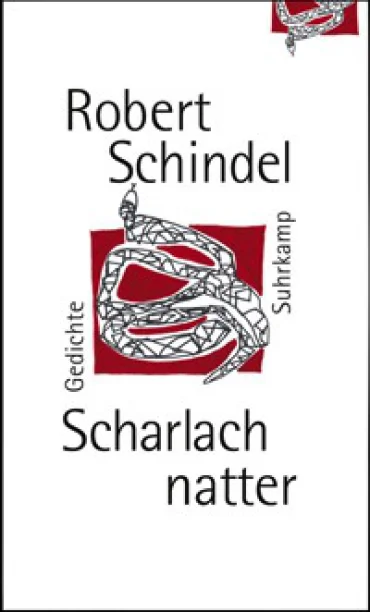
Robert Schindel Scharlachnatter
Gedichte
Gebunden, 100 Seiten
ISBN: 978-3-518-42486-5
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2015
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


