Im Zeichen der Eule

Griechen und Römer haben die mediterranen Länder mit ihren antiken Hinterlassenschaften geprägt. Sie bilden, neben dem Meer selbst, den Rohstoff, aus dem Tourismus und Literatur produziert wird. Die griechische Lyrik, die lange Zeit im Zeichen des Widerstands gegen autoritäre Regime geschrieben und gelesen wurde, sucht mittlerweile neue Wege aus den Vergangenheiten und macht mit bemerkenswerten Lyrikerinnen auf sich aufmerksam. Bernd Leukert hat einige ihrer jüngeren Veröffentlichungen kennengelernt.
Durs Grünbein schrieb in seinem Nachwort zum Band „Labyrinth“:
„Ein Grieche, der schreibt, weiß, dass er, per Definition, ein Lastenträger ist. Er wird sich schwertun damit, die Last der Überlieferung einfach abzuschütteln. Er wächst in Landschaften auf, die antike Texte sind, lebt an Orten, schwer vom Mythos beladen.“
Er zitiert damit den griechischen Dichter Thanassis Lambrou, der, Jahrgang 1962, in Thessaloniki Rechtswissenschaften studierte, in Freiburg i. Br., wohin er wegen Hölderlins „Hyperion“ ging, Philosophie, Klassische Philologie und Kunstgeschichte. Er arbeitete über Goethes „Faust“, übersetzte Angelus Silesius, Goethe, Schiller, Hölderlin und Rilke und war mehrere Jahre Botschaftsrat in Berlin.
In der ‚Kleinen griechischen Bibliothek’ des Berliner Elfenbein Verlags, wo bisher unter anderem Werke von Elytis, Adamopoulos, Lillis, Ritsos, Kazantzakis und Seferis veröffentlicht wurden, ist 2019 der dritte Band der poetischen Texte von Thanassis Lambrou erschienen. Wie auch die ersten beiden Bände „Labyrinth“ (2014) und „Meditation“ (2016) sind die Texte von Herbert Speckner übersetzt und zweisprachig abgedruckt.
Das erste der ansprechend gestalteten Bücher, „Labyrinth“, enthält in seinem ersten Teil tatsächlich Gedichte von klassischer Schönheit. Thanassis Lambrou hat sich hier in einer Art Rollenpoesie dem mythischen Barden der Kelten, Amergin, dem antiken Tyrannen von Korinth, Periander, den Philosophen Heraklit, Parmenides, Empedokles, Konfuzius, Diogenes, Spinoza, den Dichtern Hölderlin, Novalis und Borges, aber auch dem Kaiser Hadrian, dem Maler Cézanne oder dem Wolkenforscher Luke Howard anverwandelt, den er so sprechen läßt: „Eine blühende Schlucht hat mir das Feuer gezeigt,/ das aus einem geheimen Winkel des Himmels aufsteigt.// Von den Bäumen sind Fäden aus purem Gold geronnen./ Vögel haben daraus zierliche Nester gesponnen.// Trugen sie hoch und flochten sie in das fließende Licht./ Erde und Wind und Himmel waren im Gleichgewicht.“
Im weiteren Verlauf des „Labyrinths“, etwa im Gedicht „Athen“, greift Lambrou zur christlichen Ikonographie, um seinem Protest gegen die Umweltzerstörung die gehörige Wucht zu verleihen: „… und ich spürte, wie die Dornenkrone der Maschinen,/ von Menschen geflochten,/ drückte und einstach/ mit giftigen Sporen mitten ins Antlitz der Erde.“
Schon die „Dornenkrone der Maschinen“ ist keine unmittelbar einsichtige Metapher, wenn sie nun aber „drückte und einstach/ mit giftigen Sporen mitten ins Antlitz der Erde.“, dann kippt die Umdeutung der Dornen in Sporen – gemeint ist der fremdelnde Plural des in der Reiterei verwendeten Stiefelsporns – zumal giftig, was schon bei Pferden sinnwidrig wäre, der Erde als Rebus ins Antlitz. Schließlich endet das Gedicht mit dem von einer Stimme, fast schon ersterbend, gesagten Satz: „Heut wird nicht der Christus gekreuzigt,/ heut kreuzigen sie die Schöpfung.“
Selbst wenn griechischen Poeten der letzten fünfzig Jahre – anders als die deutschen – die Vermeidung des großen Pathos nicht zu ihren selbstgesetzten Regeln zählen, fällt doch sein starkes Vorkommen bei Lambrou auf. Vor allem in den beiden Folgebänden verbindet es sich mit antiker und christlicher Bildsprache. Der Blitz des Heraklit, der alles steuert und wie immer eins ist mit dem Schöpfergott, erhellt die Poesie Lambrous ebenso wie das „verzehrende, absolute Feuer“, von dem Cusanus schreibt. Die coincidentia oppositorum wird so häufig beschworen wie der ewige Kreislauf der Natur und Goethes ‚Stirb und werde!’. So heißt es in „Das Rätsel Zeit (I)“, das griechisch schlicht ‚O Chronos’ betitelt ist:
„Und dennoch gilt: Der Adern Flechtwerk/ und die kühle Strömung, der erste Pulsschlag,/ der dieses Blitzgewitter ohnegleichen belebt und in Bewegung hält,/ all das entgeht uns,/ und wie ein Fisch durch tiefe Wasser gleitet,/ so schwimmt dahin die märchenhafte Schönheit,/ die wie ein Netz aus Gold zusammenhält/ Erde und Himmel, Galaxien und Sterne,/ die ganze Schöpfung in erhabner Größe.// Was wir erleben, mit Händen greifen, und was wir erleiden,/ das ist aus Zeit gesponnen,/ getauft in einem wellenlosen Fluss, der keine Ufer kennt,/ in dem gewaltigen Meer, das Raum hat für dies alles./ Alles ist Tod und Auferstehung aus dem Staub,/ der in sich schon bereit ist für den Neubeginn./ Die Arme ausgebreitet, trägt der Baum den Himmel,/ schlürft Licht und strebt nach Neugeburt in seinen Samen,/ die er in Fülle aussät auf die Erde, um das Leben anzuspornen,/ die taubenetzte Blüte jedes Mädchens/ trägt das Verlangen, dass in seinem Leibe Leben wächst,/ um den Wildwasserfluss der Zeit vielleicht doch anzuhalten – für einen Augenblick/ und sorglos fortzuflattern wie ein Vogel in den Himmel.“
Es ist nicht zu übersehen, das Mädchen, die Frau ist stets für die Fortsetzung des Lebens eingesetzt, als Gebär-Mutter, und der Sternenhimmel, das Weltgefüge ist eben nicht so, wie sich das unserem dumpfen Gehirn eingeprägt hat. Die mystische Betrachtungsweise schränkt notwendigerweise den Themenkreis und die Gedankenfülle so ein, daß die Gedichte und Sprüche wie eine Variationsreihe ein und desselben Gebets erscheinen. Kurz: Thanassis Lambrou schreibt als Beseelter, und wer seine Dichtung in diesen schönen Büchern lesen möchte, sollte bereit sein, ihm auch in solche Idyllen wie in „Anderslicht“ zu folgen:
„Dass wir mit allem sind ein Sein,/ öffnet das Herz der Freude weit./ Schau in den Sternendom hinein –/ wie Schnee schmilzt deine Einsamkeit.// Betrachte den Himmel, der Winde Wehen,/ die Steine, die Vögel, die eiligen Flüsse,/ und du siehst in anderem Lichte die Tage vergehen/ Mutterleib werdend und liebende Küsse.“
Herbert Speckner hat die hymnischen Verse so wort- und sinngemäß wie möglich übersetzt. Hin und wieder hat er, wenn die Versfüße im Deutschen zu kurz treten, Ergänzungen vorgenommen. So wird aus dem ‚Embryo’ „Des Menschen Keim“, und da, wo im Griechischen ‚Abgrund’ und ‚Zeit’ stehen, wird im Deutschen der „gähnende Abgrund“ und die „nie versiegende Zeit“ daraus. Da, wo Lambrou die rituell wiederholte Anrede ‚tiefgründige Väter’ gesetzt hat, wählt Speckner schon mal stattdessen „tief sinnende Väter“.
Selbst wenn er, wie er im Nachwort der „Meditation“ hervorhebt, gemeinsam mit dem Autor „die präziseste und möglichst auch eleganteste Lösung“ zu finden und „stets sein kundiger Rat den Ausschlag“ gab, sollte es erlaubt sein, über das – durchaus übliche – Verfahren der Interpretation beim Übersetzen nachzudenken.
Katja Stepec, die eine philosophische Erklärung der sprachlichen Übersetzung vornahm (ohne auf die lyrische Übersetzung einzugehen), trifft darin eine harte Unterscheidung:
„Übersetzen geht, […], anders als die Interpretation mit Unterschieden zwischen Sprachgemeinschaften um. Während die Interpretation die Unterschiede überspielt, um Verstehen und Kommunikation zu begründen, akzeptiert und reagiert Übersetzen auf diese Unterschiede. In diesem Sinne kann bestätigt werden, dass die Interpretation nur in einer Sprachgemeinschaft operiert, während die Übersetzung von vornherein von pluralen Sprachgemeinschaften ausgeht. Somit ist Übersetzen vor allem eine Einstellung: die Erkenntnis der Pluralität, Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit von Sprachen.“
Bedeutet das für das lyrische Übersetzen, daß das kommunikative Defizit zur Grundlage und nicht zum Makel gereicht? Weht da ein zuspitzender Gedanke Adornos herüber, nach dem das sprachliche Kunstwerk desto bedeutsamer, je unverständlicher es ist? Muß der mitteilbare Anteil eines Gedichts faßlich sein, damit der unsagbare mitteilbar wird? Und warum hätte der Übersetzer die sprachliche Differenz herauszustellen, die durch inkompatibles Übertragen entstünde und nicht der Absicht des Autors entspräche? – Vermutlich sind solche Fragen nicht generell oder nicht hinreichend zu beantworten, sondern bleiben in der Entscheidungskompetenz des Übersetzers liegen, wo Erfahrung und Wagnis miteinander auf dem Seil tanzen.
—
Der 1990 gestorbene Dichter und Schriftsteller Jannis Ritsos, der mehr als 100 Bücher veröffentlichte, unter dem Diktator General Metaxa, unter den Deutschen, den Engländern, den Obristen viel Lebenszeit im Gefängnis verbrachte, aber auch unter der doktrinären Vereinnahmung durch die Kommunisten litt, schrieb 1970 im Hausarrest das Langgedicht „Helena“, das 2017, übertragen von der Gruppe LEXIS (Andreas Gamst, Anne Gaßeling, Rainer Maria Gassen, Milena Hienz de Albentiis, Christiane Horstkötter-Brüssow, Klaus Kramp, Alkinoi Obernesser) unter der Leitung von Elena Pallantza in einer zweisprachigen Ausgabe herauskam. Die alte Helena erinnert sich darin an ihren Auftritt im 3. Gesang der Ilias, der Mauerschau, da sie als schönste Frau der Welt zum Siegerpreis für zwei auf Leben und Tod kämpfende Männer ausgesetzt wurde. Zugleich ist sie eine Frau des 20. Jahrhunderts, die erzählt:
„Mein Ehemann reist nicht mehr. Öffnet auch kein Buch. In seinen letzten Jahren/ war er sehr reizbar geworden. Rauchte unentwegt. Nachts ging er/ im großen Salon auf und ab, mit diesen zerfetzten braunen Pantoffeln/ und seinem langen Nachthemd. Jeden Mittag bei Tisch kam er/ auf die Untreue von Klytämnestra oder auf die gerechte Tat von Orest zurück,/ als wolle er jemanden bedrohen. Wen kümmerte das? Ich hörte gar nicht hin. Dennoch,/ als er starb, fehlte er mir sehr – …“
Ohne umständliche Perspektivwechsel zieht Ritsos die Erinnerung ans antike Leben und die realistischen oder halluzinatorischen Erzählungen der Neuzeit in den Monolog einer greisen Frau zusammen. „Ritsos fingiert den Schwanengesang einer sterbenden Muse. Doch nicht der jugendschönen homerischen, sondern einer von Alter und Verfall erbarmungslos gezeichneten Gestalt: alt, häßlich, ans Bett gefesselt …“, schreibt Elena Pallantza in ihrem Nachwort, „Helena haucht ihr Leben in einer selbstinszenierten Apotheose aus, im Ausdruck des innigsten, ultimativen Wunsches nach Selbstbestimmung und Autonomie in allem Zwischenmenschlichen, wo sich die wahre Schönheit des Menschen verbirgt: in der Liebe, in der Kunst und im lebenslangen Kampf gegen die allmächtigen Zwänge der Außenwelt. Eine gute Maske für schwierige Zeiten, der Mythos.” Die Übersetzerinnen und Übersetzer haben glücklicherweise nicht versucht, das griechische Versmaß im Deutschen zu imitieren. Ihnen gelingt eine elegante, prosaische, sinngetreue Übertragung des großen Poems. –
Der Leipziger Verlag Reinecke & Voß, in dem es erschienen ist, hat in seiner Reihe mit neugriechischer Lyrik unter dem Titel „Wo man spazieren gehen kann und es Orangenbäume gibt. Neue Lyrik aus Griechenland.“ auch einen kleinen Sammelband veröffentlicht. Acht Lyrikerinnen sind darin mit je sieben bis neun Gedichten vertreten, wobei nur jeweils eines einer Autorin auch im griechischen Original abgedruckt ist. (Damit entzieht sich dieses Verfahren einer die Übertragung betreffenden Betrachtung.) Ausgewählt und übersetzt wurden sie von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen. Zwar geistern auch in dieser Sammlung zuweilen die antiken Mythen durch die Zeilen, aber der Umgang damit gerät merklich distanzierter, spielerischer, doch auch bekennend: „Daß ich mich nicht umbringe, liegt nicht an dir, es liegt/ an ein paar Säulen/ – korinthischen –,/ die sich unerwartet erheben aus all der Scheiße der Stadt/ wo/ ich groß geworden bin.“ (Katerina Chandrinou: Kallirrhoestraße). Das Büchlein überrascht mit einer Fülle unkonventioneller Ein- und Tonfälle. So finden sich im Gedicht „Entchen klein“ von Niki Chalkiadaki die Zeilen: „… Ich wuchs auf im Schnabel eines Storches/ ohne Empfänger,/ und kam schließlich in eine Besserungsanstalt für Vögel.// Man schob mir Pfauenfedern in den Bürzel/ und versuchte, mir das Deklinieren beizubringen: Die Eule, der Eule. …“
Auf der antiken Drachmen-Münze war das Attribut der Schutzgöttin Athene, eine Eule, zu sehen, von der sich die Redewendung von den Eulen, die man nicht nach Athen tragen muß, herleitet. Es ist anzunehmen, daß man in Griechenland die Lyrikerinnen Glykeria Basdeki, Niki Chalkiadaki, Katerina Chandrinou, Eleni Galani, Phoebe Giannisi, Anna Griva, Xenia Papadopoulou und Alexandra Sotirakoglou gut kennt. Im deutschsprachigen Raum aber sind sie noch zu entdecken. Mit Anna Griva ist ein Anfang gemacht. Reinecke & Voß hat ihren Gedichtband „Glaub den Wörtern nicht. Sieh hin.“ 2019, ebenfalls in der Übersetzung von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen herausgebracht. Darin erweist sie sich, wen wundert’s, ebenfalls als ‚Lastträgerin’, die die griechische Antike mit der Gegenwart kollidieren läßt. Ihr Gedicht „Worte“ aus dem erwähnten Sammelband sei hier an den Schluß gesetzt. Das Genus des Engels ist darin wechselnd, verläßlich aber der phantasievolle Fluß der philosophisch-poetischen Sprachbilder:
„Mein eigener Engel/ kann durch Spalten gehen,/ sein Geist glättet sich,/ damit er leichter hindurchgleitet,/ ihre Flügel legen sich/ an die Wurzel des Halses.// Für ein Weilchen sitzt er zu meinen Füßen/ und erzählt von seinem Flug/ über Städte und Abgründe./ Ich gebe ihm Körner zu essen,/ und er löscht seinen Durst/ mit Wasser aus meiner Hand.// Mein eigener Engel bringt/ niemals Nachrichten,/ auch keinen Rauch aus der anderen Welt./ Er sprach nie zu mir von Gott/ oder Erzengel-Geschwistern./ Er fragt mich nur, wie es ist, einen Körper zu haben,/ wie Liebe sich aus Küssen entwickeln kann,/ wann die Erinnerung Schmerz bereitet,/ und wie man ihm entkommt.// Aber vor allem fragt er,/ ob die Worte sich in der Luft verlieren,/ oder ob sie zu Engeln werden,/ bis sie ihr Ziel erreichen.“
Literaturhinweise
Thanassis Lambrou: Labyrinth. Gedichte Griechisch – Deutsch. Übersetzt von Herbert Speckner. Mit einem Nachwort und einem Gedicht von Durs Grünbein. Elfenbein Verlag, Berlin 2014. ISBN 978-3-94118431-2
Thanassis Lambrou: Meditation. Gedichte Griechisch – Deutsch. Übersetzt und mit einem Nachwort von Herbert Speckner. Elfenbein Verlag, Berlin 2016. ISBN 978-3-94118466-4
Thanassis Lambrou: Pfade. Gedichte und Sprüche Griechisch – Deutsch. Übersetzt von Herbert Speckner. Mit einem Gespräch zwischen Autor und Übersetzer. Elfenbein Verlag, Berlin 2019. ISBN 978-3-96160028-1
Katja Stepec: Sprachgrenzen. Eine philosophische Erklärung der sprachlichen Übersetzung. Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2019. ISBN 978-3-958321687
Jannis Ritsos: Helena. Griechisch/Deutsch. Übertragen von der Gruppe LEXIS unter der Leitung von Elena Pallantza. Verlag Reinecke & Voß, Leipzig 2017. ISBN 978-3-942901-23-9
Wo man spazieren gehen kann und es Orangenbäume gibt. Neue Lyrik aus Griechenland. Ausgewählt und übersetzt von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen. Verlag Reinecke & Voß, Leipzig 2018. ISBN 978-3-942901-32-1
Anna Griva: Glaub den Wörtern nicht. Sieh hin. Gedichte. Übersetzung von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen. Verlag Reinecke & Voß, Leipzig 2019. ISBN 978-3-942901345
erstellt am 03.7.2020
aktualisiert am 09.7.2020
Letzte Änderung: 25.09.2021
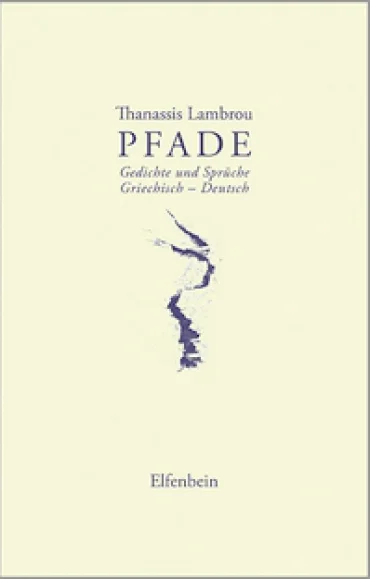
Thanassis Lambrou Pfade
Gedichte und Sprüche, Griechisch – Deutsch.
Übersetzt von Herbert Speckner, mit einem Gespräch zwischen Autor und Übersetzer.
ISBN: 978-3-96160028-1
Elfenbein Verlag, Berlin, 2019
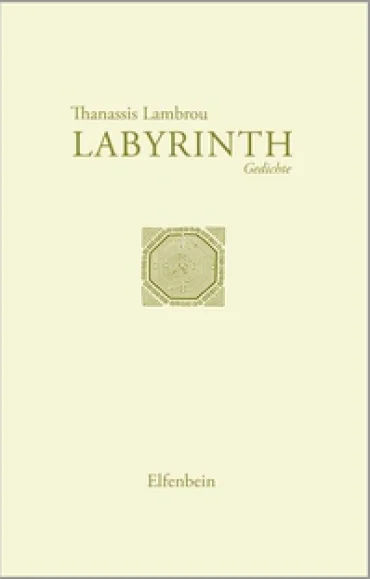
Thanassis Lambrou Labyrinth
Gedichte, Griechisch – Deutsch.
Übersetzt von Herbert Speckner, mit einem Nachwort und einem Gedicht von Durs Grünbein
ISBN: 978-3-94118431-2
Elfenbein Verlag, Berlin, 2014

Jannis Ritsos Helena
Griechisch/Deutsch.
Übertragen von der Gruppe LEXIS unter der Leitung von Elena Pallantza.
ISBN: 978-3-942901-23-9
Verlag Reinecke & Voß, Leipzig, 2017

Neue Lyrik aus Griechenland,
ausgewählt und übersetzt von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen.
ISBN: 978-3-942901-32-1
Verlag Reinecke & Voß, Leipzig, 2018

Anna Griva Glaub den Wörtern nicht. Sieh hin.
Gedichte.
Übersetzung von Jorgos Kartakis und Dirk Uwe Hansen, 92 Seiten.
ISBN: 978-3-942901345.
Verlag Reinecke & Voß, Leipzig, 2019
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


