Vom Unkenntlichmachen

Diverse Verse sind Dichtungen, die Geduld, Zuwendung und auch eine gewisse Mühe erfordern, um ihren Reichtum zu erschließen. Diese Bedingungen mögen antizyklisch sein. Sie bewahren indes das Wagnis poetischen Schreibens vor der Zernichtung im Mælstrom des Verwertungsbetriebs. Mit Marcel Inhoffs Gedichten beginnt, in loser Folge, eine Reihe von Lyrikbesprechungen, die diese Poesie im Bewusstsein halten mögen.
Es ist nicht so leicht, anspruchsvolle Gedichte zu schreiben, die sich nicht mit ihrer Ambition selbst zerstören. Kann man aber als Lyrikerin oder Lyriker weniger als diesen Anspruch sich abverlangen? 1982 im sibirischen Novosibirsk geboren, hat sich, wie man lesen kann, Marcel Inhoff als Wissenschaftler, Übersetzer, Lyriker, Schriftsteller und Leser vor allem mit Lyrik beschäftigt. Eine solche Beschäftigung über einen längeren Zeitraum bekommt ihre eigene Dynamik, und dieser Prozeß ist nicht abschließbar: Seit Jahren schreibe er keine Gedichte dieser Art mehr, teilte mir Marcel Inhoff mit.
Das ist kein gutes Argument, um eine Besprechung des Gedichtbandes, wenngleich er schon 2014 veröffentlicht wurde, zu unterlassen. Selbst der Umstand, daß Inhoffs Verlags-Debüt PROSOPOPEIA bisher die einzige Publikation der Edition Mantel war, die in Wädenswil im Kanton Zürich und in Lausanne zuhause ist, reicht nicht hin, sie zu übergehen. Der „Verlag für Poetische Literatur“ hat mit PROSOPOPEIA nicht gerade ein bibliophiles, aber in seiner Einfachheit sehr ansprechendes Werk publiziert, das mit Schwarzpapieren im Anfangs- und Endbereich, dem Großoktavformat (24,5×15,5) und der augenfreundlichen Perpetua-Schrift repräsentativ gestaltet ist.
Die Prosopopöie der antiken Rhetorik übersetzt man gewöhnlich mit „Reden durch Masken“. Inhoff schreibt indes nicht mit fremden Federn, keine Parodien. Es handelt sich aber auch nicht um Rollenpoesie, also das Sprechen in Rollen, die dem Publikum als Prototypen vertraut sind. Er „macht“ vielmehr – im ursprünglichen Wortsinn – mit einem Gedicht „eine Person“, die nicht er selbst ist. In früheren Zeiten hat man dafür den Begriff „Kreation“ benutzt. Nicht nur die Bekenntnisautoren, sondern auch die Identitätspsychologen bestreiten, daß eine glaubwürdige Erschaffung eines Anderen, der sich als Anderer mit seinen poetischen Äußerungen manifestiert, möglich ist, – wobei gleich zu fragen ist, wer denn glauben möchte, wer ein Gedicht seines Glaubens für würdig hält und welche Kriterien dafür entscheidend sind, oder wer schon glaubt. Weit verbreitet ist auch die versöhnende Meinung, daß von dem, was immer ein Autor erdenkt, ein Teil davon „in ihm“ vorhanden sein muß. Aussagen, die sich allein seiner Phantasie verdanken, stehen unter dem Generalverdacht der Uneigentlichkeit. Dagegen läßt sich einwenden, daß selbst die abseitigste Phantasie auf dem Grund von Erfahrungen steht, die ihrerseits aus auswärtigen Quellen gespeist werden, wie Erzählungen, Eindrücken aus Filmen, TV, Radio, Lektüren oder peripher wahrgenommenen Geschehnissen. Die immer wieder beschworene Authentizität der Dichtung, die offenbar den Rang eines Autors ausweist, kann nur denjenigen zufriedenstellen, der die Qualität seiner Texte nicht zu fassen weiß und deshalb als nachrangig betrachtet. Authentizität meint eine Echtheit, die sich am Ursprünglichen prüfen läßt. Die Suche nach dieser Ursprünglichkeit ist noch nicht abgeschlossen. Denn Ursprünglichkeit ist selbst synthetisch und veränderlich, wie wohl jeder Mensch, – auch der dichtende. In der ποίησις, der Erschaffung, steckt das ποῖειν, das Machen. Jedes Kunstwerk hat auch einen trivialen Aspekt, und der betrifft das Machen. Es muß deshalb nicht gleich ein Machwerk sein. Und es ist nicht ausgeschlossen, daß dem Gemachten genau das entkommt, was sich dem Machbaren entzieht.
Anders als Elias Canetti schrieb, sind die Masken, so wie sie Marcel Inhoff gebraucht, nicht starr, sondern lassen uns ein paradoxes Minenspiel schauen. So, wenn zwischen Sonne- und Mondassoziationen und Erde, Gras und Fluß, also zwischen Himmel und Erde die gewaltsame Entfernung männersprachlicher Verderbtheit gesetzt ist, nämlich aus dem Munde gerissen:
Sichel
seh die sonne
halswendend
seh den mond ich ebenfalls
thrakische sichel
knochen, fischzahn
stumpfes auge
aus meinem mund
reiss ich
das ausgebrochene holz
das zerfallene geweih
das poröse glied
ich schlage es in die erde
wo das gras sich erinnert
an den gewesenen fluss.
Sichel und Gras stehen nicht ohne Grund beieinander, auch die thrakische Sichel, die auf eine antike Waffe weist, der als Amulett getragene Fischzahn, Knochen und Auge hat nicht der Zufall zusammengeweht. Aber eine Erklärung, denke ich, würde da, wo die Aussage in der Bild-Konstellation steckt, nichts klären. Ebenso wehren sich die letzten drei Zeilen gegen eine Deutung – wie die Weissagung einer rückwärts gewandten Sibylle.
Ich gestehe, daß ich nach anfänglicher Begeisterung für die „Doppelinterpretationen“, die 1966 von Hilde Domin herausgegeben wurden, relativ rasch eine Abneigung gegen jegliche Gedichtinterpretation entwickelt habe, die, nach meiner Erfahrung, auf eine geradezu bürokratische Entschlüsselung verschlüsselter Texte hinauslief, die man Gedichte nannte. Ich gewann die Überzeugung, daß ein Gedicht, das sich auf solch einfältige Weise dechiffrieren ließ, nur mißlungen sein konnte.
Marcel Inhoffs Gedichte bestätigen mir noch einmal diese Sicht. Denn was sollen uns mit Zitaten gespickte Paraphrasen eines Gedichts, die so viele „Interpretationen“ kennzeichnen? Wer sich auf Inhoffs Gedichte einläßt, ist auch schon mittendrin im Unvereinbaren und Paradoxen. Diese Paradoxa wiederum erscheinen hier nicht modellhaft, sind keine der verdeckten Parabeln, die stets darauf hinauslaufen, daß das Leben eben so sei, wie es ist.
Das Gedicht „Franziska“ etwa – dem unwissenden Leser wäre auch jeder andere Name recht – macht ein Geschöpf kenntlich, das seinerseits obsessiv auf seiner Urheberschaft besteht, Aggression, Gewalt und Unsicherheit bekennt und sich als täglicher Wiedergänger vorstellt. Das ist bedrohlich und verweigert eine Auslegung.
Franziska
ich war länger hier
als alle anderen
ich habe die strassen benannt
ich verwende vier
verschiedene pinsel
wenn ich male
nicht fünf, nicht drei,
genau vier
darauf bestehe ich.
ich werfe ton gegen fenster
und katzen in brunnen
ich laufe rot an
wenn ich neuankömmlingen
meinen namen zuflüstere
ich war vor ihnen hier
ich war länger hier als alle anderen
ich habe die strassen benannt
ich habe mein herz orangefarben bemalt
ich sterbe nachts
aber ich komme immer wieder.
Marcel Inhoffs Gedichte sind, im Wortsinne, Wortkompositionen, deren heterogene Bestandteile miteinander montiert sind. Diese Montagen mit ihren unvermittelten Übergängen, ihren absichtlichen Diskontinuitäten lassen Empfindsamkeit und Gewalt aufeinanderprallen wie Sinngebung und Sinnentzug. Nun ist ein Gedicht, das diese Bezeichnung verdient, immer mehr, als sich verstehen läßt. Aber daß ein Gedicht desto wertvoller sei, umso unverständlicher es ist, gehört zu den Aporien, die den Leichtgläubigen den poetischen Zugang versperren. Wie ein Trost liest sich dagegen, was Friedrich Schlegel im Athenaeum über die Unverständlichkeit notierte:
„Ja das köstlichste was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit selbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muß, dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte. Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr es fodert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde.“
Ja, und deshalb sind die Spuren, die in den Gedichten Inhoffs aufzufinden wären, auch für erfahrene Pfadfinder nicht recht zielführend. Im hermeneutischen Denken sind sie falsche Spuren, – vielleicht nur weitere Masken, wie in „Vivetta“.
Vivetta
vivetta, auf latein,
liest, legt wort für wort in das wasser
und es hält das gedicht in der waage
ohne die spröden tischriffe zu benötigen
die korallenroten.
dieses zimmer ist randvoll mit wasser
die dauben am fenster
sind gespannt wie hölzerne bögen
noch hält es, noch bin ich hier
und dort die welt
die fliesen lösen sich von der wand
und schielen nach mir, misstrauisch
begaffen sie den tintenschnaufer
ein langes graues tier schleicht aus der wand
lang kann ich hier nicht bleiben
lang darf ich hier nicht bleiben
zwischen meinen blättern und büchern
das gemauerte aus worten
muss ich zurücklassen und vivetta,
lateinisch.
Wer in den lateinischen Wörterbüchern nach vivetta stöbert, findet nichts. Wer aber im Internet danach sucht, stößt gleich auf Vivetta Vivarelli, Professorin für deutsche Literatur an der Universität Florenz, zu deren wichtigsten Veröffentlichungen das Buch „Nietzsche und die Masken des Freien Geistes: Montaigne, Pascal und Sterne“ zählt. Darin gibt sie auch den Hinweis auf Nietzsches 40. Aphorismus in „Jenseits von Gut und Böse“, der so beginnt:
„Alles, was tief ist, liebt die Maske; die allertiefsten Dinge haben sogar einen Haß auf Bild und Gleichnis. Sollte nicht erst der Gegensatz die rechte Verkleidung sein, in der die Scham eines Gottes einherginge? Eine fragwürdige Frage: es wäre wunderlich, wenn nicht irgendein Mystiker schon dergleichen bei sich gewagt hätte. Es gibt Vorgänge so zarter Art, daß man gut tut sie durch eine Grobheit zu verschütten und unkenntlich zu machen …“
Sollte „auf latein“ oder „lateinisch“ – über die Banden gespielt – sich ebenfalls einem Vivarelli-Hinweis (in „Bacchus und die Titanenkämpfe als Gründungsmythen bei Hölderlin und Horaz“) verdanken und damit auf Hölderlin verweisen?: „Für Hölderlin war die lateinische Sprache fast eine Zweitsprache. Die Kunst des Übersetzens blieb ‚als heilsame Gymnastik für die Sprache’ für ihn eine ständige Herausforderung wie auch seine Übersetzungen aus dem Lateinischen beweisen, von denen einige experimenteller Art sind.“ Und wohin wollte uns wiederum Hölderlin führen? – Das Gestrüpp der Verweise bleibt zwischen Blättern und Büchern letztlich unzugänglich, wenn der surrealistische Wasseranstieg nicht ein Drittes zeitigen sollte. –
Die Verschiedenheit der Masken erfordert unterschiedliche poetische Konzeptionen. So pflanzt das Ich in „Kultur“ – ein Wort, das auf das lateinische colere (bebauen, pflegen) zurückgeht – das an, was anzupflanzen nicht möglich ist.
Kultur
Ich baue Wind an.
Ich pflanze Erde auf meiner Schwelle
und karges Gestein auf meiner Matratze.
Jim Beam letzte Nacht
und in der Nacht zuvor
begegnen sich im Dunklen.
Ich kann das Haus nicht verlassen:
das Licht ist zu lang
und zu kurz für mich.
Ich passe nicht in den Tag.
Ich habe hier Schatten gepflanzt,
echte Waldschatten.
Ich pflüge den Teppich:
ich habe fleisch gesät.
In diesem Gedicht werden die Nomen groß geschrieben, außer „fleisch“. Als Fleisch gehörte es dann in die Gegenstände, die nicht gepflanzt und nicht gesät werden können. Naheliegend ist, „fleisch“ als einen bewußten Verschreiber, der das „falsch“ ersetzt, zu lesen. Dann wäre es, analog zu Arnulf Rainers Übermalungen, als Überschreibung zu nehmen, als ein unkenntlich Machen. Die starke, ans Existentielle rührende Signalwirkung der Fleischvokabel aber geht, bei aller Ambivalenz, zusammen mit dem Pflügen des Tepp-ichs in einem grausigen Schlußbild auf, das ganz im Sinne von Nietzsches Verschütten und Unkenntlich Machen – auch des Vorangegangenen – verstanden werden kann.
Im Angelsächsischen ist der Charakter das, was bei uns die Theaterrolle ist. Wir gebrauchen das Wort Charakter aber hauptsächlich im Sinne einer individuelle Prägung, die oft auch wertend verwendet wird: guter oder schlechter Charakter. Das wiederum entspricht Festlegungen, die bei der persona auf dem Theater eine Rolle spielen. In dieser Ambivalenz, die der ‚individuellen Maske’ eignet, sind die Gedichte Marcel Inhoffs situiert. Sie sind durchzogen von Setzungen, kontingenten Interventionen, bedrohlichen Zerstörungen vermuteter Zusammenhänge und albträumerischen Bildern. Mit empfindsamem Sprachbewußtsein sind darin Kraftfelder installiert, die einen wesentlichen Teil ihrer ästhetischen Wirkung ausmachen – also auch ihre Schönheit. Denn Inhoffs Poesie ist im besten Sinne des Wortes durchgebildet. Das wenigstens kann man ohne Zweifel über sie äußern.
In einem der Gedichte – und damit soll es genug sein – greift er zu einem gern gezeigten Charakter der Bühnenkunst, zur Maske des Demaskierten, des Ungeschützten.
Angst
dass man sich nicht verbergen kann
vor dem eigenen wort aus tinte
und wäre man blind
und wär man der talentierteste lügner.
dass man mitschuldig ist
am fahnenflüchtigen wort
das sich im dämmer vom papier schluchzt
das morde begeht im zwielicht des schlafs.
dass man nicht verschwinden kann
im unterholz des aufsteigenden rauchs
Letzte Änderung: 23.03.2022 | Erstellt am: 22.03.2022

DIVERSE VERSE
Die Aktualität der Poesie ist epochal. Anders als Nachrichten oder andere zeitgebundene Sendungen und Schriften sind Gedichte nicht auf sofortige Verbreitung angewiesen. Und anders als Fisch und Fleisch sind sie nicht verderblich. Sie haben Zeit, und sie brauchen Zeit, vor allem, wenn ihre Zugänge nicht schon geöffnet sind. Und irgendwann ist es an der Zeit, sie zu besprechen, und Gelegenheit, öffentlich über sie nachzudenken.
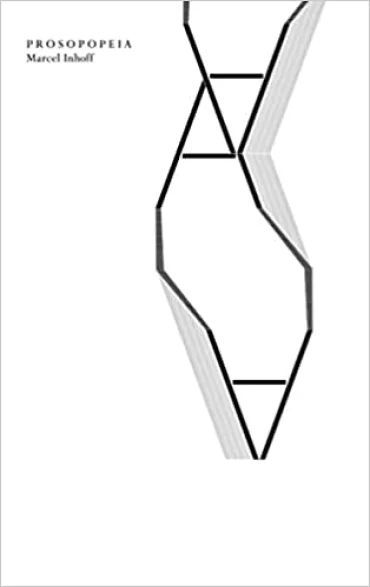
Marcel Inhoff PROSOPOPEIA
110 S., brosch.
ISBN: 978-3-033-04392-3
Edition Mantel, Wädenswil / Lausanne 2014


