Peter H.E. Gogolin: Die unerzählbare Geschichte
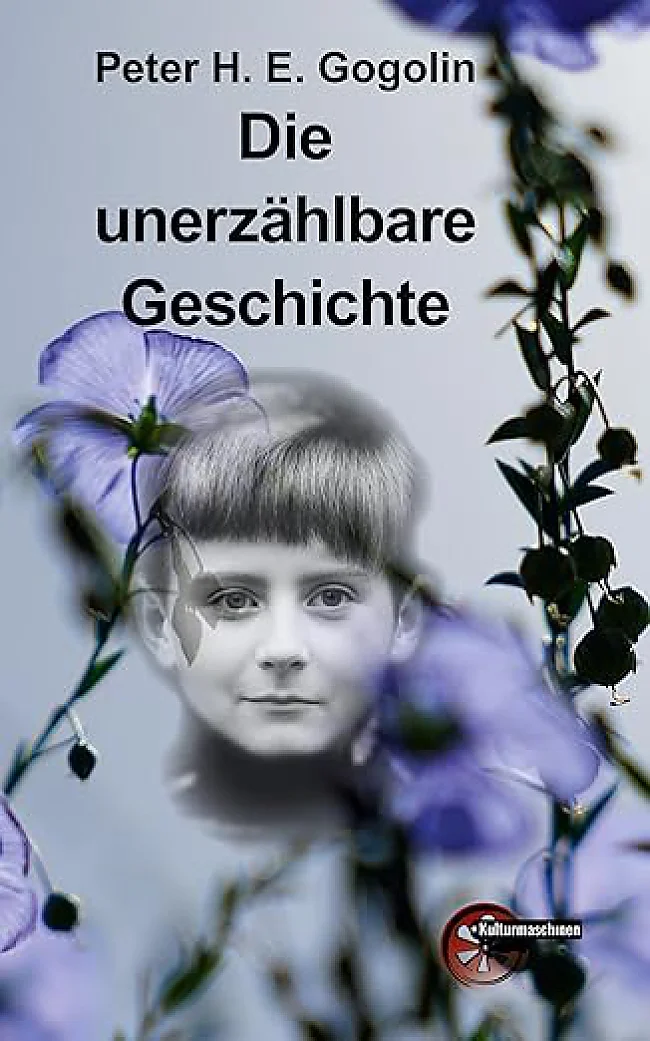
In „Die unerzählbare Geschichte“ entwirft Peter H.E. Gogolin eine dichte literarische Collage über Abschied, Erinnerung und ein lebenslanges Familiengeheimnis. Ute Stefanie Strasser fragt in ihrer eindringlichen Rezension: Ist das letzte Wort wirklich beim Autor – oder liegt es bei uns Lesenden?
Sein neues Buch Die unerzählbare Geschichte etikettiert der Autor Peter H.E. Gogolin mit dem Untertitel … kein Roman. Und im PROLOG heißt es: Dies ist eine wahre Geschichte, und wahre Geschichten seien nicht rund und stimmig wie ein Roman. Dann nimmt uns in ZEHN TAGE UND DAS GANZE LEBEN ein Erzähler mit an das Sterbebett seiner Mutter. Mit ruhiger Stimme, auf unsentimentale Weise berichtet er von seinen Bemühungen, diesen besonderen Tagen unter dem Basso continuo des mütterlichen Atmens eine Struktur zu geben, er berichtet von seinen hilflosen überflüssigen Tätigkeiten um sie und an ihr, von der Auseinandersetzung mit den eiligen Pflegerinnen mit ihren Kontrollblättern im Aktenordner zum Zwecke der abzurechnenden Leistungen, vom flüchtigen Besuch des Arztes, vom Versuch, mit der Sterbenden zu kommunizieren.
In diese Berichte eingeflochten sind Reflexionen über das Geheimnis des Todes, Anrufungen des großen Abwesenden und biographische Bruchstücke, in deren Mittelpunkt die enge Beziehung des Sohnes zur depressiven Mutter steht, die sich über Jahre (bis zu einer medikamentösen Behandlung) immer wieder einmal vom Esstisch erhob und unter Androhung des sich Erhängens auf den Dachboden begab. Dorthin folgte ihr der Erzähler, als das älteste Kind von etwa zehn Jahren, während der Vater und die beiden kleineren Brüder stumm und anscheinend emotional unbeteiligt sitzen blieben. Und dann sitzen er und seine Mutter auf dem Dachboden und sie erzählt ihm von einem Mädchen am Pranger, von einem angedrohten Totschlag, von einem erstickten Säugling; drei Geschichten, die mächtige Bilder in ihm hinterlassen und für mich im Zentrum des Buches stehen. Was bedeuten sie? Warum wurden sie ihm mitgeteilt? Ein Leben lang schon ringt der Autor um die Aufklärung dieser Fragen – und scheute doch bislang auch davor zurück.
In eingestreuten Gedichten und Prosastücken aus seinem umfangreichen literarischen Schaffen lässt er uns die Spuren seines Ringens, seiner diesbezüglichen Vermutungen und Empfindungen verfolgen. Nun ringen wir mit ihm, doch die Bedeutung der Dachboden-Geschichten und der Sinn ihrer Weitergabe an den Zehnjährigen bleiben in der Erzählung offen.
Insgesamt lese ich diesen Bericht von den Tagen am Sterbebett mit seinen biographischen Rückblenden und philosophischen Reflexionen vor allem als eine von tiefer Zuneigung geprägte elegische Hommage eines Sohnes an seine erste große Liebe. Es ist tief berührend, wenn der Erzähler bei der Übersetzung der Cantos von Ezra Pound (eine Arbeit, mit der er sich neben der Schlafenden beschäftigt) in dessen Vision der Nike von Samothrake seine Mutter erkennt, wie sie schlank und stolz am Meer steht. Immer ist es die Göttin, schreibt er, gleichgültig, ob sie mit den Strahlen der Sonne um den Preis der Schönheit konkurriert oder im Bett der Greisin liegt … (S.69-71).
Im zweiten Teil des Buches EIN SCHMIED ZU SAMHAIN, an dessen Anfang ein Traum vom Vater und an dessen Ende die Beisetzung der Mutter thematisiert wird (die Genanalyse des Autors ordne ich dem Epilog zu), beleuchtet der Autor den eigenen Werdegang, seine Betroffenheit durch die Shoah und die väterliche Familie und rückt den durch den Krieg beschädigten Vater würdigend in den Mittelpunkt.
Im EPILOG kommt der Autor zu einem abschließenden Urteil: Die vergangene Nacht hindurch lag ich wach, nicht nur, weil über Stunden schwere Gewitter ums Haus tobten, sondern da mir endlich unwiderruflich klar geworden war, was … ja, was es mit den Dachboden-Geschichten auf sich hat und er deckt damit das zentrale Geheimnis seines Lebens auf, das während der ganzen Lektüre im Hintergrund rumort und Spannung und Leselust erzeugt.
Macht er damit, aus diesem Teil des Buches, aus der wahren Geschichte um seine Mutter, letztendlich doch einen Roman? Und also ein literarisches Werk, das uns Leserinnen und Lesern eine eigene Lesart erlaubt? Ist das vom Autor im Epilog mittgeteilte Fazit für mich als seine Leserin verbindlich? Oder habe ich den Freiraum, die Erzählungen der depressiven Mutter und die Fremdheit des Autors in seiner Primärfamilie anders zu interpretieren, als er dies tut? Befinden sich Autor und Leserinnen und Leser auf Augenhöhe?
Ich habe das Buch nicht konsumiert und abgehakt, ich habe mich als egoistische Leserin gebärdet, wie dies Charles Dantzig beschreibt: Ein guter Leser schreibt, während er liest. Er umrandet, streicht durch, kritzelt Kommentare … (in: Wozu lesen) Ja, nur so macht mir Lesen Freude. Und so kam ich zu einer anderen Lesart, zu einer anderen möglichen Interpretation der mütterlichen Dachboden-Geschichten. Darf ich das? Darf ich der Schlussfolgerung des Autors im Epilog eine eigene als alternative Möglichkeit zur Seite stellen? Oder muss ich die mir vom Autor mitgeteilte Auflösung übernehmen?
Denn zu bedenken ist freilich, dass sich die Auflösung des Autors wahrscheinlich aus einem wesentlich umfangreicheren und ihm selbst vermutlich nicht vollbewussten Wissen speist, dass er viel mehr Informationen hat als ich seine Leserin, die nur das davon Aufgeschriebene kennt. Um meine mir daraus gebildete Position zu erläutern, müsste ich sehr detailliert auf den Inhalt des Buches, diese brisante Mischung aus Fakten und Fiktion, eingehen. Das würde den vorliegenden Rahmen sprengen. Nur so viel: Es ist ein tragisches, ein schönes, ein wahres Buch, eine ungemein dichte Collage aus berührenden, zu Herzen gehenden Szenen, Berichten, Geschichten und lyrischen Passagen. Lesen Sie es! Übernehmen Sie des Autors Schlussfolgerungen bezüglich der Kernerzählung um die Mutter? Oder? Die Diskussion ist eröffnet!
Letzte Änderung: 11.08.2025 | Erstellt am: 06.08.2025
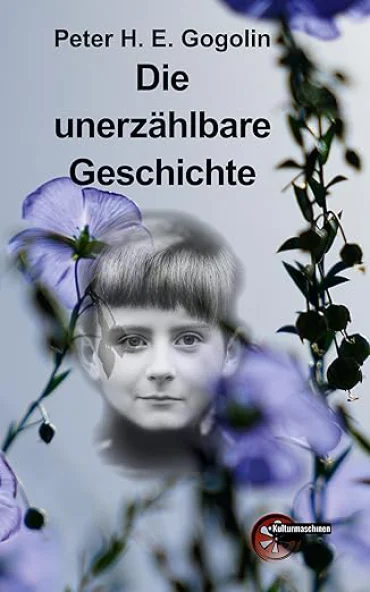
Peter H.E. Gogolin Die unerzählbare Geschichte
kein Roman
412 Seiten
Kulturmaschinen Verlag Ochsenfurt 2025
19 €
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


