Mit vollen Händen das Meer ausgeschöpft

Aus sechs zweibeinigen Hunden soll ihr Unterleib bestanden haben, und ein gewisses Problem bestand darin, dass Skylla sechs Besatzungsmitglieder vom Schiff des Odysseus verspeist haben soll, während er der ebenfalls gefräßigen Charybdis auswich. Hier, am Ort des Geschehens, auf der engen Straße von Messina, ist das Zentrum des großen epischen Romans „Horcynus Orca“ von Stefano D’Arrigo. Alban Nikolai Herbst ist mit dem Buch in einen Leserausch geraten.
Was ist an einem Buche gelegen, das uns
nicht einmal über alle Bücher hinaushebt?
Nietzsche
Stellen Sie sich etwa 13 km oberhalb Messinas ein Fischerdorf im Kriegsjahr 1943 vor, fast genau dort, wo Charybdis mit, gegenüber, der kalabrischen Skylla — die gefürchteten Meerungeheuer Homers — seit je die Seefahrt bedrohte. „Unberührt“, wie man sagt, ist der Flecken allerdings nicht, auch in ihn hat sich der Krieg eingewetzt. Seit der alliierten Besetzung Siziliens ist die Ausfahrt über die Meerenge strikt verboten, weshalb die von Stefano d’Arrigo so genannten „Pellisquadre“ schwersten Hunger leiden, zumal so gut wie alle jungen Männer zum Kriegsdienst ausgehoben worden sind und, sofern nicht gefallen, invalide oder sonstwie geschädigt zurückkehren werden. Andrea Cambrìa aber, sizilisch `Ndria, kommt unversehrt heim. Ist er, wie sein Vater einst, desertiert? – dessen Sehnsucht nach seiner jüngst angetrauten Acitana derart groß war, daß er mit Tabak versetztes Wasser trank und aus dem Lazarett als unheilbar vergiftet entlassen wurde. Doch endlich daheim, ist sie verstorben. – `Ndria hat nichts dergleichen getrunken, steht draußen dennoch vor der Tür; Caitanello faßt es so wenig, daß er den Sohn beinah abweist. Der seinerseits zurückschreckt: Was bereitet der Vater da zu?! Den Essig in der Nase, in dem das Zeug gekocht wird, sieht `Ndria es fassungslos an. Und soll dann auch noch kosten!
Von Haus aus eh Akrostichon, wird Essig zur Metapher.
Doch `Ndria wird ihn los:
Alt ist er geworden (…), mein Don Caitanello (…) , alt, wiederholte er vor sich hin, und beim Wiederholen war es ihm, dass auch seine Jahre irgendwie im Verhältnis zu den Jahren seines Vaters zunahmen (…) und sich denen an(näherten), in denen sein Vater zu seinem Vater wurde. Auch das empfand er zum ersten Mal, und es war auch das erste Mal, (…) bei dem die Zeit, die er im Krieg verbracht hatte, (…) ihm plötzlich auf die Schultern sank wie eine so schwer zu tragende Last, dass er spürte, wie seine Knie nachgaben. Ebendas läßt ihn, `Ndria, sich wieder auch in die Dorfgemeinschaft, modern ausgedrückt, integrieren. Es ersteht ihm sogar eine Liebe: Ohne auch nur einmal die Augen von ihm abzuwenden, ließ Marosa völlig stumm ihren Gefühlen freien Lauf, stützte dabei ihren Arm mit dem anderen ab und quälte mit den Zähnen ihre Lippen, die heftig bebten. Mit ihren Augen streifte sie immer wieder über seine Gestalt, und ihm war, als würde er gewissermaßen die Berührung spüren, die Schwere dieses Blicks, der seine Augen erkundete, ( …) die Stirn, die Schläfen (…).
Eine Art Zufall spielt ihm den Job eines Ruderers zu. Unerachtet der zerbombten Stadt hat es sich Messinas (…) „Town Major“ in den Kopf gesetzt, eine Regatta aller im Hafen liegenden Truppen zu veranstalten und schickt nun einen Malteser aus, nach durchtrainierten Burschen auch für Sizilien zu suchen. Mitten im Krieg eine Regatta? Eine Regatta nicht nur mitten im Krieg, sondern auch noch mitten im Hafen, (…) der prall wie ein Ei mit Kriegsschiffen der englischen und amerikanischen Flotten angehäuft war (…). Doch wo noch solche Kerle finden, dreizehn junge Männer (…), die nicht im Krieg (…) den Tod gefunden hatten, die keine Gefangenen, keine Verschollenen und keine Versprengten waren? – In einer Kutsche klappert er die Küste hoch ab. „Ihr Frauen, habt ihr Männer im Haus? Junge Männer, Burschen, die sich fünfhundert Lire mit vier Ruderschlägen verdienen wollen?“ Und stößt auf `Ndria. Um die zwölf andern soll der sich jetzt kümmern. Fünfhundert Lire, fünfhundert Lire.
Endlich ist die Mannschaft beisammen. Jetzt aber schnell! Trainieren! „Alle an die Riemen!“ Eintauchen und Heben, alle genau im selben Augenblick, keinen Tropfen früher und keinen Tropfen später. So rudern sie zwischen den Schiffen hinaus und draußen um den Flugzeugträger rum, von dessen Heck … plötzlich … ein Schuß! … Da hat ihn, `Ndria, der Krieg mit einer Kugel jetzt doch noch erwischt, die zwischen seinen Augen mit einer Wucht einschlug,
– daß sie bei mir die Wirkung verfehlte. Sie kam mir als Ende dieses 1454seitigen Buches einfach nur abrupt vor, das fast jede andere Szene sonst mehrfach codiert, kunstvoll variiert hatte: Wollte der Autor seine fast zwanzig Jahre währende Arbeit derart unbedingt hinter sich lassen?
Jedenfalls läßt sich der „Plot“ dieses Kolosses ziemlich schnell erzählen. Da ich’s nun tat, hab ich nicht mal „gespoilert“ – ist er doch lediglich der Anlaß dieses Romanes aus der Menschheitsküche, eines, wie es in Deutschland lang keinen gab. Denn das ist fast zuerst zu sagen, dass der „Horcynus Orca“ in Moshe Kahns, seines Übersetzers, zum Hinknien wendigem Deutsch ein ebensolches Kunstwerk wie das Original ist – womöglich auch, weil das Sizilianische ganz wie das Deutsche das Satzprädikat hintanstellt, anders als das Italienische, und sich zwischen ihm und dem Subjekt, schreibt im Nachwort Kahn, „wahre syntaktische Abenteuer abspielen“ können. In die hat er sich mitgestürzt. Meine Rezension ist deshalb eine Besprechung fast mehr seines Buches als eine über d’Arrigos.
Vergleichen wir nur Era l’Orca, quella che dà morte, mentre lei passa per immortale: lei, la Morte marina, sarebbe a dire la Morte, in una parola mit „Es war die Orca, die Todbringerin, die selbst aber als unsterblich gilt”: sie, die Tödin der Meere, oder, mit einem Wort, die Tödin schlechthin.“
Im Italienischen ist das Wort für den Orka ebenso weiblich wie das für den Tod. „Tödin“ und „die Orca“ sind also keine Manierismen, sondern insofern auch sinnhaft Übertragung, als im Italienischen weiblich sogar der den Roman grundierende Krieg ist, „la guerra“. Wie überhaupt die entscheidenden Momente des Buches von Frauen, Feminotinnen, bestimmt sind, die man auch Sirene nennen konnte, ohne Gewissensbisse zu bekommen, und daß, wenn man sie als Metapher verstand, (…) auch ein Fundament von Wahrheit sichtbar wurde. Dazu Kahns eigene Findungen: „Weltenendchaorioles“ (finimondorioles), „sich verschwähern“ (s’incommarare), “hurenschlägig“ (sdiregnatrice). Ebenso “mannswesisch“ (sperta di masculazzo) und “Völlervögel“ (scassati di pancia) sowie „entflukt“ für „scodato“ oder das entzückend „hundepimmelige Thema“ (sogetto a cazzodicane). Besonders schön auch „erohräugen“ für d’Arrigos oreocchiare. Era l’Orca, quella che dà morte, mentre lei passa per immortale: lei, la Morte marina, sarebbe a dire la Morte, in una parola. Als deutsche Wörter sind es neue für sich, die uns wunderbar bereichern, abgesehen davon, dass sarebbe a dire in „schlechthin“ zu kondensieren, herrlich elegant ist.
Und eigentlich wird andres erzählt, – geradezu leitmotivisch etwa von den „Feren“, wie die Fischer die ihnen verhaßten Delphine nennen. Grausame Rivalen um den basalsten Lebenserhalt, zerreißen sie ihnen die ausgeworfenen Netze, das dauernde Lächeln ihrer Schnäbel und ihr ständiges Gekicher wird als hämisch erlebt: … seht Ihr, dieser Dreck von Fleisch, das ist eine Fere, (…) eine Fischbestie, mit Verlaub gesagt, (…) launisch, schädlich und ekelhaft (…). Doch die Delphine gehn dem Orka nur voran, der Orca, siehe oben „la guerra“. Der Killerwal selbst taucht erst auf Seite 834 auf, bemächtigt sich der Handlung aber dann – wie Naturkatastrophen in ihren unterirdischen Ursprüngen, wenn man noch kein Zeichen von ihnen wahrnimmt, sie aber längst schon unter unseren Füßen sind. Auch den Krieg nehmen die Pellisquadre so wahr. Es gehört zur Größe dieses Romans, dass er durchweg ihre Sicht übernimmt. Auf Sizilien bleibt die Zeit dabei stehn; was längst vergangen, wirkt subkutan weiter. Noch lange wurde für die Anrede Lei das längst antiquierte Voi, also „Euch“, dort verwendet; ich hab es selbst noch gehört. (Als ich 1986 in Enna monierte, der Aufzug funktioniere nicht, erwiderte der ergraute Alberghiero: „Jè a guìerra“, so seit halt der Krieg) Auch daher rührt die zugleich mythische Struktur des über weite Strecken am Neorealismo geschulten Buchs: Er hatte das Eisen aus dem Fleischstück gezogen und (…) gleich wieder (…) zurückgesteckt, um das Blut einzudämmen, das daraus hervorquoll. Dann hatte er die drei Zacken in aller Eile mit der Spitze des Schlachtermessers wie einen Knochen gereinigt (…). Dabei kann den Vergleichen eine durchaus phantastische Aura entströmen: lange Schenkel und Stelzvogelbeine mit breiten, schwarzen, staubigen Sohlen unter ihren stets nackten Füßen, (…) beseelt vom Mark der Rotangpalme, das ihnen diese Bewegung eines zitternden Stamms verleiht (…). Häufig sind sie noch im fast selben Atemzug … – ja, seelenkundig: Zuerst blieb sie mit offenem Mund da stehen, wie verkindischt, (…) sah dann unbeirrt starr in seine Augen mit ihren Augen, die, wenn man sagte, dass diese Augen immer mehr die Augen einer Verkindischten wären, für ‘Ndria das Gleiche war, als würde man sagen, dass er sie in diesem Augenblick sah, wie sie ihn mit den Augen von früher ansah, (…) als (…) man die Mädchen (…) von den Jungen alleine dadurch unterscheiden konnte, dass ein Mädchen nicht gegen die Wand pinkelte (…), sondern auf die Erde und sich dafür auf die Fersen hockte (…). – Dieser uterine Ton (tono femminino, uterino) durchzieht das ganze Buch.
Dabei werden die meist liebevoll gezeichneten Charaktere zuweilen allegorisch, insbesondere wieder die Frauen, deren erotische Wirkung auf Männer eine bezeichnende Verbindung zu den Feren schafft: Feminotinnen und Feren behandelten sich ihrem Charakter nach in allem gegenseitig, wie sie es verdienten, und vielleicht war ja auch etwas Wahres an dem, was Don Mimì Nastasi behauptete, nämlich dass sie (…) alle beide in schrittweiser Folge von den Sirenen abstammten. Womit eine ganz andere Erzählung über die „Teufelsbestien“ (diavolone) angeschlagen ist. Denn so, wie es den Ferhunger gibt („la ferame“), den Hunger als Fere (der die Pallesquadre deren widerwärtiges Fleisch essen läßt), umgibt sie auch ein Geheimnis, die jene große, streng persönliche Sache ganz allein mit sich ausmacht und zu ihrem verborgenen Friedhof zieht, um dort einen vorzeitigen Tod zu sterben aus vermeintlicher Scham und Würde sich selbst und anderen gegenüber (…). – Ebenso enteinzeln sich bisweilen die Fischer, wie wenn sich einer im anderen spiegeln würde, was ihnen den Anschein eines (…) Menschen gab, (…) der aus den Stücken der Gestalt aller (…) gebildet war. Und wenn die „tausendundeinnächtige“ (milunanotte) Ciccina Circé den zurückgekehrten `Ndria von Skylla nach Charybdis (da scill’ a cariddi) übersetzt, ist ihr Boot in Wahrheit eine Bahre, deren Charon also ebenfalls weiblich und die Meerenge Styx. Was wir erst Hunderte Seiten später begreifen und deshalb noch im Kopf haben mußten; nur dann verstehn wir Witz und Tragik, vor allem aber die Seele dieser Prosa, als würde er nach innen sprechen, mit verfangener Zunge („con la lingua imbrogliata“). Ihr enormer Reichtum läßt sich nur so zum Leuchten bringen – durch das, was eben nicht „Plot“ ist, sondern ein Zustand, legt dies Erzählmeer uns nahe, in einer Stille ohne Schaum. Wenn wir in einer S-Bahn auf die nächste Station achten müssen, vernähmen wir sie nicht, geschweige zu merken, wie „uralthervor“ wir mit einem Mal in der Ilias sind: Verkleide dich als Frau, hab ich dir gesagt. Du musst dir nur die vier Härchen über der Lippe abrasieren (…), und solange Krieg herrscht, mischst du dich unter uns Frauenvolk (…). Ciccina Circé ist zu Thetis geworden, der antiken Meeresnymphe, und `Ndria momentlang Achill. So sagen die Fischer denn auch, wenn sie „etwas im Kopf behalten“ meinen, „in mentedei“ (im Geiste Gottes).
Der realistische Kritiker freilich ruft aus: „So sprechen einfache Leute nicht!“ Bloß dass es, selbst hätte er recht, vorbeiging’ an Charakter und Mär dieser Dichtung und allem, was uns hoffen läßt: D’Arrigos „einfache“ Menschen sind nicht einfach und schon gar nicht stumpf, niemals, mag ihr Schicksal sie noch so beuteln. Egal, in welcher Be-, ja Gedrücktheit sie leben, ganz wie die sterbenden Feren behalten auch sie sich Würde und Stolz. Von Klassenstolz ließe sich sprechen, doch ist’s „nur“ der ihres Fischerstands und sowieso zutiefst sizilianisch. Ins Schicksal ergeben sind sie allenfalls als Alte, denen die mit ergreifendsten Passagen gewidmet sind – jenen „Ohmahnen“ (nonnavi), die hinaus auf See nicht mehr können und morgens am Strand auf ihren verwitternden Stühlen sitzen, teils, weil klapprig wie die, hinausgeleitet werden mußten und schauen nun schweigend aufs Meer. Doch selbst sie sind nicht Opfer, sondern lehnen sich auf, jedenfalls manche, wie Caitanello, wenn er, dieser völlig Verrückte, diese Demütigung nicht mehr ertragen konnte, blindlings mit dieser Nußschale von Borietta hinausfuhr, aufs Meer, inmitten all dieser unendlichen Mengen von Feren, selbst wenn es ihn das Leben kostete, sofern es nur das eines Löwen war. Deshalb will ich auf keinen Fall von der großartigen Erzählung schweigen, die einen anderen Greis beschließen läßt, heimlich noch einmal in See zu stechen – endgültig im Wortsinn. Ferdinando Currò war allerdings nicht alleine verschwunden. Sebastiano Schirò, Vito Imbesi und Cono Ritàno (…) waren ebenfalls nicht mehr da, auch ihre Stühle waren ohne sie im Morgendämmer sichtbar geworden. Zugleich mit ihrem Verschwinden bemerkte man auch das Verschwinden der Borietta (…). Doch wer hatte gerudert? Wer hatte das Ruder bedient? Und dann musste die Mannschaft dieser Ohmahnen weit auf die Ferne zugehalten haben, sehr weit auf die Ferne, zu dem Meer, wo man keine Fische fischt, und dies war der am wenigsten lösbare Teil des Rätsels.
Geschichten um Geschichten wölben sich aus d’Arrigos Geschichte heraus. Meisterhaft dialogisch das ewiglange Palaver, als der Kadaver des Orkas endlich auf den Strand gehievt ist. Was sollen die Pellisquadre, dürfen sie mit ihm tun, wollen sie nicht ihre Ehre verlieren? Es ist dies schon deshalb eine der eindrücklichsten Passagen des Romans, weil sich der Sprecher und Ratgeber des Dorfes, der fast schon greise, doch nobel weise Don Luigi Orioles im Wortgefecht laufend verändert; zu `Ndrias Entsetzen, der ihn seit Kindheit verehrt, wirkt er unversehens dement, dann wieder völlig bei sich – ein auf dem gleichsam Basso continuo der Gedanken `Ndrias unentwegtes Vexierbild, in das obendrein die anderen Pellisquadre hineindisputieren.
Welch ein poetisch vollkommenes Handwerk! Wenn auf Seite 1388 steht, die Pellisquadre hätten wie Zwerge gewirkt, die das Meer mit der Hand ausschöpfen, haben es hier zwei Riesen mit der Sprache getan – Moshe Kahn wie d’Arrigo. Eben nicht `Ndria, sondern sie ist der Held des Romans, seine Heldin. Dies macht das Buch unverfilmbar – ein Kennzeichen jeglicher Dichtung. Auch deshalb wird keine Rücksicht auf woke „Correctness“ genommen: Das Buch ist nicht nur oft grausam – notwendigerweise, schließlich herrscht Krieg –, sondern bisweilen ausgesprochen brutal, extrem beim Ferenkampf gegen die Orka, deren Blas indes ein männlicher ist: … was die Form und die Dimensionen angeht, würde der wirklich wie angegossen als Schwanz, ja Riesenschwanz (…) passen. Die Gruppe um Don Luigi wähnt in dem „Tiergiganten“ (l’animalone) eh den toxischen Mann; toxisch ist die Frau, „la guerra“, eben aber auch. So ihr Sexuelles, fünf Jungens sind die Beute: Tatsächlich sah sie sie an, und dabei leckte sie sich mit ihrer kleinen Zunge die Lippen, als würde sie bereits deren Krümel aufsammeln (…), dann öffnete sie ihren Morgenmantel, nahm eines ihrer kleinen, spitzen Ziegenbrüstchen in die Hand, führte ihren Mund dicht heran und (…) wölbte ihre Lippen vor (…). Oder Ciccina Circé: „Haltet mich, drückt mich, zerreißt mich ganz …“, flüsterte sie mit ihrem Atem zwischen den Zähnen. – In gewissem Sinn ist dieses Buch barbarisch. Die Menschen sind vom Krieg in eine Art Naturzustand zurückgestürzt worden.
Dennoch gibt es witzige Partien, etwa wenn es sich eine junge Feminotin, an der kalabrischen Küste noch, angewöhnt hat, sich in den Hohlraum eines von einer gestürzten Statue abgebrochenen Kopfs Mussolinis zu erleichtern, den sie als Pisspott mit sich herumträgt, so dass wir – anders als bei Hitler, diesem, wie D’Annunzio ihn nannte, „Flachpinsel-Attila“ – unvermittelt begreifen, wie groß seine, Mussolinis, auch erotische Anziehung gerade auf Frauen gewesen sein muß. Bis das Entsetzen des Krieges über sie hereinbrach.
Zart sind hingegen die beiden großen Menschenlieben des Buches, Acitanas, der Mutter `Ndrias, zu seinem Vater und dessen nun schon jahrzehntlang posthume zu ihr. Sie starb doch so früh; die Fahnenflucht derart vergeblich … Nun wird ihre Liebe als ein Märchen aus TausendundeinerNacht erzählt; auch schon auf Ciccina Circé hat ja Scheherazade ihr Mondlicht geworfen. Wiederum in der Liebe des Sohns zu Marosa stirbt er nun, `Ndria, zu früh. Gut möglich, dass fortan sie sie weiterträumen wird, lunar. – Ach, wie sie sich begegneten! ‘Ndria sah sie so blass, dass er (…) eine Woge von Zärtlichkeit in sich aufkommen fühlte, und zum ersten Mal, ganz impulsiv, wollte er sie küssen. Marosa bemerkte das, und so wie das Blut aus ihrem Gesicht gewichen war, kehrte es plötzlich wieder zurück, das junge Mädchen wurde purpurn (…). Und um sie küssen zu können, bückte er sich nicht, sondern hob sie in seinen Armen empor. – Fünfhundert Lire, fünfhundert Lire …
Romanästhetisch eine der beeindruckendsten Erzählungen ist freilich die von der Hand. Sie beginnt nach einer unverantwortlichen Hinausfahrt Caitanellos, dem ahab’schen Selbstmordversuch in Form einer tollkühnen Heldentat, wenn sie ihm niemand im Dorf mehr reichen will. Und endet in der Stadt Partenopes mit den letzten Minuten eines jungen deutschen Panzerführers, der an die Truppe den Anschluß verlor. Nun klettert er nach draußen und geht zögernd auf die napoletanischen Jünglinge zu, die ihn mit Maschinengewehren, Karabinern und Handgranaten bewaffnet eingekreist hatten – wobei er lächelt, als wäre er Freund. Und streckt ihnen die Hand entgegen, doch nicht mit der offen liegenden Handfläche, sondern hochkant aufgestellt, ausgerichtet wie eine Pistole, wobei die vier eng zusammengepressten Finger den Lauf und der aufgerichtete Daumen den Abzug in Schussbereitschaft bildeten. Vor seinen Tod schiebt d’Arrigo aber noch „ein kleines Frollein“ ein, das die Szene beobachtet, so dass wir sie zugleich – wie ihr blinder Vater, den sie führt – mit ihren Augen erleben. Ihr Antlitz indes, erschreckenderweise, wird zu dem der Unheil selbst, es war wie ein zweites Gesicht für die Jungs, wie das, was sie sich zu Karneval mit Ruß auf ihre eigenen Gesichter malen, ganz Zähne, Augenhöhlen und Schnauzenfraß, und sie malen es sich aus dem Gedächtnis auf, als hätten sie sie immer schon gekannt und gesehen, die Schnauzenzerfressene, als wüßten sie, dass es, um das Leben vollkommen zu kamuflieren, nur sein Gegenteil gibt, die Tödin.
Als 2015 Moshe Kahns dezent so genannte „Übersetzung“ erschien, die erste überhaupt (eine zweite, auf Französisch, kam erst in diesem Jahr heraus), jubelten die Feuilletons; Beckmesser freilich mäkelten auch. Das war aber schon 1976, in Italien, d’Arrigos Original passiert. Im allgemeinen wußte man dort wie hier ziemlich sofort, um welch eine Art von Werk es sich handelt. Eines der Wenigsten ist es und wie diese, trotz der Kriegs- und Rahmenhandlung, außer jeder Zeit. Und dennoch: Nachdem ein Leser es mir zugeschickt hatte, als eBook, weil ich es lesen solle, nein müsse, und während ich es schon tat, durchstreifte ich die Buchhandlungen; nicht eine führte das Buch. Ich wurde regelrecht sauer. Denn wer immer den wahrhaften Leserausch will, kommt an diesem Roman nicht vorbei. Haben wir uns auf ihn eingelassen, hebt’s uns über alle Bücher hinaus.
[Geschrieben für die Weihnachtsausgabe
der Jungen Welt und am 23. Dezember 2023
dort erschienen. Hier jetzt, nach meinem
radikalen Bruch mit ihr, in der originalen Ty-
poskriptfassung.] Es ist mir heute widerlich,
daß der Beitrag in ihren Zusammenhängen steht
— spätestens seit dem Aufmacher der Titelseite.
Eine schlimmere Diktatorenpropaganda als diese ist
kaum denkbar. Weshalb ich mich bei Moshe Kahn
und dem S. Fischer Verlag hiermit entschuldige,
dieses große Buch in solch eine Nähe gerückt zu
haben.
ANH, 23. Januar 2024]
Letzte Änderung: 19.02.2024 | Erstellt am: 19.02.2024
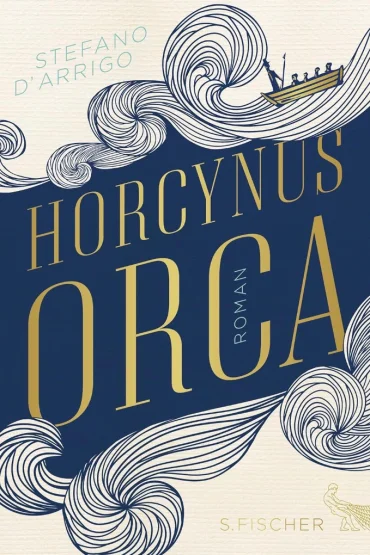
Stefano D’Arrigo Horcynus Orca
Roman
Deutsch von Moshe Kahn
1472 S., geb.
ISBN-13: 978-3100153371
S. Fischer, Frankfurt am Main 2015
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


