Keine Monster zu finden – Zu Ralph Roger Glöcklers Roman »Das Ächzen der Steine«
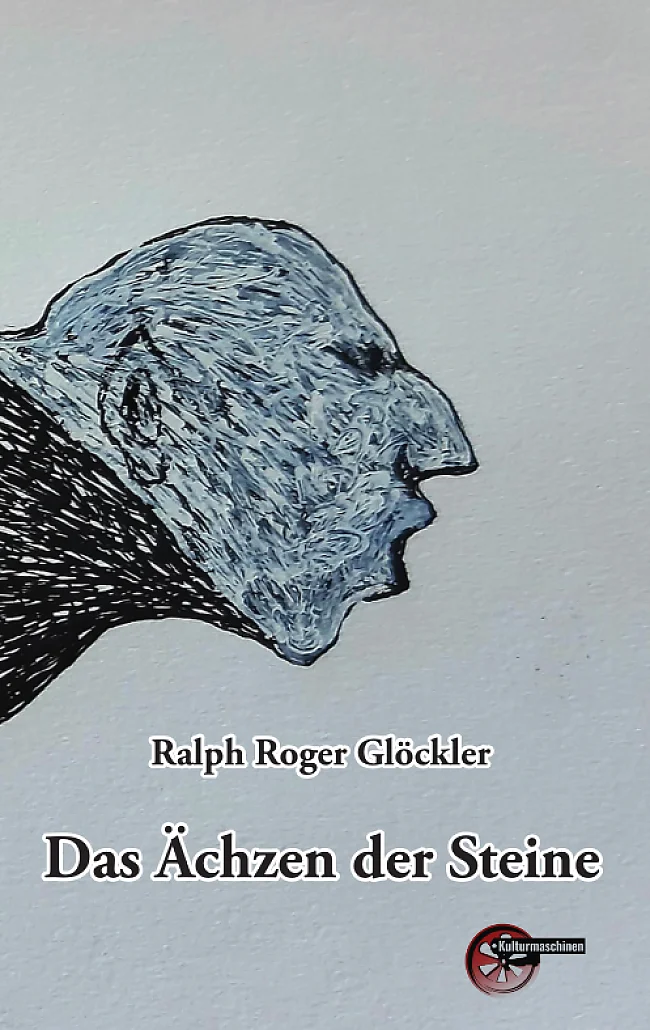
In seiner neuen Rezension zu Ralph Roger Glöcklers Roman »Das Ächzen der Steine« erkundet Autor Peter H. E. Gogolin die dunkle Seite der menschlichen Psyche und beleuchtet das eindrucksvolles Porträt eines Mörders, das weniger nach Schuld fragt als nach Erkenntnis und das Leserinnen und Leser mit der unbequemen Frage konfrontiert: Wie menschlich ist das Unmenschliche?
»Die Welt ist ein sehr mysteriöser und verwirrender Ort. Wenn du diese Verwirrung nicht spürst, bist du nur eine Kopie von jemand anderem«, schrieb der amerikanische Sprachwissenschaftler Noam Chomsky. Was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, dass uns die Welt desto fragwürdiger wird, je eigenständiger wir sind und denken. Aus solchem Stoff entstehen die Unangepassten, die Ausgestoßenen, die Misfits der Gesellschaft, aus denen notfalls Schriftsteller werden könnten, die ihr Leben damit verbringen, diesen mysteriösen Ort zu kartographieren. Jean-Paul Sartre hat uns mit seiner großen Studie über Jean Genet das Porträt eines solchen Ausgestoßenen hinterlassen. »Saint Genet, Komödiant und Märtyrer«. Genet, der Dieb, der Dichter und Heilige.
Ralph Roger Glöcklers Roman »Das Ächzen der Steine« ist diesem Werk Sartres durchaus an die Seite zu stellen. Nicht weil »Marto«, der Protagonist seines Buches, ein Heiliger wäre. Er ist im Gegenteil ein vielfacher Mörder. Oder weil auch ihm das Schreiben als Medium dient, den für ihn mehr und mehr undurchdringlich werdenden Dschungel seiner Umwelt und seines Denkens zu erhellen, sondern weil Glöckler wie Sartre eine Antwort auf die Frage versucht: Was ist der Mensch? Und die poetische Prosa seines Tiefenporträts besitzt dabei eine sprachliche Trennschärfe, die ihresgleichen sucht. Die analytische Kraft seiner Darstellung seziert Martos Bewusstsein ebenso gnadenlos und vielschichtig wie die Strukturen und das Verhalten seiner Umwelt. All das stellt sein Buch für mich auf die Stufe von Sartres brillanter biografischen Studie. Empfindsame Leser, die es auf unserem Planeten der Massaker ja noch geben soll, mögen diesen Hinweis durchaus als Warnung verstehen. Denn Glöcklers Charakter-Schilderungen sind meilenweit entfernt von all den netten Leuten, die ja immer etwas Leeres und Bedeutungsloses an sich haben, wie die Charaktere oberflächlicher und gefälliger Romanschreiber es eben haben. Wer Glöckler liest, wagt den Blick in einen Abgrund.
Ausgehend von dem realen Fall eines Mannes, der 1987 in Portugal sieben Menschen in knapp drei Stunden tötete, begibt sich Ralph Roger Glöckler in diesen Abgrund, um die Taten zu verstehen. Wohlgemerkt, um zu verstehen, nicht um zu bewerten und abzuurteilen. Und auch das muss man wissen: Glöcklers Buch darf nicht mit einem Kriminalroman auf der banalen Suche nach einem Täter und seinem Motiv verwechselt werden. Es ist vielmehr eine beklemmend schmerzhafte Erkundung des Menschseins und seiner Grenzen, eine Reise auf die andere, dunkle Seite der Vernunft. Eine Reise, der es natürlich um Wahrheit geht, paradoxerweise im Einklang mit dem Täter auf dem Weg zu seiner ungeheuerlichen Tat. Denn auch er, dem die sonst so selbstverständlichen Grundlagen der Welt und seine Beziehungen zu den Menschen brüchig und deshalb unglaubwürdig geworden sind, fragt sich permanent, ob es denn wahr ist, ob er glauben kann, was er erlebt und die anderen ihm mitteilen.
Wollte man Glöcklers sprachmächtiges Werk unter eine Überschrift stellen, so müsste sie wohl heißen: Wie fühlt es sich an, ein Massenmörder zu sein? Beziehungsweise auf dem Weg zum Massenmörder zu sein, also, demnächst einer zu werden. Wir wollen vorsichtig sein, zumindest nicht leichtfertig, denn der Abstieg in das Bewusstsein eines Menschen, den der Autor hier unternimmt, ist eine schwierige und dunkle Sache, auch wenn die Richter Adolf Eichmanns dort kaum etwas anderes als Abfahrtzeiten von Zügen, Transportlisten und Staub auf dem Schreibtisch vorgefunden haben. Allerdings fanden sie auch nichts, was Hannah Arendts Diktum, Eichmann habe sich außerhalb der Menschheit gestellt, gerechtfertigt hätte; im Gegenteil, er hätte die Bürokraten aller Länder hinter sich vereinen und anführen können. So einfach ist das also nicht. Nein, alles, was hier zu Tage gefördert wird, ist zutiefst menschlich, ein Monster ist nicht zu finden. Nichts gestattet uns, den Täter als fremd und unverständlich zurückzuweisen. Das ist vielleicht die schmerzhafteste Erkenntnis, die Glöcklers Buch für den Leser bereithält.
So wenig einfach dem Leser die Lektüre dieses Buches vorkommen mag, so wenig einfach hat es sich der Autor gemacht, um sich diesem schwierigen Stoff zu nähern. In einem Interview schilderte er, dass er nach den Morden allein drei Jahre benötigte, bis er in der Lage war, sich auf das Thema einzulassen. »Es stellte sich dann die Frage, womit bei der Recherche anfangen: Zuerst einmal viele Zeitungsberichte lesen, herausfinden, wer welche Rolle spielte. Dann fiel mir der Priester auf, der dem Mann nach der Gefangennahme die Beichte abnahm. Ich setzte mich mit ihm in Verbindung, traf ihn zu langen Gesprächen über den Täter und fuhr mit ihm an einige der Tatorte. Es gelang mir, den Verteidiger und den psychiatrischen Gutachter der Verteidigung zu sprechen, einen Gefängnispsychiater und später die Mutter des Mörders. Irgendwann hatte ich den Wunsch, den Mann selbst zu treffen. … Ich war so kühn, ihm einen Brief zu schreiben und meinen Besuch anzukündigen. Natürlich wurde der Brief abgefangen und mir bedeutet, dass ich kein Recht hätte, zu kommen. … Es war mein Glück, dass ich es über Bekannte im Justizministerium erreichte, eine Besuchsgenehmigung zu erhalten. So konnte ich den Mann verschiedentlich aufsuchen und mit ihm sprechen.«
Mich erinnerte das an die Vorgehensweise Truman Capotes bei der Arbeit an seinem berühmten Roman »Kaltblütig«. Trotz dieser umfangreichen auf Fakten gerichteten Recherchen ist Glöcklers Buch aber keine Dokumentation. Es ist ein Roman. Oder, wie er ergänzend im Interview verdeutlichte, »eine auf Fakten basierende Fiktion«, bei der der Leser sich ganz in die Sprache hineinbegeben muss. In eine Sprache freilich, die, auch wenn sie naturgemäß die kunstvolle Sprache des Autors ist, auf eine den Leser leitende Erzählerinstanz verzichtet und vollständig aus der personalen Perspektive der auftretenden Figuren erzählt. Eine Erzählform, die den Autor ganz zurücknimmt und die einzelnen Figuren zu Wort kommen lässt, in Gedanken, wörtlicher Rede, inneren Monologen usw. »Das ist kein Kunstgriff,« sagt Glöckler, »ich wollte gar nichts anderes, als in diese schwierige Seele einzusteigen, jenseits aller Moral und gesellschaftlichen Selbstgerechtigkeit. Es hat zwanzig Jahre und einige Krisen gedauert, bis ich zu dieser Form gefunden habe.«
Heimisch und ganz und gar unter seinesgleichen fühlt sich vermutlich nur der Replikant in einer Welt voller Replikanten. Als Doppelgänger unter lauter identischen Doppelgängern bliebe ihm der Schmerz des Andersseins erspart. Womit auch das Problem des störenden, quälenden Bewusstseins gelöst wäre, denn um zu Bewusstsein zu gelangen, von sich selbst und den Anderen, braucht es die Differenz. Und die Literatur verlöre dann ihre wichtigste Funktion, ist doch die Literatur ein Raum, der virtuelles Probehandeln ermöglicht. Der Ort, der gestattet, Gedanken zu denken und lesend Handlungen zu erproben, die man in der realen Welt weder zu denken noch zu tun wagen dürfte. Es geht in Glöcklers Buch also um die Grenze, die wir gewöhnlich nicht überschreiten, um den Zaun zwischen Zivilisation und Wildnis auch, der, wenn wir ihn missachten und die Seite wechseln, uns vergessen lässt, wer wir sind. Ralph Roger Glöcklers Roman »Das Ächzen der Steine« führt so nahe an diesen Zaun heran, wie es nur möglich ist. Lesen Sie ihn! Wenn Sie alles, was Sie in Ihrem Leben je gelesen haben, vergessen, dieses Buch vergessen Sie nicht.
Ralph Roger Glöckler: »Das Ächzen der Steine«, Roman, 195 Seiten, geb., Kulturmaschinen Verlag, Ochsenfurt, ISBN 9783967 633474, 25,00 Euro
Letzte Änderung: 30.07.2025 | Erstellt am: 30.07.2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


