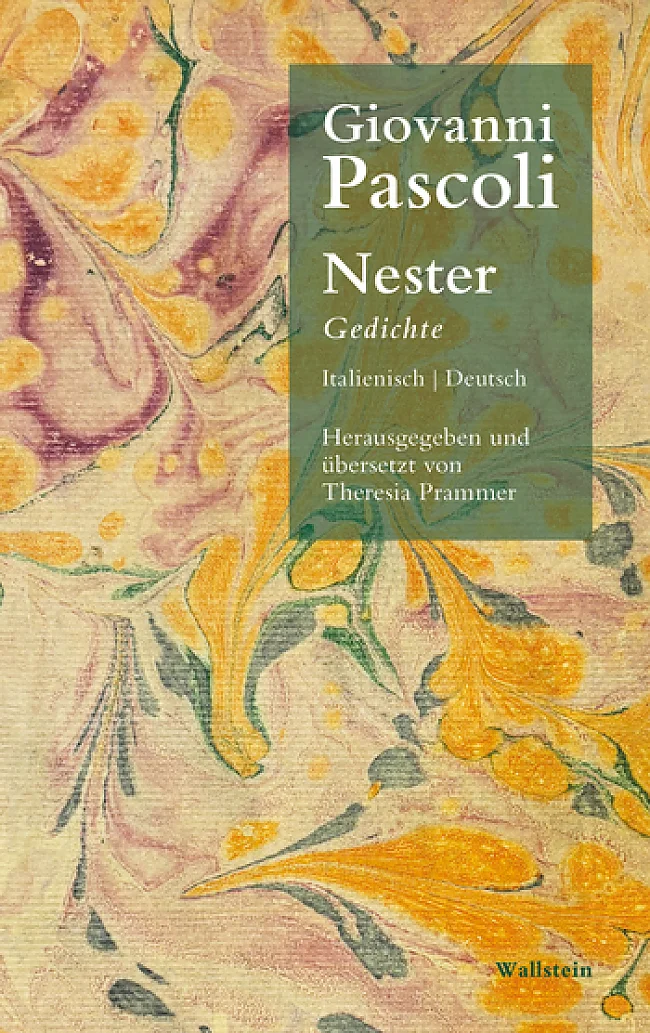
Italien – das Land der Dichter und der Vögel. Giovanni Pascoli, in seiner Heimat ein Klassiker, ist im deutschen Sprachraum kaum bekannt. Dabei erfasst seine Lyrik die Natur mit einer seltenen Tiefe – von der Mönchsgrasmücke bis zum Albatros. Theresia Prammers Neuübersetzung lässt Pascolis poetische Welt in neuem Licht erscheinen. Ein Buch für alle, die Lyrik lieben – und für jene, die sich von der Natur berühren lassen.
Kennen Sie das Land, wo die Mönchsgrasmücke singt? Zuvor gefragt: wissen Sie überhaupt (noch), was eine Mönchsgrasmücke ist? Kommen Sie mit nach Italien, kommen Sie in das Land von Giovanni Pascoli, das die Kritikerin und Übersetzerin Theresia Prammer in diesem optisch, haptisch und inhaltlich wunderschönen Band für uns erschlossen hat. Italien ist unter Vogelliebhabern, leider nicht immer zu unrecht, als Land der Vogelfänger verschrien; dass Italien mit Giovanni Pascoli zugleich jedoch den Vogeldichter schlechthin aufzuweisen hat, muss sich erst noch herumsprechen. Pascoli ist im deutschen Sprachraum, anders als in Italien, wo er Schulbuchautor ist, ein nahezu Unbekannter, selbst unter Lyriklesern, die sich an Namen wie Giacomo Leopardi, Eugenio Montale, Guiseppe Ungaretti, Edoardo Sanguinetti, Dino Campana, Giorgio Caproni, Andrea Zanzotto oder Patrizia Cavalli wiedererkennen und die von der Romantik des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein repräsentativ für die moderne italienische Lyrik stehen und mit Übersetzern wie Hanno Helbling, Christoph Ferber oder auch Ingeborg Bachmann – mit den wohl berühmtesten zwei Zeilen der italienischen Poesie, Ungarettis „Ich erleuchtete mich / durch Unermessliches“ –, die italienische Dichtung zu uns gebracht haben, nicht zuletzt auch dank der Pionierarbeit von Verlagen wie Klett, Hanser und der Dieterich‘schen Verlagsbuchhandlung. Zuletzt ist in diesem Verlag die schöne Ausgabe mit Gedichten Alda Merinis erschienen, einer in Italien kanonischen Frauenstimme, die vom Musendasein der Dichter Salvatore Quasimodo und Giorgio Manganelli bis zur geschlossenen Psychatrie alle Höhen und Tiefen des Daseins in scheinbar leichten, wie nebenher gesagten Versen vergegenwärtigt, die man einmal gehört nicht wieder vergisst – Szenen einer Liebe, die sich nicht erfüllt, Momente in der Anstalt voller Verzweiflung, Augenblicke der Freiheit, in denen die festgestellte Welt nach allen Seiten hin offen zu stehen scheint, als hätte das Leben trotz allem wieder Flügel bekommen:
Io ero un uccello
dal bianco ventre gentile,
qualcuno mi ha tagliato la gola
per riderci sopra,
non so.
Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il moi vaggio,
senza nessuno carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d’amore.
Ich war ein Vogel,
mein Unterleib weiß und zart,
und jemand hat mir die Kehle
entzweigeschnitten,
um, ich weiß nicht,
darüber zu lachen.
Ich war ein mächtiger Albatros
und kreiste über den Meeren.
Jemand hat meine Reise
ohne jegliches Mitleid
sang- und klanglos beendet.
Doch auch am Boden liegend
sing ich für dich
meine Lieder der Liebe.
Verse wie die von Alda Merini wurden nicht zuletzt vorbereitet durch die Poesie eines Giovanni Pascoli, auf den das Attribut „modern“ nicht so uneingeschränkt zu passen scheint: Er hielt sich kaum in den Zentren des modernen Lebens auf, die Stadt, die ihm anstelle der wirbelnden Metropole am ehesten ein Gefühl von Modernität vermittelte, war Bologna, wo der 1855 Geborene lateinische und italienische Sprache und Literatur lehrte. Pascolis Vater fiel einem nie aufgeklärten Mord zum Opfer, als der Junge zwölf Jahre alt war, damit war er, wie Theresia Prammer in ihrem instruktiven Nachwort schildert, aus dem heimischen Nest gerissen, und musste in Welt und Leben ohne väterlichen Beistand vorankommen. Was er sich dabei vor allem erschloss, war die Natur in der Einsamkeit des Landlebens der Toskana und Romagna zwischen Urbino, Florenz, Pisa, Massa und den Bergen des nördlichen Apennin. Dort hatte er ausgiebig Gelegenheit, das Landleben zu studieren und vor allem das Leben der Vögel im Lauf der Jahreszeiten mit ihrer Gewohnheit, im zeitigen Frühjahr Nester zu bauen, die sie den Sommer über bewohnen, um sie mit Anbruch des Herbstes wieder zu verlassen – ein Bild für die Vorläufigkeit des Daseins. Pascoli hat indes sehr genau hingeschaut, er begnügt sich nicht mit Reminiszenzen an die antike Bukolik oder ländlichen Gemeinplätzen, einer Rhetorik, die er an Leopardi, ob berechtigt oder nicht, verabscheut. Er sieht zuallererst den konkreten Vogel an einem konkreten Ort, verbindet Biologie, Mythologie und Poesie miteinander in einer alten Landschaft, die immer schon vom Miteinander menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens geprägt war. Prammer bemerkt:
In ihren Durchlässigkeiten zwischen Sprache, Landschaft und Wahrnehmung macht Pascolis Naturdichtung niemals bei einem „Ansingen“ der Landschaft Halt. Die Natur steht hier vollkommen für sich und spiegelt zugleich alles, was nicht Natur ist. […] Pascolis Blick folgt den Arbeiten auf dem Feld ebenso wie dem Handwerk und der Handarbeit, er verzeichnet Naturerscheinungen und Wetterlagen. […] Die vorindustrielle „Zeit des Brotes“, die für Pier Paolo Pasolini später von der „Zeit der Ware“ verdrängt wurde, hier wird sie gefeiert in allen Farben.
Was Pascoli lyrisch zur Verfügung stand, das Sonett, die Odenform oder die auf Dante zurückgehende Terzine als Erzählmedium, hat er kongenial für seine Natur- und Landschaftsdarstellungen adaptiert, wie hier in „Il bove“ („Der Ochse“) zu sehen:
Al rio sottile, di tra vaghe brume,
guarda il bove, coi grandi occhi; nel piano
che fugge, a un mare sempre più lontano
migrano l’acque d’un ceruleo fiume;
ingigantisce agli occhi suoi, nel lume
pulverulento, il salice e l’ontano;
svaria su l’erbe un gregge a mano a mano,
e per la mandra dell’antico nume:
ampie alia prono imagini grifagne
nell’aria; vanno tacite chimere,
simili a nubi, per il ciel profondo;
il sole immenso, dietro le montagne
cala, altissime: crescono già, nere,
l’ombre più grandi d’un più grande mondo.
Am schmalen Fluss, unter Nebelschwaden,
hebt der Ochs die großen Augen: Über fliehende
Hänge, immer ferneren Meeren entgegen,
ziehen die Wasser eines hellblauen Stroms;
in seinen Augen, im staubtrüben Licht,
erscheinen Weide und Esche riesengroß;
über die Heide streift die Herde gemächlich,
wirkt wie die Meute des mythischen Gottes.
Weit aufgespannte Flügel zeichnen Luftgebilde
Von Greifvogel-Schwingen; stumme Schimären,
Wolken ähnlich, ziehen übers Himmelszelt.
Die gewaltige Sonne hinter den Bergen
geht unter: und immer schwärzer werden
die größeren Schatten einer größeren Welt.
Man ist versucht, diese Art von Sonett, 1897 in seiner zentralen Sammlung Myricae erschienen, mit einem Blick auf Rilkes zehn Jahre später erschienenen Neue Gedichte auch als „Dinggedicht“ zu bezeichnen, es wird der Lebendigkeit und Einmaligkeit, dem Pulsieren der Wesen, um die es Pascoli zuvörderst geht, jedoch kaum gerecht. Es sind Landschaften und Vogelgedichte, Vogelsonette, Vogeloden, Vogelterzinen. Und die Vögel sind wie die übrigen Tiere und Pflanzen bei ihm jeweils ganz konkret: die Waldohreule, das Käuzchen, der Sturmtaucher, der einzelne Spatz in der Hecke, die Schwalben (die er italienisch als „rondine“ bezeichnet), die Mönchsgrasmücke, immer wieder die Mönchsgrasmücke. Pascoli macht damit den Weg frei für die Vögel der italienischen Dichtung, deren berühmtester vielleicht der Uppupa, der Wiedehopf bei Eugenio Montale geworden ist, der aber auch andere Vögel bedichtet hat, in einem späten römischen Gelegenheitsgedicht beispielsweise einen verletzten Mauersegler (il rondone), den seine Haushälterin notdürftig versorgt. Ob sie es zugaben oder für selbstverständlich hielten, sie alle kamen in der Konkretheit der Natur von Pascoli her.
Pascoli selbst wiederum stand tief in der lateinischen und italienischen Dichtung, in den Terzinen auf ein Dickicht lässt sich seine Herkunft von Dante und dessen berühmten Beginn der Göttlichen Komödie ebenso wie seine Neuerung gegenüber diesem erkennen. Ist es bei Dante das Verlorengehen in einem letztlich symbolischen Dickicht der Lebensmitte, das ihn zur Begegnung mit der Unterwelt führt, so bleibt Pascoli in derselben (leicht variierten) Strophenform ganz irdisch an dem Ort, auf welchen er sich bezieht, nämlich „In der Macchia“:
Ich streifte durch das vergessene Tal
zwischen blühenden Federgrasbüscheln
zwischen Eichen, vor Blattgallen prall;
ich streifte durch die einsamste Macchia,
wo inmitten des faulen Blattwerks
das blaue Veilchen hervorbrach;
ich irrte an einsamen Bächen:
Die Meise überblickte alles von den Kiefern:
und ließ ihre kleinen silbernen Pfiffe
nach unten fliegen.
Ich sitze ungesehen und allein
Zwischen Bergen und Wäldern: Am Abend
erzittert kein Flug und kein Schrei.
Ich sitze ungesehen und betrübt,
inmitten des schweigenden Walds
erhebt sich ein Grasmückenlied.
Und das Ständchen im heimlichen Schatten,
wo ich ungesehn immer noch sitze,
will mir mit Flötenstimme sagen,
Du, ich sehe dich!
Das erinnert auch an die große angelsächsische Tradition der Naturlyrik, insbesondere die wunderbaren Vogelgedichte John Clares (1793–1864), die erst seit kurzem durch Manfred Pfisters Übersetzungen teilweise auf Deutsch erschlossen wurden, an Seamus Heaney und seine bäuerlichen Landschaften in Nordirland und in der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts die Erdlebenbilder Wulf Kirstens, des 2022 verstorbenen großen Landschaftsdichters, der in Pascoli wahrscheinlich einen Wahlverwandten erblickt hätte. Theresia Prammer findet für ihre Übersetzung einen unprätentiösen, genauen Ton, sie versucht, weniger nachzudichten als zu zeigen, was Pascoli sieht, dabei gelingen ihr oft schöne lautliche Annäherung ans Original, indem sie v.a. die Möglichkeiten von Assonanzen und Halbreimen ausschöpft. In ihrem Nachwort stellt sie ihn seinem Zeitgenossen D’Annunzio gegenüber, dem es ebenso um die Erneuerung der italienischen Poesie und Kultur zu tun war, das Pathos D’Annunzios, dessen problematische politische Vision sind bei Pascoli so kaum anzutreffen (in längeren Gedichten, wo er sich beispielsweise mit den italienischen Amerika-Emigranten auseinandersetzt, durchaus; dies sind jedoch die schwächeren Gedichte der Sammlung).
Was Pascoli gerade in unserem historischen Augenblick, da wir das durch unseren Konsum veranlasste größte Artensterben der Erdgeschichte seit dem Aussterben der Dinosaurier mit eiserner Entschlossenheit und den Scheuklappen des politischen Tagesbetriebs zu verdrängen, zu verscheuchen suchen wo es nur geht, was Pascoli uns heute vermittelt, das ist die Erinnerung an die Erde, und dass es hier auf der Erde so etwas wie Freude für uns nur im Miteinander mit den übrigen Geschöpfen geben kann, welche schon vor uns da gewesen sind, die den Raum, aus dem wir selber kommen und in dem wir uns am wohlsten fühlen – die halboffene Savanne, der eine extensive bäuerliche Landwirtschaft mit Streuobstwiesen und kleinen Gehölzdickichten am nächsten kommen… – mit und neben uns besiedeln, die Dinge können, die wir selber nie vermögen, weil das Sitzen in einem Flugzeug eben nicht vergleichbar ist mit einem simplen Flügelschlag aus dem eigenen Leib heraus. Pascolis Vogelschau zeigt uns, dass der irdische Augenblick, in dem wir ganz wir selbst sind, zugleich der Augenblick ist, an dem wir, in dem wir uns eins mit dem Vögeln und ihren vorübergehenden Behausungen, den Nestern, treffen. Das Vogelreich Italien und nicht nur die italienische Poesie wird man nach diesem Buch als ein anderer betreten. Man dem gleichnamigen Gedicht fühlt man sich bei Pascoli „Hoch droben“ und zugleich tief im Irdischen verwurzelt:
Am goldnen Himmel kreist ein Schwalbenschwarm.
Ach hätt ich nur, im Herzen, diese Flügelkraft!
Ich liebt sie dennoch, diese Erde, schwarz und bitter,
nur für die Freude, sie beizeiten zu verlassen,
den Himmel zweizuteilen, mit energischem Gezwitscher.
Nun aber scheint mich dieser Himmel zu verlachen,
wie ich so schreite, traurig, grau und gram.
Giovanni Pascoli: Nester. Gedichte. Italienisch | Deutsch. Herausgegeben und aus dem Italienischen von Theresia Prammer. Göttingen: Wallstein 2024.
Alda Merini: Die schönsten Gedichte schreibt man auf Steine. Lyrik 1947–2009. Ausgewählt und übersetzt von Christoph Ferber. Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 2024.
Letzte Änderung: 10.03.2025 | Erstellt am: 07.03.2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


