Die Trostbäume

Rainer René Mueller wird am 1. Januar 2024 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass soll noch einmal ein Gespräch, das nach der Veröffentlichung seiner Gesammelten Gedichte mit dem Lyriker geführt wurde, Einblick in seine Arbeitsweise geben. Angefügt ist ein Geburtstagsgedicht, das ihm der Freund und Dichterkollege Alexandru Bulucz schrieb. Nach einer Vorbemerkung befragt Bernd Leukert Rainer René Mueller zu seinem Buch. Das Buch enthält sein lyrisches Lebenswerk: Sprachkunstwerke, mit denen man sich eingehend beschäftigen muss, damit sie sich einer und einem erschließen. Rainer René Mueller geht von der ästhetischen Grenzposition Paul Celans aus und mit jedem Gedicht das Wagnis ein, dem Gewöhnlichen Worte entgegenzusetzen – Katalysatoren des Unsagbaren.
Über seine Gedichte schrieb man in der NZZ: „Sie öffnen Türen ins Abseitige und Unverklungene, in Bereiche wütender Trauer und einer Sage-Notwendigkeit.“
Rainer René Mueller, der 1949 in Würzburg geboren wurde und von 1956 an in Heidelberg lebt, hatte Theologie, Germanistik, Philosophie, Französisch und Kunstgeschichte studiert, arbeitete als Kunstberater, Kunsthistoriker, Gutachter, Herausgeber und Dozent, leitete die Städtische Galerie Schwäbisch Hall, gründete das Kunstmuseum Heidenheim und ein eigenes Museum. Neben seiner Tätigkeit in der Erwachsenenbildung begann er, Lyrik zu schreiben.
Sieben Gedichtbände hatte Rainer René Mueller seit 1981 schon veröffentlicht, als in Urs Engelers roughbooks-Reihe 2015 „POÈMES / POETRA“ erschienen. Die ausgewählten Gedichte der Jahre 1981–2013, die von Dieter M. Gräf herausgegeben wurden, brachten einen Dichter wieder zur Sprache, der von kundigen Kollegen wie ein Geheimtip empfohlen wird. 2018 bringt Leonard Keidels neugegründete Edition a o u e y Muellers neues Buch „geschriebes, selbst mit stein“ in einer edel gestalteten Ausgabe und kleiner Auflage heraus. Nun also der Band mit den gesammelten Gedichten, in den all das und noch viel mehr aufgenommen wurde.
In dieser Sammlung, die von Chiara Caradonna und Leonard Keidel herausgegeben wurde, sind die Gedichte in umgekehrter Chronologie aufgeführt. Sie beginnt also mit den neueren Gedichten und endet mit den frühen, unveröffentlichten Gedichten. Damit ist, genauer gesagt, die Reihenfolge der aufgenommenen Gedichtbände gemeint, deren ursprüngliche Textanordnungen aber erhalten blieben. Angefügt ist ein umfangreicher Kommentarteil der Literaturwissenschaftlerin Chiara Caradonna, ohne den zu vieles verborgen bliebe.
Mueller dichtet mit der gestalteten Klanglichkeit des laut Gelesenen – nicht im Sinne eines mimischen Vorlebens (oder Nachlebens) der Worte, sondern einer sinnhaft-sinnlichen Erweiterung der schriftlichen Mitteilung, indem er die Texte mit Interpunktionszeichen anreichert, die zum Beispiel ein Innehalten, eine Atempause, Accelerandi oder Rallentandi, Unterbrechungen oder Portamenti anzeigen.
Und nicht selten ist ein Gedicht mit Zeilen anderer Poeten gefüttert und verweist seinerseits wieder auf mehrere eigene Gedichte. Dieses mehrdimensionale Geflecht von Zitaten und Bezügen führt Bruchstücke der gesamten kulturellen Tradition mit sich, touchiert sie, um sie kontextuell mitklingen zu lassen.
Ein passendes Beispiel dafür ist „Pastiche“, der Schlußstein des Bandes „geschriebes, selbst mit stein“:
Pastiche
für Alexandru Bulucz… daß man ein Haus
einweint
… man nähme / an, …
auf, das : den
Haken kosen :
als Schlachtstück, – nähme
man an, man nähme, namentlich
an : etwas wie : recours
… an : Mann, … Name, An-
nahme
so etwas
wie Gregorianik –
epiphanie, als könnte man’s
runterbrechen, : rabrecha :
auf Neumen –
auf’s Stundenholz
und dann bleibt da,
doch – :
nur ein Nußbaum,
vor der doppelgiebeligen
Klinkerwand
… que je meurs
Das Gedicht ist dem Poetenfreund Alexandru Bulucz gewidmet. Und im Kommentar wird auf dessen Gedicht „Stundenholz“ aus dem Band „was Petersilie über die Seele weiß“ verwiesen, in dem es heißt:
. … Wir flogen
über Holzrauch von Klöstern, über liturgische Rufe aus Stunden-
trommeln von Mönchen, toaca-Klänge spannten eine Himmelsleiter
auf uns zu u. über uns hinaus. Wir beteten mit den Orthodoxen,
den Mönchen, die zu uns heraufkletterten, den Kopten, Griechen,
Armeniern, Bulgaren, Russen (den Litauern, Letten, Esten).
Ahnt Ihr, Rose, was ich glaube? Dass die rumänischen Mütter
ihre Söhne zu Mönchen erziehen. Früh schon zeigen sie ihnen,
wie salată de vinete gemacht wird. Mit dem aus der Buche
geschnitzten Äxtlein klöppelt der kleine Mönch das Fruchtfleisch
der gegrillten Aubergine klein auf dem Brett aus Stundenholz.
Er lernt die Schlagtechnik u. erste freie Rhythmen für die toaca.
So also betet er u. weiß es nicht. …1
Paul Celan
EINE HAND
Der Tisch, aus Stundenholz, mit
dem Reisgericht und dem Wein.
Es wird
geschwiegen, gegessen, getrunken.
Eine Hand, die ich küßte,
leuchtet den Mündern.2
So kommt es zu Kreuz- und Querbezügen, vor denen die Gedichte Muellers – paradox gesagt – geradezu bersten. Die Worte geraten mit ihren Bedeutungsvalenzen in die Schwebe und streben danach, in eine musikalische Sphäre überzulaufen. Hans Blumenberg hat den Vorgang einmal knapp zusammengefaßt:
„Es kommt in der Tendenz auf Vieldeutigkeit zu dem, was man ein „Grenzereignis“ nennen könnte, es wird ein Punkt erreicht, an dem der semantische Dienstwert der Sprache gleichsam versagt. Ich werde nicht behaupten, daß in diesem Grenzereignis selbst der Spitzenwert der ästhetischen Möglichkeit der Sprache zu sehen ist; aber die Nähe der Gefährdung durch dieses Grenzereignis bestimmt wesentlich den ästhetischen Reiz der poetischen Sprache. In dieser Gefährdung droht es für die der Sprache zugewandte Aufmerksamkeit sinnlos zu werden, den Bedeutungsspielraum auszuschöpfen und die Vielfalt des Möglichen auf die Stimmigkeit mit dem Kontext hin zu befragen.“3
scheinen in sich selber
Bernd Leukert: Ich kann mir vorstellen, daß Sie sehr glücklich sind über dieses Buch.
Rainer René Mueller: Primo: Ich bin schon sehr froh, daß in diesem Verlag dieses Buch in dieser Form mit diesen beiden Herausgebern – insonderheit Chiara Caradonna – so hat erscheinen können, wobei für mich noch eine Besonderheit darin besteht, daß ich selbst mich nie in einer Weise, die zu vergleichbaren Ergebnissen geführt hätte, bei einem Verlag gemeldet hatte. Sondern ich bekam – das ist jetzt sicher schon 18 Monate her, ich hab’s nicht mehr genau im Kopf – einen Brief von Thedel von Wallmoden vom Wallstein Verlag, daß er ein Buch machen will. Und ich habe diesen Brief tagelang liegen lassen, denn ich habe das nicht für möglich gehalten. Dann war das aber eine ernsthafte Geschichte. Und daher bin ich froh, daß das in dieser Weise möglich war. Ich denke, es ist auch in einer gewissen Weise, wenn man, so wie ich jetzt, mehr als 50 Jahre übersieht, hinsichtlich dessen, was in diesen Jahren an Lyrik mit den verschiedenen Vertretern und verschiedenen Narrationen da war oder da ist und, um jetzt zumindest einmal von meiner Altersgruppe zu sprechen, da hat es das ja in den 50 Jahren nicht gegeben, daß zu Lebzeiten eine kommentierte Gesamtausgabe erschienen ist, und dann in dieser Weise auch sehr genau kommentiert, das ist schon eine sehr besondere Sache. Nun ist das Buch in der Welt, und ich bin traurig. – Das nennt man postnatale Depression.(lacht) Nein, wirklich! Ich habe Chiara Caradonna geschrieben: Es ist mein Grabstein! Le tombeau! Ich bin wirklich ein bissel bedrückt, weil – es ist doch sehr eigenartig – es ist ein solcher Brocken! 50 Jahre plus minus.
Die Art und Weise, wie Sie Gedichte schreiben, ist mir aufgefallen. Sie läßt mich zunächst fragen: Können Sie sagen, was ein Gedicht ist?
Ein Gedicht ist eine sprachpartiturale Form, die es beim Umsetzen in Stimme ermöglicht, wie bei einem Pianisten, die vorgegebene Notation beim Lesen plus ou moins auch um ein weniges zu verlassen, um das Ganze in die Lautlichkeit zu bringen. Zweitens, so, wie in der Musik auch, wenn man die Begrifflichkeit des Themas oder des Motivs nimmt, – bis in die heutige Zeit hinein, vielleicht bis an die Grenze zu dem, wofür Donaueschingen steht – ohne das Wissen darüber, was da ist, und das Verhältnis innerhalb der Musik, also innerhalb dann der Poesie – in diesem Fall dann auch sicher der europäischen – kann ich zumindest mit dem, was ich möchte, sprachpartitural nicht arbeiten. Ich muß beheimatet sein in der Dichtung, um heimatlos zu werden, damit ich das machen kann, was ich mache. Und ich denke, mit meinen Vorstellungen von Musik, Musikalischem oder Lautlichem bin ich gar nicht so weit entfernt bei der ursprünglichen Annahme dessen, was Gesungenes bedeutet oder Lied bedeutet. Es hatte ja Gründe, warum ich mich in meinem ersten Gedichtband von 1981 schon im Titel auf das Lied kapriziert hatte. Und von daher ist diese ganze Bewegung zu verstehen. Ich weiß natürlich, daß man auf die Frage ‚Was ist ein Gedicht?’ verschiedene Antworten geben kann. Aber Sie fragen ja nach meiner Antwort für mich. – Ich könnte auch sagen, es ist eine Zeitungsmeldung, zeilig angeordnet. Oder es ist der typografische, relative Niedrigsinn, ein Blatt mit Schreibmaschine zu betippen und dann über die ABWESENHEIT ABWESENHEIT ABWESENHEIT ABWESENHEIT zu schreiben und in der Mitte eine Leerstelle zu lassen, wo das Wort ABWESENHEIT nicht erscheint. Ja, du lieber Himmel! Das kann man einmal machen. Aber dann lasse man mich in Ruh damit! Sie verstehen, was ich meine. Man kann nicht derselben Person immer den gleichen Witz erzählen. Denn dann funktioniert das nicht mehr.
Der Vergleich mit der Musik macht die Differenz auf, darin die Musik kein Bedeutungsträger ist, die Sprache aber schon. – In der Kunst war es Joseph Beuys, der seinen Kunstwerken eine Erklärung beifügte und erklärte, die Erklärung sei integraler Teil des Kunstwerks. Ich sehe ihrem Buch einen großen Apparat anhängen …
… von Chiara Caradonna.
… und manche Dinge in Ihren Gedichten erschließen sich nicht unmittelbar, sondern nur mit diesem Apparat. Das heißt, im Gegensatz zur Musik, in der man nichts verschlüsseln kann, finde ich in Ihren Gedichten viele Verschlüsselungen.
Es sind nicht sofort les- und verstehbare Hinweise auf das, woher das Gedicht kommt und wohin es geht. Das ist mir schon klar. Ich denke, manches kann nicht gleich beim Lesen erschlossen werden. Das ist sicher so. Ich habe mich gerade mit Baudelaire beschäftigt oder Rimbauds ‚Die Läusesucherinnen’ zum Beispiel – aber bei Baudelaire ist interessant, selbst die auf den ersten Blick einfachen Baudelaire-Gedichte sind, wenn man sich näher damit beschäftigt, durchsetzt mit zunächst nicht sofort erkennbaren zeitgenössischen Verweisen oder aus der französischen Literaturgeschichte, der Poesiegeschichte und der Realgeschichte kommenden Verweisen, die das ganze dann natürlich viel weiter, viel größer machen. Und, nur als Beispiel jetzt: Ich denke, es hat für mich in der Generation, in der ich anfing, eine Rolle gespielt, daß ich – sagen wir mal – mit der lyrischen Richtung, für die Jürgen Theobaldy steht, den ich ja kannte, er war ja meine Generation, er war ja in Heidelberg auch, oder Michael Buselmeier oder wie sie alle heißen – ich konnte, wollte aufgrund meiner biographischen Geschichte und meinem schon von Kindheit an implantierten Mißtrauen gegen Sprache und Gewaltsprache mich nicht damit zufrieden geben, was da teilweise in dieser Lyrik auch an Aggressionspotential drin war. Da mir aber vom Aufwachsen her die Herstellung von Wirklichkeit durch Sprache sehr wichtig war, konnte ich mich mit der vermeintlichen Einfachheit täglicher poetischer Berichterstattung oder Berichterstattung der Alltäglichkeit in Form der Poesie nicht so recht anfreunden. Das war eine schwierige Zeit. Ich habe da viel Häme erlebt und viel Anfeindung. Aber ich habe einfach meine Sachen weiter gemacht. Fertig. Schluß. Denn das andere hat mir nicht gereicht. Es ist wie das Bild, wo die Mutter bei Gustav Mahler sagt: Morgen wollen wir backen geschwind, backen geschwind. Und dann wird gebacken und gebacken. Am Schluß kommen Steine aus dem Ofen, und das Kind ist tot. Und mit diesem Modell des nicht Gesättigtwerdens , des Genügens zur rechten Zeit kann man meine Deviation, meine Abweichung erklären.
Und was den Beuys angeht: Ich habe mich viel mit Beuys beschäftigt. Ich habe ja in den mittleren Jahren meinen Lebensunterhalt verdient als Verantwortlicher einer öffentlichen Galerie und später als Gründungdirektor eines Museums. Und da lag es nahe, sich eingehend mit Formen der zeitgenössischen Kunst zu befassen. Ich bin spät zu Beuys gekommen. Ich habe das nicht abgelehnt, aber ich habe es erstmal sehr vorsichtig beäugt. Ich selbst habe eine Druckarbeit von Beuys. Die habe ich lange betrachtet, und ich habe sie immer noch. Ich habe dann festgestellt, daß Beuys in diesem Blatt nicht eins zu eins, aber versetzt eins zu eins den berühmten Dürer-Stich „Melencolia I“ in Teilen zitiert. Dann verschiebt sich etwas in die Motivvariation, und die Aussage verändert sich. Das nur, weil Sie den Beuys erwähnt haben.
.
Die Wirklichkeit durch Worte erschaffen. Bei Ihnen setzt sich diese Wirklichkeit aus Partikeln anderer Gedichte zusammen, aus Geschichte, aus Erlebtem, das heißt, es ist eine synthetische Realität?
Kann man so sagen. Ich erlebe mich oft, daß ich in einer realen Situation – jetzt nicht hier, im Moment – beim Unterwegssein oder in einer bestimmten Umgebung das, was mich umgibt, in dem Augenblick über Dichtung, wie ein Dichtungszitat, wahrnehme. Ich will ihnen ein Beispiel geben, weil es wirklich so geschehen ist. Es liegt ein paar Jahre zurück, und ich komme in Paris an. Ich steige am Gare de l’Est aus und gehe gerade ein Stück die Straße herunter, denn da hatte ich immer das gleiche Hotel, und ich schau auf den Himmel. Und da war der ganze Himmel überzogen mit ganz kleinen Wölkchen, wie ein weißer Persianer. Und in dem Moment, da ich das wahrnehme, war einfach das Wort da: Hasenfell-Himmel. Und dieses Wort Hasenfell-Himmel taucht bei Celan in irgendeinem Brief oder einem Gedicht auf. In dem Moment wußte ich aber nicht, daß ich das Wort von da habe. Aber es war im Kopf! Und ich schau nach oben, und seit der Zeit rede ich nur noch, wenn meteorologisch so eine Wolkenbildung da ist, vom Hasenfell-Himmel. Und so etwas passiert immer wieder, daß in bestimmten Landschaftsformen, Architekturformen, Gehörtes oder in seiner Bildlichkeit Vorhandenes für mich erleb- und verstehbar oder fülliger wird durch die Resonanz innerhalb der Literatur oder der Dichtung. Das passiert oft. Das ist eine Synästhesie, wenn man so will, nicht mit Farbe und Musik, sondern in einer anderen Weise.
Wie stellen Sie die Balance her zwischen Worten, hinter denen Verschlüsselungen stehen, die in verschiedene Richtungen zeigen oder darauf verweisen und sie miteinbeziehen, und der Sinnlichkeit der Worte? Es muß ja beim Lesen ein Bild entstehen.
Ja. Es ist eigenartig. Wenn ich sage: immer, dann würde das bedeuten, daß ich das Schwindeln vermeide. Also sag’ ich nicht: immer. Also nicht immer, aber fast immer ist es so, daß es unmittelbar da ist. Zum Beispiel, in dem kleinen Dorf in Frankreich, in Lothringen, steht ein Lindenbaum. Wenn der anfängt, Anfang Juni, zu blühen, dann genügt der Geruch, und alles ist da: „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“ bis hin zu Walther von der Vogelweide „Under der linden an der heide, dâ unser zweier bette was …“ – es ist da! Oder ein anderes Beispiel. Ich sitze hier in Heidelberg in der Wohnung, auf dem Balkon, und der ist ja zu ebener Erde. Und ich schau’ so raus, Richtung Südwesten-Westen, und ein junger Mann geht am Balkon vorbei und läuft die Straße weiter Richtung Sonnenuntergang – es hätte auch eine Frau sein können, aber in dem Fall war es ein junger Mann, der eine etwas größere, fülligere Frisur hatte. Und ich schau diesem Mann nach. Und an einer bestimmten Stelle erzeugte die gegenüberliegende, untergehende Sonne in dem Haar einen Lichtkranz. Und dieses durchscheinende Licht in dem Haar dieser Person als Bild in dem Moment verwandelt sich sofort in eine Wirklichkeit. Es taucht dann auch irgendwie auf, dann aber mit einer großen Genauigkeit. Da ist genau beschrieben: Da geht jemand, in dessen Lichthaar … er geht gegen Westen, er geht gegen die untergehende Sonne. Und dann kommt dieser ganze Motivkranz: Die Sonne geht unter, es leuchtet noch einmal, es ist der Kranz da. Aber es ist eine alltägliche Begebenheit. Und ich kann aus dieser alltäglichen Begebenheit ein völlig anderes Bild machen und muß dann versuchen, kann versuchen – das ist eben nicht einfach –, diese optische Gleichzeitigkeit mit der parallel laufenden, sprachlichen Wahrnehmung in die Form eines Gedichtes zu bringen. Ich will keine Kurzgeschichte schreiben. Ich brauche eine Form. Und dann kommt die Arbeit, die man für’s Gedicht aufbringen muß. Es ist also nicht so, daß da auf dem Küchentisch irgendwelche Zettelchen liegen … – Ich bitte Sie, es gibt solche Vorstellungen!
Es geht um Sinnlichkeit, um Evidentes und um die Verschlüsselung. Dazwischen sehe ich eine Spannung, der man beikommen muß, wenn man Gedichte schreibt.
Ich mache mir natürlich Notizen. Freilich mache ich mir Notizen. Ich muß mir manches sofort aufschreiben, weil es ist irgendwie so: Ich glaube, bei einem Rechner sagt man, es läuft dauernd ein Hintergrundprogramm. Und dieses Hintergrundprogramm registriert. Und dann gibt es bestimmte Filter. Und dann stockt das Programm und sagt: Moment! Aufschreiben! Aufschreiben! Und dann läuft es weiter.
Es gibt bei Ihnen einige Gedichte, die hängen durch die Zeilenbrüche, Zeilenabstände und optischen Verlinkungen wie ein Mobile von Calder in der Gegend. Zeilenbruch ist das eine. Was bedeutet der Zeilenbruch? Ich nehme an, es gibt verschiedene Bedeutungen, und ich will der Frage noch die Doppelpunkte hinzutun. Der Doppelpunkt bedeutet, daß etwas aus dem Vorangehenden folgert. Es gibt aber auch Sätze bei Ihnen, die haben vorne und hinten einen Doppelpunkt. Das könnte ein musikalisches Wiederholungszeichen sein.
Sehen Sie! Sie sind der Erste, dem ich’s nicht erklären muß. Ab einer bestimmten Zeit war es so, daß mir das einfache, lineare Hintereinander nicht mehr ausreichte. Ich wollte für mich eine Form finden, in die ich Gleichzeitigkeit, Innehalten, Wiederholen, Einschub oder Gegenmotiv ins Gedicht einführen kann, oder eine Themenvariation. Und mir blieb ja nichts anderes zur Hand, als die üblichen schriftlichen Zeichen. Der Doppelpunkt und dieser Slash waren am Anfang die ersten Mittel, die ich verwenden konnte, um eben in dieser Weise, wie Sie es sagten, die Wiederholung anzudeuten oder eine Fermate. Wenn man mich beim Lesen hört, beim laut Lesen, dann hört man das, wie dann die Tempi anders sind, die Lautstärken, in ein, zwei Zeilen die unterschiedliche Betonung, an welcher Stelle die Worte brechen …
Und warum!
Ich will es einfach sagen: Um die für mich staunenswerte Gewöhnlichkeit eines Vogelzwitscherns auf einem Dachfirst aus der immer wieder gehörten und erlebten Banalität herauszuholen, weil es etwas sehr Besonderes ist: Weil, wenn der erste Ton in der Früh am Morgen kommt und diese Vögel entwicklungsgeschichtlich ja längst vor unserer eigenen Existenz da waren. Es ist dieses Innehalten. Und wenn ich nur schriebe, der sitzt da oben und pfeift, dann ist das für mich nicht hinreichend. Ich muß also versuchen, diese Besonderheit, die sich für mich darstellt, in die Form eines zeugenden Gedichtes zu bringen, das dieses Stolpern über’s Staunen wiedergibt. Und dann kommt es zu solchen Dingen, die relativ rücksichtslos sind. Aber, es tut mir leid, ich muß es so machen. Ich mache es. Ich muß nicht, ich will das so machen.
Das ist eine Übertragung von Körpergestik.
Zum Beispiel. Ja, Und wenn ich vom Staunen rede, dann ist das ja ein alter philosophischer Begriff. Leonard Keidel hat mich danach gefragt, schon vor langem, Rainer – wir waren da bei Aristoteles mit der Vertikalen 4 oder die Geschichte, die ja von der Motivlage gar nicht unerheblich ist: Der Name Platon kommt von der Platane. Er hat da gesessen mit einem Jüngling, sie haben sich unterhalten. Und in diesem Dialog bekommt er den Namen von diesem jungen Mann. Er sei breit und stark wie eine Platane. Und daher kommt dieser Name. – Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich so akkurat zu erinnern. Aber wenn Sie das eingeben, dann bekommen Sie diese Geschichte geliefert. Nur, als ich die Platanen erlebte – die spielen ja eine große Rolle in den Gedichten –, war mir zunächst aufgefallen, daß die dünne Rinde der Platane, die in der Regel jährlich abplatzt, eine Oberfläche hat, gleichend der menschlichen Haut. Es sind die gleichen rautenförmigen, kleinen Verästelungen, wie eine Haut. Ich habe seit den endsechziger Jahren – ich war 1967, 1968 in Montpellier als interner Schüler am Gymnasium. Dort standen die Platanen, und sie wurden, wie bei uns auch, in Frankreich ebenfalls im Spätherbst so radikal zurückgeschnitten. Es war wie ein Körper, der beschnitten wird. Ich habe das immer wie eine für mich spürbare Verwundung, Verletzung erlebt, diese zurückgeschnittenen Bäume, so daß ich eine große Zuneigung entwickelt habe zu diesen Bäumen, die für mich Trostbäume sind, südliche Bäume, hautüberzogene Bäume. So kommt es zum Beispiel dazu, daß ich kein nature writing brauche. Ich hab’ meine Bäumchen schon länger.
Sie haben am Anfang gesagt, das Buch sei wie ein Grabstein, ein Tombeau, ein Epitaph …
Es geht mir wirklich so. Ich habe jetzt in Berlin ein-, zweimal daraus gelesen. Und das fällt mir zunehmend schwerer, weil – ich habe’ das noch niemandem gesagt, es ist ja nicht so lange her, ich hab’ ja schon ein paar vertrautere Menschen, aber ich habe das nicht so gesagt – ich weiß nicht, wie ich das Gegebene jetzt noch, sozusagen im Nachgang, noch erfüllen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin traurig darüber.
Sie knüpfen ja sehr an Celan an. Celan geht ja immer weiter an die Grenze bis es nicht mehr geht.
Bis es nicht mehr geht. Ja. Bis ans Brückengeländer. Und dann geht nichts mehr.
Aber wie kann man daran anknüpfen? Man will doch etwas tun!
Celan ist für mich eine alte Geschichte, denn ich habe ihn noch in Freiburg erlebt. Ich habe später seine Witwe kennengelernt und kannte auch seinen Sohn. Ich lauf damit aber nicht Reklame. Entscheidend war, na gut, das hat auch einen langen Bart, aber ich kann’s ja nicht ändern, es ist ja so, wird immer wieder zitiert, die dumme Bemerkung von diesem Sohn eines Frankfurter Weinhändlers. Sie wissen, was ich meine^5^. Und das hat mich so erbost. Da wußte ich noch gar nicht so viel, aber es hat mich erbost. Ich fand das eine so große Erfrechung, so etwas zu sagen. Jahre später war mir klar, Paul Celan ist bis ans Brückengeländer gegangen, und danach ging nichts mehr. Das bedeutete aber, daß danach vieles anders sein mußte in der Sprache. Nun stand ich vor diesem sprachlichen Monument. – Es ist ja kein Scheitern, sondern das sprachliche Zuendekommen. – Für mich, in meinen nächtlichen Überlegungen, meinem Nacht-denken, Nachdenken, mit dem Umgehen wird schon in einer gewissen Weise deutlich: Erstens, ich kann nicht so tun, als gäbe es das nicht. Zweitens, in welcher Weise könnte dieses aus einem sprachverbrauchten Leben kommende Ende genutzt werden, um ein Stückchen weiter zu gehen, immer aber wissend, was davor ist. So kann ich das erklären. Es hat mich wenig gereizt, die wie auch immer artikulierte oder die wie auch immer besprochene Hermetik. Das hat mich sehr wenig interessiert. Mir war aufgrund meiner biographischen Verstrickung schon klar: 1967, da bin ich in der Schule zum ersten Mal der „Todesfuge“ begegnet. Ich wußte, hier wird Deine Sache verhandelt, ohne zu dem damaligen Zeitpunkt genau zu wissen, wo sich mein Stiefvater 1941 aufgehalten hatte, – ich hatte ja das Blutgruppenzeichen unter seiner Achsel gesehen. Ich denke, diese Sentenz ist Ihnen bekannt.6 Das muß man ja auch in die Überlegung mit einbeziehen, was da an Geschichte hinter mir liegt und daß das für ein Aufwachsen und für ein Weiterleben nicht so einfach ist. So weit zu dieser Frage. Das macht mich auch gelegentlich zornig. Gut, die Künstler haben sich gestritten, die Musiker haben sich gestritten, die Komponisten haben sich beschimpft, die Maler haben sich beschimpft. Die Lyriker auch. Fertig. Mir gehen manche Schreiber auf die Nerven, die mitte der 80er Jahre geboren sind und von nichts eine Ahnung haben und einfach schreiben, schreiben, schreiben und … Und wenn man ein wenig nachliest, nachfragt oder dann anfaßt, ist’s wie ein Brühwürfel,
dann zerfällt das, dann ist nichts mehr da. Zeilen anordnen kann ich auch! – nehme eine Zeitung, da mache ich drei Gedichte draus!
Dieses Weitermachen nach Celan kommt mir vor wie die Leonardo-Brücke 7, freischwebend gebaut – man weiß nicht, ob sie gebaut wurde – irgendwann wird sie eine Luftbrücke…
Das ist ein sehr gutes Bild.
Für das Verhältnis – ich mache absichtlich die Unterscheidung – zwischen dem vorderen Grund und dem, was dahinter noch sein kann, gibt es ein sehr gutes Beispiel. Es gibt ja dieses Gedicht von Mörike, „Auf eine Lampe“. Das ist ein bekanntes Thema. Die Frage, was bedeutet „ scheinen in sich selber“ – bedeutet das videtur oder lucet? Ich komme deswegen darauf, weil ich es an einer ganz zurückgenommenen Stelle zitiere, aber nicht kenntlich zitiere. Sondern es taucht nur in einer Zeile auf: Lampenschein und Haut. Da muß ich darauf hoffen, daß jemand die im vorderen Grund stehende Nennung von Lampenschein erkennt – und dann kommt die dazugehörige Wissensmöglichkeit: Das Verhältnis zwischen Lampenschein und Haut beinhaltet das Wissen um die Verfertigung von Lampen aus menschlicher Haut, zum Beispiel an der Universität in Straßburg, von Leichen aus dem Konzentrationslager in Struthof, oben auf den Vogesen. Dann wird die Fraglichkeit sofort präsent zwischen videtur und lucet. Da ist nur die einfache Zeile. Das ist etwa so wie ein gewisser Akkord oder ein Anschlag auf einem Klavier, der einige Akkorde aus der Winterreise antippt. Wer’s nicht hört, hört’s nicht. Das braucht’s ja auch nicht. Aber wer’s hört, hat sofort das Ganze vor Augen, in den Ohren.
Wenn es gelingt, als vorderen Grund für’s Nachdenken dieses einfache Thema anzuschlagen, was eine sehr vergängliche Form ist, damit alles andere erscheint, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich denke, je einfacher diese Zitationsverhältnisse sind oder die Leonardo-Brücke gebaut wird, umso schöner ist der Bogen.
1 Alexandru Bulucz: was Petersilie über die Seele weiß. Gedichte. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2020, S. 35
2 Paul Celan: Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe. Hrsg. und kommentiert von Barbara Wiedemann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. S. 106
3 Hans Blumenberg: Sprachsituation und immanente Poetik. In: Poetik und Hermeneutik 2, „Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion“, Lyrik als Paradigma der Moderne. Kolloquium Köln 1964, Vorlagen und Verhandlungen. Hrsg. von Wolfgang Iser. ISBN: 3-7705-0105-5. Wilhelm Fink Verlag, München 1966. S. 150
4 Für Aristoteles ist der aufrecht stehende Mensch Teil eines vertikal geordneten Kosmos, in dem das Vollkommenheitsprinzip eine von unten nach oben zunehmende Steigerung erfährt. In der Metaphysik, übersetzt von Hermann Bonitz und Horst Seidl, heißt es: „Denn Verwunderung war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens, indem sie sich anfangs über das nächstliegende Unerklärte verwunderten, dann allmählich fortschritten und auch über Größeres Fragen aufwarfen, z. B. über die Erscheinungen an dem Mond und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls.“(982b) Muellers Gedicht „Vertikal, noch“ nimmt darauf Bezug.
5 Gemeint ist Theodor W. Adorno. Vollständig lautet der Satz, den er 1949 schrieb und der 1951 veröffentlicht wurde: „Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber: nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.“
Theodor W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft. In: Gesammelte Schriften, Band 10.1: Kulturkritik und Gesellschaft I, „Prismen. Ohne Leitbild“. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977. S.30
6 Rainer René Mueller mußte erfahren, daß sein Stiefvater während des Krieges zu einer Einsatzgruppe gehörte, die an Nazi-Verbrechen beteiligt war.
Mueller hat seinen Stiefvater vor einigen Jahren sogar auf einem in der Presse zirkulierenden Foto entdeckt: den Pistolenschützen auf dem im Archiv von Yad Vashem aufbewahrten Bild. Es zeigt ihn kurz vor einer Hinrichtung im ukrainischen Winnyzja, wahrscheinlich im Jahr 1941, an einem der Schauplätze der Massenerschießungen jüdischer Bürger, vor einer Grube voller Leichen.
7 Im Codex Atlanticus (1478-1518) hat der Künstler und Erfinder Leonardo da Vinci unter anderem eine Brücke skizziert, die ausschließlich aus verkeilten Rundhölzern besteht, sich durch deren Verschränkung selbst stützt und so als freitragender Bogen gebaut werden könnte. Ob die Leonardo-Brücke je realisiert wurde, ist nicht bekannt.
——————————————————————————————————————
Aus: Alexandru Bulucz: „was Petersilie über die Seele weiß“, Frankfurt am Main (Schöffling & Co.) 2020.
Lieber Unkel Paol 1 ,
die Kältin macht sich wieder breit, sickert langsam, aber sicher ein
in Ackerschollen u. andere Wunden, die ollen.
Die Kältin macht einen auf Stechimme, sie sticht immer
tiefer den Spaten, den mit dem Widerhaken, in frostige Böden u. andere Öden.
Ihr spätnovembriges Gestichel löst Kältekopfschmerz aus.
Du Schütze, dein Monat ist eine kaltschnäuzige Ernte.
Der Sommer hatte uns so lange im Schwitzkasten, dass Lots Frau
Lotte bei diesem Temperatursturz aus allen Himmeln die Kinnlade runterfällt
an dem vor drei Jahrhunderten aufgestellten, aber als Stele
nach oben sich leicht verjüngenden preußischen Meilenstein
am Schloss Tegel, mit vom Regen unkenntlich gemachter Angabe
u. vom vielen Schleifen von Äxten u. Sensen entkanteten, nein:
zu verkennenden Kanten, von wo aus die wilden Bolde Willy u. Alex 2
durch Welten trampten u. so weit kamen, wie sie Hummeln im Hintern hatten,
die in See stachen, u. ihre Katzensprünge machten – zu den zwei dicken Maries,
als da wären die Köchin des Schlosses u. eine Rieseneiche an der großen Malche,
wobei die eine der anderen den Namen gab o. umgekehrt die andere der einen
in Selbstähnlichkeit von Taille u. Brusthöhe, wiewohl in aller Wahrscheinlichkeit
keine von der anderen wusste,
nicht von der Köchin die Eiche, die bald tausendjährige, wie die einen schätzen,
u. die Köchin nicht von diesem Exemplar des fast deutschesten aller Bäume,
was für die anderen feststeht,
dass selbst ein Alter von 350 Jahren reichte, um eine Zeitgenossin gewesen zu sein
der Dronten, deren eine Dörte, Traute o. Droste hieß.
Ja, die dicke Marie muss nicht bald tausendjährig sein,
um auch andere Kältinnen erlebt zu haben
als die, die ich heute hier mir ihr teile: des Tegeler Sees Tripelpunkt,
an dem Eis u. Wasser zu Wasserdampf verdampfen u. Eis zu Wasser schmilzt,
während Wasser gefriert u. Wasserdampf zu Wasser kondensiert u. als Eis ausfriert –
im Kampf sich anbibbernder Aggregatzustände um thermodynamische Balancen
zu trippeln – u. Doppelkonsonanten Doppelkorn nachschütten,
der wiederum nicht unterscheiden kann
zwischen langen u. kurzen Vokalen, zwischen Siegfrieds Schrottcollageengel
für Hannah, den er als archaischen Erz-Engel bezeichnet,
um an die Erze zu erinnern, daraus einige seiner Materialien gewonnen wurden,
um die hohe Stellung seines Engels in der Hierarchie der schieren Schar
doppelt abzusichern, denn doppelt gesharet hält besser,
u. ich kann sie zu dieser Uhrzeit weiß Gott nicht auseinanderhalten,
den Pleonasmus u. die Tautologie, zwischen Siegfrieds Schrottcollageengel,
der in der Verlängerung der Gabrielenstr. als ein Gabriel durchgeht
aus Holzbohlen, Planken u. metallenen Räderwerken,
mit Flügeln aus Teilen eines Bootsrumpfes,
eines Schwimm- u. Flugfähigkeitsgaranten zugleich
zwischen Siegfrieds Schrottcollageengel
an der großen Malche, der auf den Tegeler See blickt,
auf dem Siegfried u. Hannah eisliefen, als er zugefroren war,
für meine Begriffe im Begriff, für meine Gefühle im Gefühl,
sich mit ganzer Kraft abzustoßen
bei dem Gedanken an die Degeneriertheit einer Zeit,
in der Kunst als entartet galt
zwischen dem Engel der Geschichte, der so aussehen muss
wie Siegfrieds 3 Engelsschichten für Hannah 4 ,
u. dem Tegeler Gefängnis,
in dem Dietrich 5 seine berühmten Briefe schrieb u. an Dankbarkeit u. Reue
dachte, die uns unsere Vergangenheit immer gegenwärtig halten,
während du, lieber Unkel, im Arbeitslager bei Buzău im Straßenbau malochtest
an der großen Malche, wo es im Restaurant am See,
anders als im Gulag, Gulasch gibt, zwischen all dem u. euch dreien am Tripelpunkt,
die ihr eines zerbrochenen Kruges Scherben von Schergen seid,
zerstreute Funken mit Furunkeln,
u. schrieb nicht Primo 6 vom Beginn des Todes bei den Schuhen?
Dass dicke Füße niemals loszuwerden seien
im Lager, dem regalen? Liegt es auf der Hand:
Der Tod beginnt bei den Furunkeln, lieber Unkel,
Edith 7 fällt mir ein, die Petze:
Du hättest bei dem Kaffeekränzchen mitgesungen
das Arbeiterlied Brüder, zur Sonne, zur Freiheit,
das Hermann 8 aus ’nem Lager im Ural ins Deutsche brachte.
Unkel, bist du ein Towarischtsch
im Spätherbst u. mit allem, was dazugehört,
der Uschanka auf den Ohren, die dann langzuziehen wären,
den Bokantschen an den Füßen, die dann bleiern wirkten,
mit genug Okroschka, Borschtsch u. Schtschi für dich u. die Genossen?
Allein, dein Getreide leuchtet nicht u. leuchtete noch nie.
Auf dem Felde körpern sie, die Halme, nur herum,
weder Sinn noch Sense, nur der Mann mitohne Sinn,
der zeigt, wohin der Gerste u. der Hirse, wohin des Roggens u. des Weizens
Ähren (quasi als Vektoren) zeigen,
der zeigt zur Erd’ nach unten, dann zeigt er auch zu Knochen-, Ähren-Diemen,
die auch Tristen heißen, die auch Diemen dimmen. Da liegt es sich eng.
Tegel u. Frankfurt im November u. Dezember 2018,
Rainer René Mueller zum 75.
1 „Unkel Paol“ nannte sich Paul Celan etwa in einem Geburtstagsgedicht für Klaus Demus.
2 Die Gebrüder Humboldt.
3 Siegfried Kühl.
4 Hannah Höch.
5 Dietrich Bonhoeffer
6 Primo Levi.
7 Edith Silbermann.
8 Hermann Scherchen.
Letzte Änderung: 01.01.2024 | Erstellt am: 01.01.2024

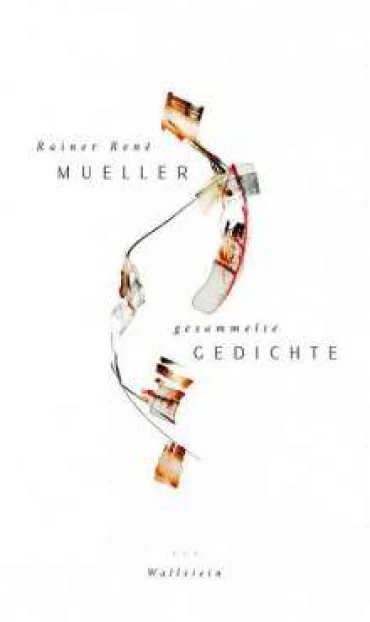
Rainer René Mueller Gesammelte Gedichte
Hrsg. von Chiara Caradonna und Leonard Keidel
526 S., gebunden
ISBN 978-3-8353-3998-9
Wallstein Verlag, Göttingen 2021
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


