Die Scheiben des Aquariums
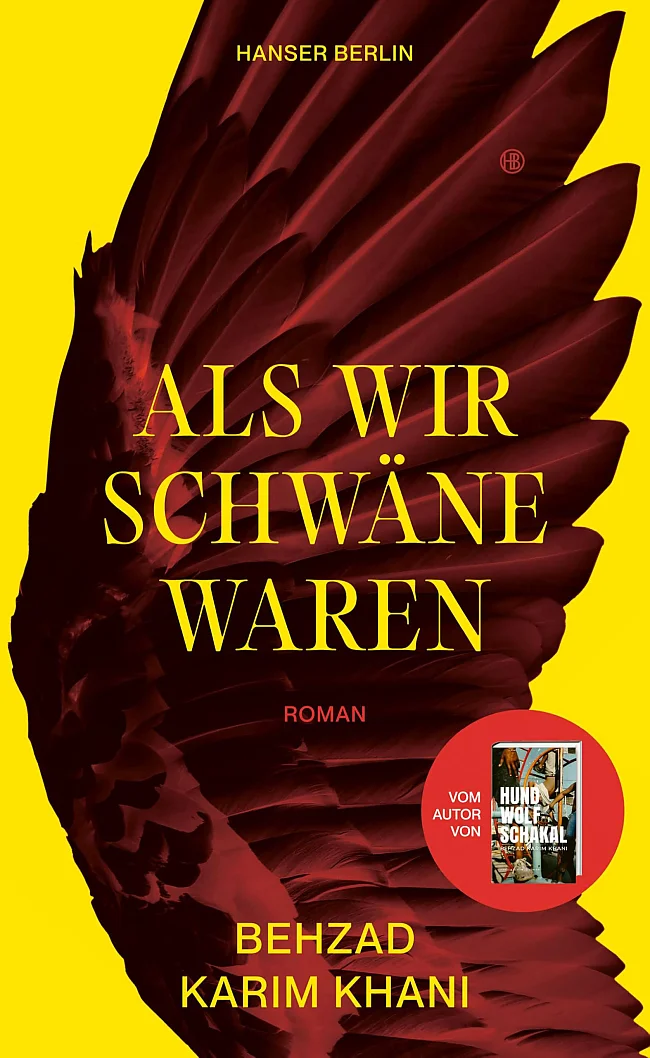
Behzad Karim Khanis neuer Roman Als wir Schwäne waren ist ein poetisches, schmerzhaft klares Zeugnis migrantischer Kindheit im Ruhrgebiet – erzählt mit der Wucht jugendlicher Sprache und der Reflexion eines Erwachsenen. Alban Nikolai Herbst liest Khani als Mahnung an uns alle, unsere Vorstellung von Würde, Heimat und Sprache radikal zu hinterfragen.
Aber ich wußte, daß westliche Therapie keinen östlichen Geist kennt. Den Geist, der das Offensichtlichste nicht verkennt. Daß das Leben nämlich tragisch ist und Reden nichts daran ändert.
In der Tat, da hat Behzad Karim Khani in seinem neuen Roman „Als wir Schwäne waren“ schon recht: Den Gedanken an Tragik lehnen wir Europäer längst ab; er würde uns der Illusion des Freien Willens berauben. Wie aber kann sie einem Orientalen denn werden, wenn er, zumal als „Perser“ – es ist wichtig, dass Khani sich so nennt und nicht etwa „Iraner“ …
In unserer Sprache gibt es zehn, fünfzehn verschiedene Begriffe für Stolz.
– … wenn er und seine Eltern aus der verlorenen Heimat in ein Problemgebiet des tiefsten Ruhrpotts hineingestopft werden und weder der Bachelor des Vaters, in Soziologie, noch der Abschluß der Mutter anerkannt werden, so daß beide ganz von vorn zu studieren beginnen, aber eben auch Geld verdienen müssen, um dem kleinen Sohn eine Zukunft zu sichern? Freilich stellt sich am Ende des Buches heraus, sie haben sie ihm anders als ökonomisch gegeben – mit etwas, das wir selbst längst vergaßen: Stolz.
An den mich Khani wieder dringend erinnert.
Bezeichnend nämlich, was die Mutter erzählt, nachdem sie und ihr Mann endlich einmal wieder in die Heimat geflogen und zurückgekommen waren; vor Jahren habe ich selbst dergleichen erlebt, als hier am Helmholtzplatz, Berlin, zwei kleine orientalische Mädchen vor sich einiges Spielzeug, um es anzubieten, aufgebaut hatten, ich ihnen ein Matchboxauto abkaufen wollte, doch vermeintlich, um großzügig zu wirken, statt der verlangten einsfünfzig auf zwei Euro aufrunden wollte. Sie lehnten es – zu meiner solchen Hochachtung, daß mir den Rücken die Scham runterlief – mit geradezu denselben Worten ab wie da dieser Bub im Iran:
Als (meine Eltern) wiederkommen und ich frage, wie es war, erzählt Mutter mir von einem acht- oder neunjährigen Straßenjungen, der im stockenden Verkehr Teherans an die Autoscheiben klopft, um Kaugummis zu verkaufen, und davon, daß sie, weil sie keine Kaugummis brauchte, dem Kind aber helfen wollte, ihm einfach Geld anbot, das der Junge ablehnte. Er sei ein Verkäufer, kein Bettler.
„Und jetzt sag mir, daß es in Deutschland einen Menschen gibt, nicht einmal ein Kind, einen erwachsenen Menschen, der das machen würde. Einen, der so viel Würde besitzt.“
Ja, wir können einiges lernen, wiedererlernen, bei der Lektüre dieses Buches, nicht nur von den Schwänen, die dem Roman den Titel geben – von denen freilich auch: Sie leben im anderen, einem unerreichbaren Land.
Als wir die Heimat verlieren.
„Als wir Schwäne waren“ ist des 1977 geborenen Behzad Karimi Khanis zweiter Roman; der erste (den ich noch nicht kenne) wurde 2022 zum Bestseller. Dies ist dem neuen Buch nun ganz besonders zu wünschen, das uns in die migrantische Kindheit und Jugend vielleicht des Autors selbst, vielleicht „nur“ seiner Figur führt – erzählt aus der Perspektive des schon erwachsenen Mannes, aber in quasi der Sprache erzählt, nämlich durch die Augen des Jungen, als er des Deutschen (indes sein Vater Schiller bereits in der Originalsprache liest) noch nur bruchstückhaft mächtig war und ihrer weniger ohnmächtig wurde durch einen Jargon, den Feridun Zaimoglu Kanaksprak genannt hat und selbstverständlich ein Spiegel der ökonomischen Verhältnisse ist, nämlich einer Hilflosigkeit, die nun die Armut erst recht zementiert:
Nur Serdar schwamm nach unten und vielleicht gehört das zu den Dingen, die passieren, wenn Armut keinen Geruch hat. Sich keine Goldketten umhängt, keine großen Autos fahren will. Nicht die Trikots der Champions-League-Vereine trägt. Vielleicht ist das eines der Dinge, die passieren, wenn Armut Status und Sieg nicht wenigstens vortäuscht. Wenn Armut nicht lügt. Nicht wenigstens so tut, als hätte sie alles im Griff. Sich nicht schämt.
So sind wir abermals beim Stolz, einem, der sich nur noch in der Kriminalität bewahrt (oder im Verstummen), einem deshalb notwendigerweise inversen. Um es in den Worten Dimitris zu sagen, eines ebenso brutalen wie zugleich enorm ambivalenten jugendlichen Straßenschlägers, der dem Jungen Vorbild, aber auch zum Schutzschild wird:
„Bei Raub guckst du deinem Gegner noch in die Augen, mußt du noch deinen Mann stehen. Dann kommt Diebstahl. Das ist linkisch, weil das heimlich ist und hintenrum. Aber beim Betteln hast du die Kontrolle ganz abgegeben. Das ist passiv. Du bist abhängig. Das ist ganz unten. Und jetzt guck mal, wie die Strafen dafür sind. Andersrum. Je mehr Stolz du haben mußt, desto höher ist die Strafe. Betteln ist fast legal. Diebstahl wird auch bestraft und für Raub gibt es richtig Knast.“
Derweil wir selbst unterdessen unsern Wert daraus beziehen, uns als Opfer zu geben – für Orientalen derart unverständlich, daß sie uns verachten. Und weil sie, wenn sie es doch sind, Opfer, es bleiben auf keinen Fall wollen und es aus Selbstachtung nicht zulassen, daß sie es sind, bleibt eigentlich nur die schiefe, die kriminelle Bahn – in fast jedem Fall für die Kinder, egal, welch Elternhaus sie haben, und als Jugendliche ganz besonders, da sie die Pubertät im Griff hat und haben ja auch sollte. Was wiederum, indem er’s erkennt, den Autor Sätze finden läßt, deren harte Poesie uns vor Mitleid erschüttert:
… warum meine Zärtlichkeit grade noch ausreicht, um meine Grausamkeit zu begreifen | Unser Viertel ist ein Aquarium. Wir verstehen nur die Scheiben nicht. | Ich kann nicht unterscheiden, ob sie nicht schön ist oder ob sie eine Schönheit besitzt, die nicht für mich gedacht ist.
Wobei, Mitleid? An dem man hierzulande
Anstoß nimmt. Daß es hier Beileid gibt oder Mitgefühl, aber kein Mitleid. (So gibt es) Geiz (…) auch im Iran, aber hier ist er offiziell. Hier muß sich die Großzügigkeit erklären.
Welch furchtbarer Befund! Zumal für die Eltern, daß Geiz geil sei, so ungeheuerlich ist, daß sie schon den Slogan nicht begreifen, sie, für die alleine schon
Geld (…) so obszön ist, daß sie mir beigebracht haben, mir die Hände zu waschen, wenn ich welches angefaßt habe.
Doch brauchen sie es dringend, die Mutter jobbt neben dem neu von vorn an aufgenommenen Studium, der Vater fährt Taxi oder hilft an einem Kiosk aus. Eine ökonomisch gesicherte Zukunft ist nicht zu erkennen, und klar, der Junge, als Bub schon, bricht aus, orientiert sich an den Jugendlichen der Gangs, die die Straße beherrschen, beginnt zu dealen, dealt in immer größerem Stil, wird erwischt … – Der Vater schweigt. Doch gilt auch jetzt, daß
Vaterschaft in unserer Familie in Freundschaft übergeht und wir unseren Vätern wieder begegnen.
Es ist dieses, und der Stolz, was es dem dann jungen Mann erlaubt, den Jugendbanden zu entkommen; freier Wille ist es nicht – zumal leider gilt, was ich als Motto dieser Besprechung gewählt hab. Lesen Sie’s oben noch einmal.
„Als wir noch Schwäne waren“ ist ein Buch der Selbstermächtigung. Wenn ich den Prolog des kleinen Romans richtig verstehe, ist es als Brief an den nun eigenen Sohn gemeint, auch wenn er ohne Anrede auskommt, weil er nämlich geschrieben nicht nur für ihn ist, sondern für wahrscheinlich viele andere, die ähnlich aufwachsen mußten, noch immer so aufwachsen – doch poetischerweise auch als einer an uns deutsche Leserinnen und Leser. Damit wir erahnen, was auch wir verloren haben – nicht die Heimat als Landschaft und Land, sondern etwas darunter:
Weil Land nur die Oberfläche ist, und so, wie er (der Vater) es betont, liegt das, was er fühlt, tiefer.
Meiner Generation war, als Deutsche, dazu der Zugang lange verwehrt; wir haben als Jugendliche lieber „I love you“ gesungen, als daß ich Dich liebe. Daß ich Dich liebe, erschien uns obszön. Nach Auschwitz Gedichte? Als Ermahnung, ja moralischer Imperativ dräut das schon bei Adorno nach. Stolz, ach ja? Worauf? Besser, man holt sich die Kultur bei dem Sieger, der solche Schuld nicht trägt, am weitesten weg von uns ist und dennoch uns mächtig versprechensverwandt.
Auch wir sind heimatlos gewesen, doch ohne emigriert zu sein; wir waren es vor Ort. Und wurden in einer andren Sprache zuhaus.
Nein, kein bewußter Prozeß. Dieser Roman läßt’s uns erkennen. Das macht ihn außergewöhnlich, weil wir seine Adressaten ja allenfalls indirekt sind; Adressat ist, wie schon erzählt, Behzad Karim Khanis Sohn. Vielleicht habe ich deshalb, nachdem ich zu lesen begann, zu lesen nicht mehr aufhören können. Dabei sind mir die Musiken fast gänzlich fremd, auf die sich der Autor ständig bezieht; die meisten kenne ich nicht einmal. Erst, als der Rap ins Spiel kam – auch da geht es um Würde:
Die erste Frage, die wir stellen, bevor wir uns für einen Rapper entscheiden, ist: Ist er echt? Und mit echt meinen wir immer kriminell.
– erst da kam ich ein wenig mit, doch nur, weil ich einen jungen Sohn habe, der selbst für den Rap schreibt (was mich aus Liebe neugierig machte). Doch kommt es insgesamt darauf nicht an – vielleicht das erstaunlichste an diesem schmalen Roman, wie mich allein die Sprachperspektiven mitnahmen; auch mich berückte besonders die Echtheit, eine von, trotz der kurzen Sätze, hoher Artifizialität, die Kinder- und Jugendlichenjargon sowie die Reflexion eines Erwachsenen nahtlos miteinander, ja ineinander legiert. Daß daraus sogar poetische Schönheit ersteht, hat mich bisweilen sprachlos gemacht. Wie jede wirkliche Schönheit ist sie freilich nicht glatt, sondern nicht selten nicht ohne Rätsel. An deren Lösung möglicherweise auch wir scheitern müssen und sind dann selbst wie der Vater
der Arm, von dem man nicht weiß, wo man ihn hintun soll. Er ist der verlegene Arm meiner Familie.
Deshalb also auch schrieb Behzad Karim Khani dieses Buch – ich übernehme jetzt fast seine Worte – , damit es uns hilft, etwas zu finden, das uns selbst längst entglitt: Nämlich die Möglichkeit einer Heimat. Verstehn Sie mich nicht falsch. Ich will Ihnen die Idee der Heimat nicht nahelegen. Schon gar nicht will ich Ihnen dieses Buch als Heimat nahelegen. Sondern Sie sollen wählen können – mehr als immer dieselbe Antwort. In eine andere, uralt neue hüllt sich dieser Roman. Finden wir sie, werden wir nicht nur „die Fremden“, sondern vielleicht auch uns selber verstehen. Und ehrenvoll miteinander zu sprechen beginnen.
Letzte Änderung: 21.04.2025 | Erstellt am: 21.04.2025
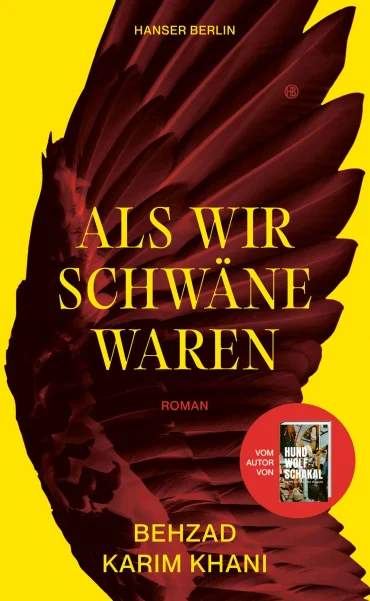
Behzad Karim Khani Als wir Schwäne waren
Roman
Erscheinungsdatum: 19.08.2024
192 Seiten
Hanser Berlin
Hardcover
ISBN 978-3-446-28142-4
Deutschland: 22,00 €
Österreich: 22,70 €
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


