Berliner Antisemitismusstreit

„Natürlich wird die Mehrheit kaum gewünscht haben, concret gewünscht, dass die Juden ermordet wurden, aber es genügte, dass die Mehrheit mit der Entrechtung der Juden zufrieden war, sich in sie fand. Hätte die Mehrheit der Deutschen nicht so unbesonnen nationalistisch gedacht, dann hätten wir Hitler genauso wenig bekommen.“, schrieb 1965 Walter Boehlich an Ilse Curtius. Hätte man seinen Band „Der Berliner Antisemitismusstreit“ aus demselben Jahr gelesen, schreibt Jutta Roitsch, wäre eine bessere Aufklärung möglich gewesen.
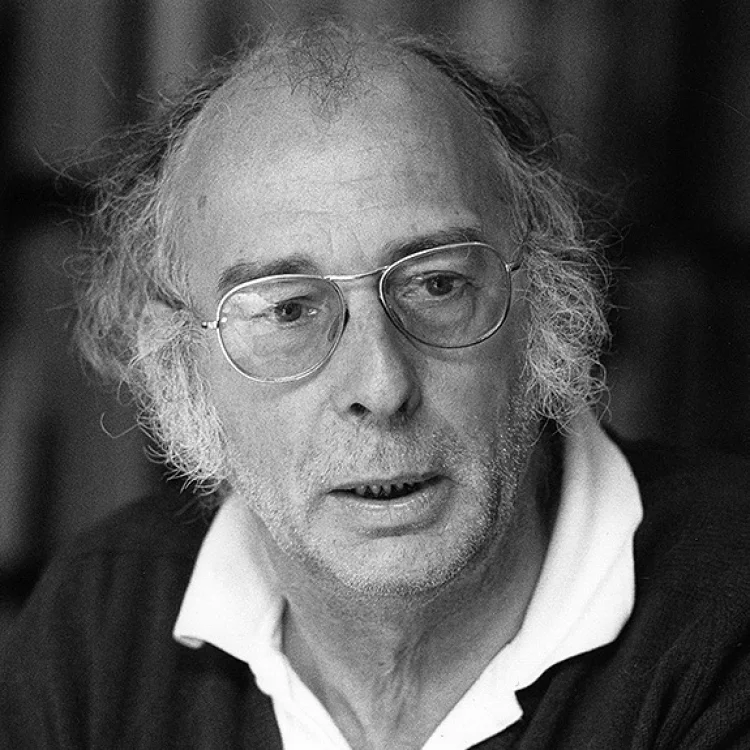
Seit wenigen Tagen halte ich die Textsammlung zum „Berliner Historikerstreit“ aus dem Jahr1879 in den Händen, die Nicolas Berg kommentiert und mit ergänzenden Beiträgen neu herausgegeben hat. Und ich bin erschüttert. Ich habe diese Texte bisher nahezu alle nicht gekannt. Wie konnte das passieren, wo mich doch keine politische Frage mehr umgetrieben hat als die: Wieso haben im deutschen Bürgertum Wissenschaftler, Politiker und Journalisten in den letzten hundert Jahren demokratisch, national und sozial so versagt, sich völkischem Gedankengut so bereitwillig geöffnet? Warum nahm im Deutschen Reich unter den bürgerlichen Eliten das antidemokratische und antijüdische Denken einen solchen Platz ein? Wer waren die treibenden Kräfte bei den Angriffen gegen die angeblich nationalunwürdigen jüdischen Deutschen? Wer war es, der ihnen absprach, Patrioten zu sein? Wie stark waren Gegenkräfte und wer stand für sie?
Eine umfassende Antwort hätte ich 1965 mit der ersten Veröffentlichung der Textsammlung durch Walter Boehlich im Frankfurter Insel Verlag bekommen können. Doch in meinen letzten Semestern am Otto-Suhr-Institut in Berlin spielte sie keine Rolle. Soweit ich mich erinnern kann, erwähnte keiner meiner jüdischen Lehrmeister (Ernst Fraenkel, Richard Löwenthal, Ossip Flechtheim) diese Textsammlung zum Berliner Historikerstreit von 1879. Keiner bot ein Leseseminar an, auch Kurt Sontheimer nicht, bei dem ich ein Jahr später das Diplom machte und der das für mich (im wahrsten Wortsinn) wegweisende Buch über „Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik“ geschrieben hat. Und der uns mit dieser sieben Mark teuren Textsammlung (Erstauflage 4500 Exemplare) eigentlich hätte konfrontieren müssen. Warum beschwiegen diese Professoren, die im Dritten Reich verfolgten, rausgeworfenen und doch zurückgekehrten Hochschullehrer, diesen „Streit“ unter Heinrich von Treitschke und Theodor Mommsen, den beiden Historikern an der Berliner Universität? Als junge Politikstudentinnen und -studenten hätten wir die Auseinandersetzung suchen und führen müssen. Heinrich von Treitschkes wissenschaftlich verbrämter Text „Unsere Aussichten“ in den Preußischen Jahrbüchern (1879) über das „Erwachen des Volksgewissens“ und seine diffamierende Beschreibung der „deutschen Judenfrage“ gipfelte schließlich in dem Satz: „Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuths mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: Die Juden sind unser Unglück“.
Was hat meine Hochschullehrer damals abgehalten? Die Furcht vor schlafenden Hunden? Wollten sie uns oder vielmehr sich selbst schützen, die Zeit von 1879 bis 1965 noch einmal zu durchdenken? Waren sie zu unsicher über den neuen demokratischen Anlauf dieser jungen Deutschen, die da im Hörsaal vor ihnen saßen? Wir hatten damals keine Chance, ihnen diese Fragen zu stellen. Wenige Jahre später schleuderten ihnen eifernde Studenten andere Fragen ins Gesicht, die Menschen wie Löwenthal und Fraenkel an finsterste Zeiten erinnerten, die 1968 ja erst dreißig Jahre vorbei waren. Ernst Fraenkel zog sich verbittert zurück, der streitbare Löwenthal wechselte zu den Gründern der erzkonservativen bis reaktionären „Notgemeinschaft Freie Universität (Nofu)“ und dem „Bund Freiheit der Wissenschaft“: Bis dieser ehemalige Journalist ohne Doktortitel erkannte, wie viele antidemokratische (vielleicht auch antijüdische) Spuren in diesen Professorenkreisen noch oder wieder zu finden waren.
Von Seite zu Seite, die ich jetzt lese, von Treitschke über Harry Bresslau bis Mommsen, wird mir klarer, wie sehr ich diese Texte und die Auseinandersetzung darüber damals gebraucht hätte. Sie wären so etwas wie ein Rüstzeug für den Einstieg in meinen Beruf, den politischen Journalismus, gewesen: Eine Mahnung zur Aufmerksamkeit und zur Hellhörigkeit, zum genauen Abklopfen und Wägen der Sprache. Mit dem Wissen im Hintergrund hätte ich als für Bildungspolitik zuständige Redakteurin der Frankfurter Rundschau die massiven Widerstände gegen neue Rahmenlehrpläne für den Schulunterricht (Deutsch und Gesellschaftslehre) vor allem aus Historikerkreisen und die harten Auseinandersetzungen in der gesamten Breite der Schul-, Ausbildungs- und Hochschulpolitik Ende der 1960er Jahre und der folgenden Jahrzehnte in der Bundesrepublik vielleicht schneller und weniger mühselig ein- und zuordnen können. Hellhöriger noch hätte ich journalistisch auf die ersten Töne gegen die „Gastarbeiter“ und zur Ausländerfeindlichkeit Ende der siebziger Jahre reagieren, intensiver forschen müssen, warum Helmut Schmidt als Bundeskanzler seinen Arbeitsminister Herbert Ehrenberg bremste, die erste Generation der „Gastarbeiterkinder“ sozial und beruflich zu fördern, und noch 1992 in einem denkwürdigen Interview (in der FR) sich offen dagegen verwahrte, die Bundesrepublik sei eine Einwanderungsgesellschaft. Erschien ihm das demokratische Fundament zu unsicher, um mit neuem Fremden, der deutschen Vereinigung und Zugewanderten aus anderen Kulturen umzugehen? War ihm der verräterische Treitschke-Satz noch zu bewusst, dass er der demokratischen Stabilität der deutschen Gesellschaft misstraute?
Doch was war 1988, als der umtriebige und streitbare Boehlich einen zweiten Anlauf nahm und kurz nach dem und mit Blick auf den neuen Historikerstreit zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas über die Bewertung von Holocaust und Stalinismus die im wesentlichen unveränderte Textsammlung erneut als preiswertes Taschenbuch veröffentlichte? Auch diese Ausgabe erreichte die politische Redaktion, erreichte mich nicht. Aber sie hätte mich erreichen können, wenn ich angesprochen worden wäre, vom Verlag selbst oder meinen Kollegen im Feuilleton: Ich hätte für zentrale Texte oder Textausschnitte die Dokumentationsseiten, die ich in der FR-Redaktion verantwortete, freigeräumt: Ich weiß bis heute, welche Bedeutung diese Seiten mit Originaltexten damals, als es das Internet noch nicht gab, für Lehrerinnen und Lehrer, für Studentinnen und Studenten, aber auch ihre Hochschullehrer im praktischen Unterricht hatten. Ein Versuch wäre es zumindest wert gewesen, um mit der jungen Generation der 1980er Jahre über die Wurzeln des deutschen Antisemitismus und die Rolle des gebildeten Bürgertums ins Gespräch zu kommen. Ob auf die Edition in irgendeinem Schulbuch der damaligen Zeit hingewiesen wurde? Ich weiß es nicht. Nachlesbar sind heute noch die Besprechungen durch würdige Kritiker in den überregionalen Medien. Das Buchereignis des Walther Boehlich blieb aber nach meiner Wahrnehmung in der Welt der Feuilletons hängen. Kurz nach dem aktuellen Historikerstreit, kurz vor dem Fall der Mauer, den Kriegen auf dem Balkan und dem Zerfall der Sowjetunion gab es offenkundig bei den politischen Stiftungen oder den sonstigen Bildungsakademien, die für breitere Resonanz hätten sorgen können, wenig Neigung, wieder in den Streit über den Antisemitismus im deutschen Kaiserreich einzusteigen.
Und jetzt? Ich lese und erschrecke. Ich erkenne bekannte, immer wieder auftauchende Gedankengänge, Wörter, Muster der Fremdenfeindlichkeit, des Ausgrenzens und des Völkischen. Ich erkenne die Wurzeln der immer wieder hervorgekramten „Leitkultur“, der Anpassung an etwas, was als ein angeblich „echtes“ Deutschsein ausgegeben wird. Den ehrenwerten Historiker und Berliner Universitätsprofessor Theodor Mommsen, der einzige namhafte Nichtjude, der in der damaligen Auseinandersetzung öffentlich gegen Treitschke Stellung bezogen hatte, lese ich heute kritischer als Boehlich, der ihn als unbestechlichen Liberalen und Moralisten würdigte. Mommsen verlangte schließlich von den jüdischen Verbänden und Gemeinden, unsichtbarer zu werden, sich als Deutsche ohne „Sonderverhalten“ zu assimilieren. Bekannte Töne? Ich lese mich durch den umfangreichen, um drei neue, sehr bewegende Texte erweiterten Band und durch die unglaublich gründliche und aufwändige Kommentierung von Nicolas Berg, der am Simon Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig arbeitet. Die Edition, so schreibt Berg in seiner Einführung, „stellt die für die Selbstaufklärung der Bundesrepublik so zentralen Fragen, warum der Antisemitismus im deutschen Kaiserreich so weitreichend Gehör finden konnte, warum er seinerzeit zum Teil der politischen Kultur der Gebildeten wurde, wie er sich radikalisierte und welche Folgen das im 20. Jahrhundert nach sich zog.“ Hinter der betonten Nüchternheit des Herausgebers ist eine eindringliche Botschaft zu erkennen: Bitte, Männer und Frauen, die ihr wachsam und demokratischen Willens seid, vertieft euch noch einmal in den Berliner Antisemitismusstreit von 1879. Er ist aktuell. Immer wieder, schon wieder.
Letzte Änderung: 15.08.2023 | Erstellt am: 15.08.2023

Walter Boehlich, Nicolas Berg (Hrsg.) Der Berliner Antisemitismusstreit
Neu herausgegeben und eingeleitet von Nicolas Berg
544 S., brosch.
ISBN-13: 9783633543113
Jüdischer Verlag, Berlin 2023


