
Fjodor Dostojewskij gehörte zu der enormen Anzahl von Schriftstellern, die schreiben mussten, um ihre Schulden abzutragen, – was in den seltensten Fällen gelang. So stand das Geld im Mittelpunkt seines Schaffens, im Wechsel mit Gott und dem Verbrechen. Nun hat der Slawist Andreas Guski eine Dostojewskij-Biographie geschrieben. Gudrun Braunsperger hat sie mit der gleichen Atemlosigkeit gelesen wie die Romane Dostojewskijs.
200. Geburtstag von Fjodor Dostojewskij
Es ist still geworden um diesen Autor. Fjodor Dostojewskijs Werk ruht gut verwahrt im Kanon der Weltliteratur. Für den intellektuellen Diskurs scheint er sich als Prophet der 20. Jahrhunderts, als den ihn Albert Camus mit dem Blick auf die Totalitarismen seiner Epoche noch vor einem guten halben Jahrhundert gepriesen hat, erledigt zu haben. Mit der Rezeption dieses Autors im 21. Jahrhundert ist es eine heikle Sache: Romane wie „Schuld und Sühne“ und „Die Brüder Karamasow“ sind dicke Wälzer mit verschlungenen Plots, die hohe und vor allem lang anhaltende Lesekonzentration erfordern, nichts für Eilige im hektischen Alltag der Gegenwart. In der fiebrig-nervösen Exaltiertheit so mancher Romanfigur entfaltet sich eine Form von Emotionalität, die dem nüchtern-sachlichen Grundton unserer Zeit zuwiderläuft. Und vor allem: Dreh- und Angelpunkt von Dostojewskijs Werk ist die Frage nach Gott im Ringen um Glauben und Zweifel. Die daraus abgeleitete zentrale Überzeugung, dass nämlich der Verlust des Glaubens die Ursache aller Probleme in Gegenwart und Zukunft sei, hat dazu beigetragen, diesen Autor und Denker einer säkularisierten Gesellschaft zu entfremden.
Damit ist leider auch einiges in Vergessenheit geraten, was den Schriftsteller aus Petersburg auf der Höhe unserer Zeit diskurswürdig macht. Neben der Psychologie der seelischen Abgründe des Menschen, neben einer Metaphysik des Verbrechens und neben der Bedeutung von Transzendenz für den menschlichen Geist zieht sich ein weiteres Thema durch so gut wie alle seine großen Werke, das eine Debatte über diesen Autor höchst aktuell und in Zeiten der globalen Finanz- und Schuldenkrise geradezu brisant erscheinen ließe: das Wesen des Kapitals in der modernen Gesellschaft. Die Gedanken dieses über weite Strecken seines Lebens hoch verschuldeten Schriftstellers kreisten ständig um Geld: Dostojewskij musste das Schreiben, das ihm als einzig mögliche Form von Erwerbsarbeit erschien, selbst finanzieren, anders als seine Schriftstellerkollegen und -konkurrenten Iwan Turgenjew und Lew Tolstoj. Sie waren als adelige Gutsbesitzer nicht auf die Einnahmen ihrer schriftstellerischen Tätigkeit angewiesen und hatten im russischen Verlagswesen nicht zuletzt deshalb einen weitaus höheren Marktwert. Aber nicht nur die Gesetze des modernen (Literatur)Marktes, mit denen Dostojewskij schmerzlich Bekanntschaft machte, hinterfragte er aus eigenem Erleben. Als nach dem Tod des Lieblingsbruders Michail das Projekt der gemeinsamen Zeitschrift endgültig eingestellt werden musste, das den Brüdern und der Familie Michails wenigstens eine Zeit lang das Auskommen gesichert hatte, verzockte Dostojewskij auf seinem vierjährigen Auslandsaufenthalt auf der Flucht vor seinen russischen Gläubigern notorisch sein Geld in deutschen Kasinos, zur Verzweiflung seiner Frau, die Kleider und Schmuck ins Pfandhaus trug. Geld wird in Dostojewskij Romanen gewonnen und verloren, verbrannt und gestohlen, es bewegt sich im Spannungsfeld zwischen dem fiktiven Ort Roulettenburg in „Der Spieler“ und dem Protagonisten Arkadij im „Jüngling“, der mit dem Vorsatz antritt, ein Kapitalist zu werden und am Ende ein weit wertvolleres Kapital erworben haben wird, nämlich sich selbst.
Zum ersten Mal seit mehr als einem Viertel Jahrhundert ist nun wieder eine Biographie über Fjodor Dostojewskij auf Deutsch erschienenen. Andreas Guski hat ein brillantes Buch geschrieben, das seinem biographischen Objekt absolut gerecht wird: einem Autor, der mit einst höchst publikumswirksamen kriminalistischen Romanen zum Klassiker wurde. Die Arbeit des emeritierten Professors für Slawistik an der Universität Basel ist wissenschaftlich ebenso solide wie vergnüglich zu lesen, wenngleich die Tragik der erzählten Lebensgeschichte betroffen macht. Man liest sie mit ebensolcher Atemlosigkeit wie Dostojewskijs Romane. Die Biographie ebnet den Weg zum Begreifen, zum Verstehen mit dem Herzen, um das es dem Dichter ging. Das lässt auch das Ungemütliche in seinem Werk besser akzeptieren, mit dem man sich bisweilen schwer tut, allem voran mit seinem Judenhass. Es ist ein Buch, das dazu angetan ist, heutigen Lesern den Weg neu zu bahnen zu einem Autor, von dem alles, was er als Fiktion zu gestalten vermochte, selbst erfahren, durchlebt und durchlitten worden war.
„Immer und überall gehe ich bis an die äußersten Grenzen, mein ganzes Leben lang habe ich diese Grenzen überschritten.“ Als Epileptiker machte er diese Grenzerfahrung in einem jenseitigen Bezirk: Er beschrieb das Glücksgefühl, das einem häufig Grauen erregenden Anfall voranging, als einen Moment der Hellsichtigkeit.
Die zentrale Grenzerfahrung seines Lebens war jedoch die Konfrontation mit dem Sterben im Alter von 28 Jahren. Als Mitglied einer gegen das autokratische Regime von Nikolaus I. gerichteten Gruppe utopischer Sozialisten wurde er nach einer mehrmonatigen Haft in der Peter-Pauls Festung zum Tod verurteilt und an einem eisigen Dezembertag 1849 im letzten Moment auf dem Richtplatz begnadigt. Das Todesurteil wurde in vier Jahre sibirische Gefangenschaft und weitere vier Jahre Verbannung umgewandelt. Über die Zeit inmitten von Schwerverbrechern im Lager geben die „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ Auskunft. Dorthin begleitete den Schriftsteller ein einziges Buch: das Neue Testament. Diese Zäsur in seinem Leben wurde zum Moment der Bekehrung. Nicht nur Dostojewskijs Hinwendung zu einer spirituellen Deutung von Welt hat an diesem Wendepunkt ihren Ursprung, sondern auch seine allmähliche Konversion zum späteren zarentreuen Konservativen, über die viel gerätselt wurde. In den folgenden Jahren festigte er seine europakritische Weltanschauung innerhalb des Diskurses der russischen Intelligenz des 19. Jahrhunderts auf der Seite der Slawophilen, die für Russland einen eigenständigen, an der russisch-orthodoxen Tradition orientierten Entwicklungsweg forderten und die seit Peter dem Großen vollzogene Orientierung am Westen und dessen Werten als individualistisch und zersetzend ablehnten. Dostojewskij, der diesen Disputen in seinen späten Romanen viel Raum gibt, kannte die Position der „Westler“, weil er sie einst selbst durchmessen hatte.
In der Vereinnahmung von Dostojewskijs Werk in Putins Russland spiegelt sich zum einen der „Autor der Krise“ wider, als den ihn Guski anhand der Rezeptionsgeschichte beschreibt, zum anderen ist die Diskussion zwischen Slawophilen und Westlern des 19. Jahrhunderts auch ein Schlüssel zum besseren Verständnis des aktuellen geopolitischen Konflikts, der alte ideengeschichtliche Bruchlinien wieder zu Tage treten lässt.
Erschienen zur Erstauflage am 1.12.2018 in „Die Presse“
Letzte Änderung: 15.11.2021 | Erstellt am: 14.11.2021
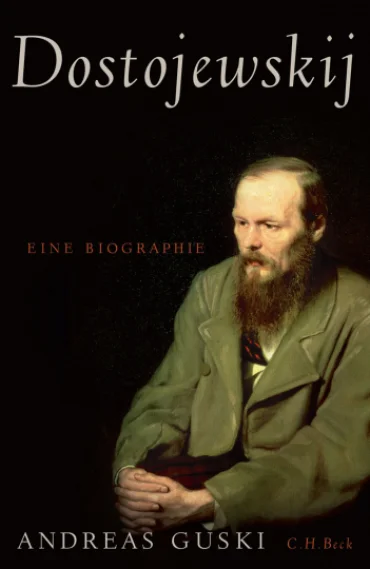
Andreas Guski Dostojewskij
Eine Biographie
464 Seiten, mit 30 Abbildungen
CH Beck, München 2021


