AM UFER DER ANDEREN SPRACHE
in der Übersetzung von Maralde Meyer-Minnemann

Seit mehr als drei Jahrzehnten findet Maralde Meyer-Minnemann überzeugende Wege, die Bücher von António Lobo Antunes ins Deutsche zu übertragen. Dabei mag es einer Odyssee gleichen, einen Autor von Weltrang zu übersetzen, der nahezu jährlich ein weiteres Werk nachlegt. Jedes Buch ein anderes Gestade, das mit neuen Herausforderungen aufwartet, geprägt von dem unbändigen Meer der antunianischen Sprache, das die nautischen Fähigkeiten der Kunst des Übersetzens stets aufs Neue schärft, da es nach Entscheidungen verlangt, insbesondere den eigenwilligen Sprachfluss des Originals in der anderen Sprache wiederzugeben.
Schon vor Jahren hatte der Autor seiner Übersetzerin, als sie mit ihm in Lissabon eine Liste von Nachfragen durchging, gesagt: »Mache es so, wie du es willst. Es ist dein Buch.« Irgendwie erinnerte mich das an die Sätze von Novalis: »Der wahre Übersetzer … muß in der That der Künstler selbst seyn … Er muß der Dichter des Dichters seyn«. Erschienen 1798 in der von den Gebrüdern Schlegel herausgegebenen Zeitschrift Athenaeum, hat diese Aussage an nichts eingebüßt; sie zu beherzigen, führt zu Texten, die sich in der Übersetzung lesen, als seien sie das Original.
Doch vor einem Blick auf die sprachlichen Besonderheiten sei zunächst der Inhalt der 2024 erschienenen Übersetzung angerissen, dessen portugiesische Originalausgabe unter dem Titel »A Outra Margem do Mar« bereits 2019 erschien. Den geschichtlichen Hintergrund bildet der Arbeiteraufstand in einer Baumwollplantage in der Baixa do Cassanje im Januar 1961, dem Beginn der angolanischen Bewegung zur Unabhängigkeit von der portugiesischen Kolonialmacht. Ein leidvoller und blutiger Weg. Lobo Antunes, der zehn Jahre später über 27 Monate als Militärarzt den Kolonialkrieg kurz vor der 1975 eingetretenen Unabhängigkeit Angolas miterlebte, lässt seine drei Hauptprotagonisten in inneren Monologen sprechen; die Tochter eines Plantagenbesitzers, einen Bezirksverwalter und einen hochrangigen Soldaten. Als Leser werden wir tief in die jeweils subjektiven und emotional aufgeladenen Geschichten der Romanfiguren geführt, die längst wieder in Portugal sind oder nach Namib, in die Wüste am Meer, verbannt wurden, von wo sie sich an ihre traumatischen Erlebnisse zurückerinnern. In dichten und sich teilweise überlagernden Bildern gelingt dem Autor nicht nur eine detailreiche Beschreibung der damaligen Geschehnisse, sondern zugleich ein Buch über das Erinnern selbst, dessen Facettierung bei den Figuren durchaus unterschiedlich ausfällt. »zurück bleibt meine Vergangenheit, die sich im Sand eingräbt, weshalb ich nicht weiß, ob ich ich sie finde oder erfinde« lässt der Autor etwa die Tochter des Plantagenbesitzers sagen (S.7), während der Bezirksverwalter betont »wie präzise die Erinnerung doch ist« (S.86) und der Offizier sich sagt »was für eine wundersame Truhe das Gehirn doch ist, was es verliert und was es verwahrt« (S.45), um wenige Zeilen später von der »Ordnung des Erinnerten auf dem Bord der Erinnerungen« zu sprechen. Die Zitate dürften eher als poetologische Statements des Psychiaters Lobo Antunes zu deuten sein, weniger als authentisch wirkende Äußerungen seiner Charaktere, die sämtlich geschundene und gebrochene Persönlichkeiten sind und deren Erinnerungen sich in einem nicht abreißen wollenden Strom einer oftmals erratischen Syntax ergießen, die der Autor hin und wieder bis zur Maniriertheit vorantreibt, wenn er etwa auf S. 92 schreibt »während die Bü, siebzehn Möwen, sche zu brennen begannen«. Die Textstelle ist insofern bezeichnend, da hier zwei Sinnbilder miteinander verzahnt werden, ja sich wortwörtlich ins Wort fallen: zum einen die »brennenden Büsche« in der fremd bleibenden afrikanischen Kolonie, zum anderen die vertrauten »siebzehn Möwen« am heimatlichen Kai beim Ablegen des Schiffes in Lissabon mit Kurs aufs »Land am Ende der Welt«.
Die Übersetzerin hält sich hier, wie auch sonst, streng an die Vorgaben des portugiesischen Textes, der selbst für einen muttersprachlichen Leser alles andere als einfach zu lesen ist, was nicht zuletzt an den endlos gereihten, den fragmentierten Bewusstseinsstrom ausdrückenden Sätzen liegt, die erst am Kapitelende ihren einzigen Punkt erhalten. Eine zentrale übersetzerische Herausforderung ist zweifelsfrei die sehr unterschiedliche Struktur beider Sprachen, vor allem mit Blick auf den Ausdruck bestimmter grammatischer Aspekte und Zeitstufen. So verlangt eine lesbare deutsche Prosa für jeden Satz nun mal ein Verb in einem bestimmten Tempus. Das Portugiesische hingegen verwendet gerne das der deutschen Sprache unbekannte Gerundium oder auch Partizipien, mit denen ganze Nebensätze ersetzt werden können. Als veranschaulichendes Beispiel hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem 19. Kapitel: »…ein Katechet mit offenem Bauch lag auf dem Boden, bat um nichts, sah uns nur an …« lautet die Übersetzung, in der dreimal das Imperfekt gebraucht wird, während das portugiesische Original keine Zeitstufe erkennen lässt (… um catequista de barriga aberta estendido no chão sem pedir ajuda, mirando-nos apenas …). Beim Übersetzen ist somit darauf zu achten, von welchem konjugierten Verb und Tempus solche Konstruktionen abhängen. Nicht selten, und gerade bei Lobo Antunes, stehen solche Verben weit entfernt von der in Frage stehenden Textpassage, oftmals auch getrennt durch Einschübe ganz anderer erzählender Personen und der immer wieder in den Text gestreuten wörtlichen Rede. Letztere wird immerhin durch einen Spiegelstrich angezeigt, so dass der Leser nicht ganz orientierungslos ist. Auch dienen der Orientierung, wie schon in früheren Romanen, den einzelnen Personen zugeordnete Sprachbilder, etwa die »siebzehn Möwen«, die im vorliegenden Buch stets in denjenigen Kapiteln wiederkehren, in denen der Bezirksverwalter spricht. Man könnte dieses Stilmittel in Anlehnung an den Begriff des ikonischen Gedächtnisses als ikonische Poesie bezeichnen, da diese markanten sprachlichen Bilder dem Leser unmittelbar einprägsam sind.
Die 21, streng geordneten Kapitel des Romans werden abwechselnd den drei Hauptprotagonisten zugeordnet. Mit einer Ausnahme, die das 19. Kapitel betrifft. Turnusgemäß müsste es Menina, der Tochter des Plantagenbesitzers vorbehalten sein; zu Wort kommt jedoch deren Amme Domingas in einem, wie soll man sagen, posthumen Monolog: »Ich begriff, dass ich gestorben war, und konnte deshalb weder sprechen noch mich bewegen, als ich mitten in der Nacht aufwachte, …« (S. 376). Dass nun wider Erwarten das oben genannte Möwenbild, mit dem bisher einzig die Kapitel des Bezirksverwalters markiert wurden, auftaucht, ist ungewöhnlich. Was will uns der Autor damit andeuten oder handelt es sich schlicht um einen Lektoratsfehler des portugiesischen Verlages? — Weder inhaltlich noch sprachlich wartet der Roman mit leichter Kost auf, ist er doch 50 Jahre nach der erlangten Unabhängigkeit Angolas auch ein literarisches Zeugnis der Verarbeitung jener unrühmlichen europäischen Kolonialgeschichte mit all ihren zum Teil bis heute spürbaren Wirrnissen. Dazu zählt auch der bewusst unübersetzt gebliebene Ausdruck »Preto«, jene in Portugal bis heute benutzte abfällige Bezeichnung für schwarze Afrikaner. Sprache ist und bleibt nun mal ein Politikum. Es bleibt spannend, in welche Welten uns die beiden letzten, in Deutschland noch nicht erschienenen Romane entführen werden, zumal Lobo Antunes inzwischen nicht mehr schreibt. Den vorletzten hat Maralde Meyer-Minnemann bereits übersetzt; das Manuskript liegt beim Verlag.
Letzte Änderung: 17.02.2025 | Erstellt am: 17.02.2025
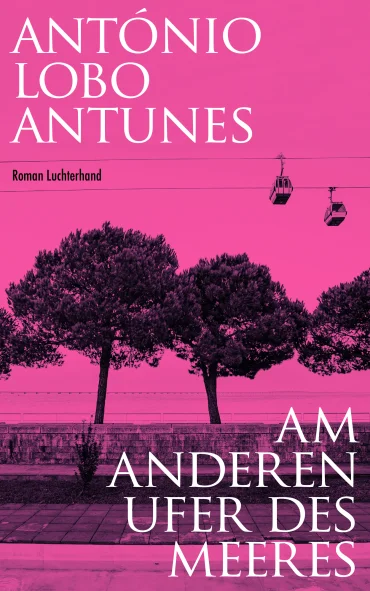
António Lobo Antunes »Am anderen Ufer des Meeres«
António Lobo Antunes, »Am anderen Ufer des Meeres«,
Roman, Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann
Luchterhand Literaturverlag, München 2024, 448 Seiten, 26,00 €, ISBN: 978-3-630-87735-8


