Weltschöpfungen: Manfred Peckls Kunst aus sprachwissenschaftlicher Perspektive

Manfred Peckls Kunst ist ein Spiel mit Sprache – doch mehr als das: ein performativer Akt, der neue Realitäten schafft. Caterina Draschan-Mitwalsky liefert keine klassische Analyse, sondern eine Einladung, Peckls Wort- und Bildwelten aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Mit einem interdisziplinären Blick auf Sprachwissenschaft, Kunst und Recht beleuchtet sie, wie Peckl Worte in Bewegung versetzt, Bedeutungen transformiert und den Betrachter einlädt, an dieser kreativen Schöpfung teilzuhaben. Ein Streifzug durch die Macht des Sprechens, die Kunst des Erschaffens – und die faszinierende Welt von Manfred Peckl.
Dieser Text ist zunächst einmal erklärungsbedürftig. Zu allererst: Dieser Text erhebt keinerlei Ansprüche – weder auf Vollständigkeit, noch auf Korrektheit. Er bezieht sich auf eine rein subjektive Auswahl von Peckls Werken, stellt keine Theorie dazu auf und will nicht erklären. Kurz gesagt: Dies ist kein wissenschaftlicher Artikel zu Manfred Peckls Kunst. Es ist lediglich ein Panorama von Gedanken, eine Einladung auf einen kurzen, transdisziplinären Ausflug in eine reiche Ideenwelt. Ich sage keineswegs, dass man Peckls Kunst von dem hier dargelegten Standpunkt betrachten muss – aber man kann, und das sollte fürs Erste genügen.
Wie komme ich eigentlich dazu, über Manfred Peckl zu schreiben? Ein Mann, den ich kaum kenne, dessen Kunst ich nur auf Fotos und Social Media gesehen habe? Gleichzeitig ein guter Freund meines Mannes, ein Mann von dem ich viel gehört habe, viel Begeistertes und Begeisterndes. Ich habe also, im wahrsten Sinn des Wortes, in diesen Artikel hineingeheiratet. Und da ist mir aufgefallen, dass Manfred Peckls Kunst und meine Eheschließung einiges gemeinsam haben; und auch einiges mit den Fachgebieten, die mich – als Juristin und Sprachwissenschaftlerin sozusagen offiziell und von Berufs wegen – zu interessieren haben.
Der Akt der Eheschließung ist nämlich sowohl juristisch als auch sprachwissenschaftlich interessant. „Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau“, sagt der Standesbeamte, die Standesbeamtin, am Ende der Zeremonie. Und stellt damit nicht bloß eine Tatsache fest – nein, durch das Aussprechen dieses Satzes schafft er, schafft sie, gerade diese neue Tatsache. In der Sprachwissenschaft nennen wir solche Sprechakte – also jene, die durch das bloße Aussprechen einer Tatsache diese quasi aus sich selbst gebären, durch die gerade in diesem Moment gesprochenen Worte neue Realitäten schaffen – performative Sprechakte.
Um Missverständnisse gleich von vornherein zu vermeiden: Dies hat nichts mit der vielbemühten Sapir-Whorf-Hypothese zu tun, der zufolge Sprache Realität schafft, indem sie unsere Denkmuster und dadurch unsere Wahrnehmung, also unsere Vorstellung von dem, was real ist, prägt. Dies ist ein Argument, das spätestens seit der Gender-Debatte (die keine Debatte, sondern eine Selbstverständlichkeit sein sollte, worauf ich hier aber nicht eingehen möchte) allgemeine Bekanntheit erlangt hat, auch wenn es mancherorts noch unberechtigte Skepsis hervorruft. Es ist dies aber eine Diskussion, die ich hier nicht weiter verfolgen möchte.
Die erste umfassende Darstellung, wie und unter welchen Voraussetzungen ein Sprechakt die Macht hat, außersprachliche Fakten zu schaffen, stammt von J.L. Austin, welcher im Jahr 1962 sein bahnbrechendes Werk How To Do Things With Words veröffentlichte. In diesem Buch stellt Austin wichtige Charakteristika performativer Sprechakte dar und unterteilt diese gleichzeitig in zwei Typen: explizite und implizite performative Sprechakte. Dies bedeutet, dass es einerseits performative Sprechakte gibt, welche den Akt des Sprechens nochmals, sozusagen auf metalinguistischer Ebene, thematisieren: „Ich verspreche dir…“, „Ich erkläre hiermit…“, „Ich befehle dir…“. Bei anderen performativen Sprechakten bleibt dies implizit, ohne dass die Aussage dadurch verändert wird: „Ich befehle dir, zu gehen!“ und „Geh!“ sind Sprechakte gleicher Bedeutung; sie unterscheiden sich lediglich durch ihre Form. Während ersterer den Akt des Sprechens nochmals verbalisiert, kommt zweiterer mit ökonomischeren Mitteln aus. Die Erteilung des Befehls auf inhaltlicher Ebene geht einher mit der Performance des Befehlens mit sprachlichen Mitteln, eine explizite Verbalisierung erübrigt sich. Wirkung und Wirkungserfordernisse sind, wie wir sehen werden, bei beiden Formen des performativen Sprechakts jedoch dieselben.
Das Gegenstück zum performativen Sprechakt ist bei Austin der konstative, d.h. jener Sprechakt, welcher die Realität beschreibt, ohne sie zu formen: „Heute scheint die Sonne.“; „Wasser kocht bei 100 Grad.“; „Ich bin müde.“ Diese Sprechakte können Einblicke in subjektive Wahrnehmungen der Realität geben, können diese aber nicht weiter gestalten – sie konstatieren Fakten, ohne Fakten zu schaffen. Bei performativen Sprechakten geht es hingegen darum, dass Sprache die Fähigkeit hat, aus sich selbst heraus außersprachliche Realitäten zu generieren: Dadurch, dass ich etwas ausspreche, mache ich es zur Tatsache. Das funktioniert natürlich nicht immer: Auch wenn ich mit großer Überzeugung bei Regen behaupte, dass gerade die Sonne scheint, werde ich diesen Zustand nicht hervorrufen. Genauso wenig kann ich mich selbst per Deklaration zum Staatsoberhaupt Deutschlands oder zur Ehefrau Taylor Swifts machen; auch werde ich wenig Erfolg haben, wenn ich versuche, dem Verkehrspolizisten oder meiner Chefin Befehle zu erteilen.
Daraus folgen nun zwei Dinge: Zur Vermeidung von Unklarheiten und Missverständnissen ist die Gültigkeit von performativen Sprechakten zumeist an eine Reihe von Formalerfordernissen geknüpft. Dies ist umso wichtiger, als die Realitäten, welche auf Sprechakten fußen, zumeist nicht unmittelbar der empirischen Überprüfung zugänglich sind: ob zwei Leute verheiratet sind oder ob ich meiner Nachbarin ein Versprechen gegeben habe, lässt sich nicht mithilfe naturwissenschaftlicher Analysemethoden feststellen. Während der konstative Sprechakt wahr oder falsch sein kann, kann der performative Sprechakt lediglich erfolgreich oder erfolglos sein – oder, um es in Austins Terminologie zu sagen, „happy“ oder „infelicitous“. Der performative Sprechakt verändert zwar die Realität, aber üblicherweise nicht in einem naturwissenschaftlich messbaren Sinn. Lediglich allfällige Beweismittel des Sprechaktes – die Heiratsurkunde, der Notizzettel, auf dem das Versprechen notiert wurde, die Tonaufnahme der Zeremonie oder des Gesprächs mit der Nachbarin schlagen hier die Brücke zur empirisch fassbaren Welt; sie sind aber bloße Dokumentationsstücke des Erschaffungsaktes, nicht Relikte der Erschaffung an sich.
Was der konkreten Überprüfung durch naturwissenschaftliche Beobachtung oder Messung zugänglich ist, existiert in einer durch Sprache nicht unmittelbar veränderbaren Sphäre: Ein performativer Sprechakt funktioniert daher nur, wenn er nicht schon zuvor einem empirischen Wahrheitsbeweis zugänglich ist. Zum Zwecke der vereinfachten Darstellung wollen wir hier außer Acht lassen, dass die Frage, was empirisch feststellbar ist, eine historisch und kulturell kontingente ist. Stellen wir uns stattdessen folgenden simplen und, wie ich hoffe, einigermaßen unstrittigen Sachverhalt vor: Ich überreiche meiner Frau eine Rose und sage dazu: „Ich erkläre diese Rose hiermit zu einem Diamantring.“ Wohlgemerkt: wir sprechen hier nicht von Gaslighting. Nehmen wir – nur der Argumentation wegen – an, dass meine Absichten lauter sind und ich tatsächlich in der Überzeugung handle, die Rose durch meine Worte in einen Diamantring zu verwandeln: es funktioniert nicht. Die Rose existiert in einer der Sprache nicht zugänglichen Sphäre; meine Äußerung muss sich den Vergleich zwischen Wortlaut und Wahrnehmung der Adressatin gefallen lassen und wird dem Wahrheitsbeweis nicht standhalten. Mein Versuch eines performativen Sprechaktes geht somit ins Leere, weil sich die Ebene der Dinge nicht mit rein sprachlichen Mitteln gestalten lässt.
Wohl aber kann ich durch einen performativen Sprechakt einem Gegenstand eine weitere, abstrakte Bedeutung verleihen. Stellen wir uns vor, dass ich dieselbe Rose mit den Worten „Hiermit erkläre ich diese Rose zu einem Ausdruck meiner Liebe“ überreiche. Empirisch gesehen hat sich an der Rose nichts verändert; durch meinen Sprechakt habe ich ihr aber eine weitere Bedeutung zugewiesen, die parallel zur dinglichen besteht und einem Wahrheitsbeweis nicht zugänglich ist.
Performative Sprechakte dieses Typus sind keineswegs auf das Privat-Zwischenmenschliche beschränkt. Ein bekanntes Beispiel ist etwa die Handlung des katholischen Priesters, der im Zuge der Wandlung die Hostie hochhält und mit seinen Worten eine Oblate in den Leib Christi verwandelt. An den chemisch und physikalisch feststellbaren Attributen der Oblate selbst ändert sich dadurch rein gar nichts; für die Gläubigen hat sie allerdings nun eine weitere, den empirisch messbaren Tatsachen quasi übergestülpte, Realität angenommen.
Dieses Beispiel zeigt wiederum, dass die gestalterische Wirkmacht performativer Sprechakte stets davon abhängt, ob die Adressatinnen und Adressaten dem oder der Sprechenden die Autorität zugestehen, auf diese Weise Realität zu erschaffen. Wie umfassend diese Autorität sein muss, richtet sich nach der Natur des Sprechakts. Sage ich etwa: „Ich verspreche dir“, so erschaffe ich damit eine neue, real existierende Entität: ein Versprechen. Damit es entsteht, reicht es völlig, dass der Adressat, die Adressatin meiner Worte mir die Autorität zugesteht, ein solches Versprechen zu geben. Die Auffassung Dritter ist hier irrelevant: sofern sie von meinem Versprechen nicht betroffen sind, hat ihre Einstellung meinen Worten gegenüber keinerlei Relevanz.
Anders verhält es sich freilich mit Sprechakten, welche Realitäten schaffen, die auch von Außenstehenden zu respektieren sind. Deren Macht, neue Wirklichkeiten ins Dasein zu rufen, beruht gemeinhin auf einer gesellschaftlichen Übereinkunft, dem oder der Sprechenden die notwendige Autorität zuzugestehen. Besonders deutlich wird dies, wenn wir Sprechakte betrachten, die – sozusagen als konzeptuelles Gegenstück zu den oben beschriebenen rein privaten performativen Sprechakten – Konsequenzen nach sich ziehen, welche von allen öffentlichen und privaten Stellen zu respektieren sind. Dazu gehört etwa das oben angeführte Beispiel der Eheschließung: wiewohl es sich hier natürlich um eine Angelegenheit handelt, welche zuvorderst die beiden Eheleute betrifft, so liegt der Sinn der Sache im Allgemeinen doch darin, eine von allen Mitgliedern der Rechtsgemeinschaft zu respektierende neue Tatsache zu schaffen. Der performative Sprechakt wirkt hier auch über den unmittelbaren Kreis der Zuhörenden hinaus. Zum Adressatenkreis gehören all jene, welche die neu geschaffene Realität aufgrund gesellschaftlicher Übereinkünfte zu respektieren haben. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Sprechakt sozusagen sichtbar und transportabel zu machen, ist man schon vor Jahrtausenden dazu übergegangen, performative Sprechakte zu verschriftlichen: Die Standesbeamtin sagt nicht nur, dass sie das Paar zu Mann und Frau erklärt, sie gibt ihnen zum Zwecke der allgemeinen Beweisführung auch eine Heiratsurkunde mit, welche sowohl den Sprechakt als auch die Autorität der sprechenden Person bezeugt. Wohlgemerkt: Die Ehe existiert auch ohne den Zettel; dieser dient lediglich der einfacheren Glaubhaftmachung gegenüber denjenigen, die die Worte der Beamtin nicht gehört haben.
Mitunter kann es vorkommen, dass das Gegenüber einem performativen Sprechakt seine Wirkung versagt: Wenn mir die Adressatin nicht glaubt, ist mein Versprechen wertlos, der performative Sprechakt missglückt. Die Transformation der Hostie findet nur für diejenigen statt, die dem Priester diese mythische Macht zugestehen. Selbst staatliche Akte sind nicht universell, sondern von der – mehr oder weniger freiwilligen – Anerkennung staatlicher Macht abhängig, die etwa über die Landesgrenzen hinaus nicht zwangsweise gegeben ist. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass ein performativer Sprechakt eines Staates – wie etwa eine Eheschließung – in einem anderen Staat nicht anerkannt wird.
Und hier zeigt sich nun, dass Künstlerinnen und Künstler eine ungewöhnlich privilegierte Stellung einnehmen: Während dem Priester nur diejenigen wirklichkeitsgestalterische Autorität zugestehen müssen, die zum Kreis der Gläubigen seiner Religion gehören, und dem staatlichen Beamten nur die Staatsangehörigen, so herrscht weitreichender, transkultureller gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Künstler und Künstlerinnen das Recht haben, zu erschaffen. Man kann das Geschaffene gut oder schlecht finden; man kann aber nicht dessen Existenz schlechthin in Abrede stellen. Was für materielle Werke unmittelbar einleuchtet, trifft auch auf Ephemerales, wie eben den performativen Sprechakt, zu: Künstler und Künstlerinnen erschaffen, mit ihnen völlig freigestellten Mitteln, neue Realitäten. Manfred Peckls Verdienst liegt nun darin, die Sprache als Medium der bildenden Kunst – nicht der Dichtung oder Schriftstellerei – für sich entdeckt zu haben.
Der Unterschied zwischen dem banalen performativen Sprechakt unserer Alltagswelt und jenem Manfred Peckls ist, dass ersterer eine Realität schafft, welche in ihrer individuellen Ausprägung zwar neu, in ihrer allgemeinen Bedeutung aber bereits bekannt ist. Indem die Standesbeamtin ein Paar zu Eheleuten erklärt, schafft sie für diese beiden etwas Neues, nicht aber ein neues gesellschaftliches Konzept. Dies ist ein Charakteristikum des performativen Sprechakts, aber, wie Peckl zeigt, keine Notwendigkeit: Die Wirkung des performativen Sprechakts ergibt sich aus seiner Fähigkeit, neue Fakten zu schaffen. Dass diese Fakten im normativen Bereich begrenzt sind, ergibt sich nicht aus der Natur des Sprechaktes, sondern aus den Rahmenbedingungen, in welche unsere Gesellschaft ihn eingebettet hat, das heißt aus der Begrenztheit von gesellschaftlicher Konvention und geltendem Recht, an die sich die Beamtin zu halten hat. Die Kunst hingegen hat die Macht, weit über das normative Vorgegebene hinauszugehen und das volle Potential des performativen Sprechakts auszuschöpfen.

Dazu gehört, dass Manfred Peckl ein weit größeres Repertoire an performativen Sprechakten hat, als es staatliche oder kultische Akteure gemeinhin haben: Während die Befugnis des Priesters oder der Beamtin auf wenige, klar definierte Akte begrenzt ist, ist jene des Künstlers oder der Künstlerin, sozusagen Kraft ihres Amtes, unendlich. Dazu gehört auch, dass sich Peckl für seine Schaffensakte jedes beliebigen Wortes bedienen kann.
Die Differenzierung zwischen existierenden und nicht existierenden Wörtern macht keinen Sinn, daher trifft Manfred Peckl sie folgerichtig auch nicht. Ein Wort existiert, sobald es ausgesprochen wird, auch wenn es bisher noch niemals gesprochen wurde. Es wäre unsinnig zu behaupten, dass der Satz „Morp can free“ nicht existiert oder keine Bedeutung hat. Zutreffend ist vielleicht, dass das Publikum (noch) nicht weiß, was der Satz bedeutet. Aber ebenso wenig, wie ein performativer Sprechakt einem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, ist es die Existenz der von Peckl gebrauchten Worte.
Ein neues Wort braucht nicht die Legitimation durch die Erwähnung im Wörterbuch; noch weniger braucht es die Legitimation dadurch, dass es sich auf eine präexistierende Realität bezieht; die Legitimation eines Wortes ergibt sich allein dadurch, dass es ausgesprochen wird und damit – das bezeichnete Konzept quasi aus sich selbsthervorbringend – nun einfach in der Welt existiert. Die Erschaffung neuer Wörter ist somit der performative Sprechakt par excellence: Durch das Aussprechen des Wortes wird im gleichen Augenblick das Wort selbst und die dadurch bezeichnete Realität geschaffen. Der performative Sprechakt wird somit zum konstitutiven Sprechakt, dessen konstitutives Merkmal die Performanz ist.
Manfred Peckls Kunst ist damit das genaue Gegenteil einer idiosynkratischen, subjektiven Kunst; es ist ein in hohem Maße intersubjektiver und intersubjektivierbarer Vorgang. Indem er das Publikum mit noch unbekannten Wörtern konfrontiert, gibt Manfred Peckl ihm die Möglichkeit der Teilhabe an einer Welt, in welcher diese Konzepte bereits existieren; macht eine Tür auf, schlägt eine Brücke zwischen der allgemein bekannten Realität und jenen Bereichen, die sonst nur ihm zugänglich wären.
Manfred Peckl ist in dieser Hinsicht wie Shakespeare, der, um den Zuschauer an seiner Geisteswelt teilhaben zu lassen, ihn immer wieder mit neuen Wortschöpfungen konfrontieren musste, und somit auch die dazugehörigen Konzepte schuf. Dass uns diese Wörter und Konzepte nun selbstverständlich vorkommen, liegt an der Länge der Zeit, welche Vertrautheit gebracht hat und seinen Schöpfungen den Nimbus des Selbstverständlichen verliehen hat. Was vorher war, ist im Nebel des Vergessens verschwunden. Keine Frau trug etwa ein Nachthemd, bevor Shakespeare das Wort nightgown das erste Mal auf die Bühne brachte; kein berühmter Mann war illustrious ; seine Stücke waren weder obscene noch fashionable – all diese Worte, und die damit mental verknüpften Konzepte, gab es zuvor noch nicht. Doch was Frauen davor trugen, was berühmte Männer oder bekannte Theaterstücke sonst waren, das wissen wir längst nicht mehr. Genauso wenig wusste aber wohl das Publikum Shakespeares, was es mit den erwähnten Ausdrücken – und rund 1700 weiteren – prima facie anzufangen hatte. Und dennoch nahm es Shakespeares Einladung der Teilhabe an seiner Welt enthusiastisch an. Dieselbe Einladung spricht (pun intended!) Manfred Peckl seinem Publikum aus.
Wenn diese Argumentation einen Beweisgegenstand hat, ja überhaupt haben muss, so ist dieser zum einen, dass Manfred Peckls Welt größer und bunter ist als die des durchschnittlichen Betrachters. Zum zweiten ergibt sich aus dem Gesagten aber auch die geradezu notwendige Performativität von Manfred Peckls Kunst. Nicht nur das Erschaffen seiner Realität, sondern vielmehr die Eröffnung derselben für den Betrachter erzwingt die Performance; nur durch das weithin Wahrnehmbare Aussprechen seiner Wortkreationen ergibt sich überhaupt die Möglichkeit der Teilhabe an dem von ihm neu Entdeckten. So wie Shakespeare die neu ausgesprochenen Konzepte performativ auf der Bühne dem Publikum zugänglich machen musste, so muss es auch Manfred Peckl. Das von Peckl Geschaffene wird dadurch um nichts realer – Morp existiert auch, wenn Peckl das Wort allein im Atelier ausspricht, aber erst durch die Performance wird eine intersubjektiv erfahrbare Realität geschaffen. So wie ein Nachthemd bereits in dem Moment zu existieren begann, in dem Shakespeare das Gewand zum ersten Mal ansah und mental das dazugehörige Wort formulierte, so verhält es sich mit Morp. Doch beiden Künstlern ist daran gelegen, diese einsame, individuelle Erfahrung mit anderen zu teilen.
Selbst wenn Peckl nicht live dabei ist, ist seine Kunst immer Performance – ein weit über die konventionelle Verschriftlichung hinausgehender sichtbarer Sprechakt, der vom Betrachter erlebt werden will. In beiden Fällen bringt Peckl Wörter in Bewegung, um diese Bewegung dann wieder statisch einzufangen und so für den Betrachter erfahrbar zu machen. Paradebeispiele hierfür sind Manfred Peckls Wort-Skulpturen und -Bilder. Manfred Peckls Umgang mit bereits bekannten Wörtern knüpft somit nahtlos und völlig konsequent an seine Neologismen an. In jedem Fall entsteht dadurch, dass Peckl ein Wort in den Raum stellt, neue Realität, mit der sich das Publikum auseinandersetzen kann, darf, muss.

Besonders interessant erscheint mir hier Peckls Skulptur Earth (2019). Je nachdem, wo man zu lesen beginnt, offenbart sich aus ihr nicht nur das Wort „heart“, sondern auch „the art“ und die Aufforderung „hear“. Und auch hier schafft Peckl durch das In-den-Raum-Stellen dieses Wortes eine neue Realität: einen Ort in der Mitte des Buchstabenkreises, welcher gleichzeitig Mittelpunkt – Herz – der Erde und der Kunst ist. Bezeichnend für die Vielschichtigkeit von Peckls Sprachkunst ist die Aufforderung, welche die Skulptur an das Publikum richtet: „hear!“ – gleichzeitig Einladung, sich auf Peckls Werk einzulassen und Erinnerung daran, dass dies mit mehr als nur dem üblicherweise der Sprache zugeordneten Sinn zu geschehen hat. So, wie das Wort „hear“ das Buchstabenangebot von Earth nur unvollständig in sich aufzunehmen vermag, verlangt es die Skulptur auch dem Publikum ab, Sprache als multisensorisches Erlebnis auf sich wirken zu lassen.
Peckl hat sich quasi selbst in die Skulptur eingeschrieben, spielt mit den Buchstaben – HEART –, die er auf den Oberkörper tätowiert hat. einen Raum, der zugleich die Mitte seiner persönlichen Welt – „the art“ – ist und der Mittelpunkt der Welt – „earth“ –, die er mit dem Betrachter teilt; gleichzeitig auch ein Bühnenraum, der es ihm erlaubt, physisch Teil des Kunstwerks zu werden. Nicht von ungefähr bilden die Buchstaben von Earth, nur marginal um Duplikate ergänzt, auch das Wort „theatre“.

Dieses Sich-Einschreiben ist keineswegs ein Spezifikum von Earth ist, dass es immer wieder vorkommt, dass Peckls Wortskulpturen nicht nur Kunstobjekte sind, sondern gleichzeitig im Wortsinne Stand–Punkte für den Künstler schaffen, die er als Ankerpunkt für seine Performances nutzt. Erst durch die Projektion, hier also visuelle Performance der Buchstabenfolge, schafft Peckl genau den Punkt, auf den das Publikum die Augen zu richten hat: der sichtbar gewordene Sprechakt erschafft eine neue Tatsachen, erhebt einen Punkt des ansonsten undifferenzierten Betonfußbodens zum Ort des Geschehens, ist zugleich Aufforderung und Schöpfungsakt.
Der performative Sprechakt des In-den-Raum-Stellens schafft somit einen realen Zugang zu Peckls Welt, von dem aus er diese dem Publikum weiter eröffnen kann: die Skulptur wird zum Portal. Wie fließend die Übergänge sind, zeigt Peckl immer wieder, indem er mühelos teil eines Werkes wird.


Auch der Rollenwechsel zwischen Künstler und Kunstfigur gelingt durch einen einzigen Sprechakt: Durch die Buchstabenfolge anger macht Manfred Peckl sich zum Anger Ranger. Der als Krone getragene visualisierte Sprechakt wird zum sichtbaren Symbol seiner Macht über die Worte, die Welten erschaffen: nicht umsonst ist die Waffe des Anger Ranger ein Stab, an dessen Spitze words zu sword (per)mutiert. Der noch in bekannten Begriffen fassbare Name der Figur verankert dessen Neologismen in der Welt des Publikums, bildet den sichtbaren Brückenschlag in die Welt, die er durch seine Sprechakte erschafft.

Auch in zwei Dimensionen bringt Manfred Peckl Wörter in Bewegung, um dem Publikum neue Welten zu Auch in zwei Dimensionen bringt Manfred Peckl Wörter in Bewegung, um dem Publikum neue Welten zu eröffnen. Grundlegendes Merkmal ist auch hier das Aufbrechen des Dualismus signifier-signified, der klaren Abgrenzung zwischen dem Wort an sich (signifier) um dem realen, in der Welt existierenden Konzept, welches es bezeichnet (signified). Stattdessen wird das Wort selbst zum Protagonisten von Peckls Inszenierung, dreht sich um sich selbst und schafft so einen neuen Gegenstand, welcher mit der ursprünglichen Bedeutung dennoch in Zusammenhang steht. Es zeigt sich darin eine Peckls Werken eigene Faszination für Analyse und Synthese, das Auseinandernehmen und neu Zusammenfügen von Dingen, wodurch das schon im ursprünglichen Ding verborgene zum Vorschein kommt. Diese ist im Übrigen auch seinen nicht primär sprachorientierten Werken eigen – so etwa seinem Meteoriten aus Stücken von Sternkarten, seinen Landschaften aus Streifen von Atlanten. Auch hier: das Konkretisieren des Abstrakten zum greifbaren, erfahrbaren Detail. eröffnen. Grundlegendes Merkmal ist auch hier das Aufbrechen des Dualismus signifier-signified, der klaren Abgrenzung zwischen dem Wort an sich (signifier) um dem realen, in der Welt existierenden Konzept, welches es bezeichnet (signified). Stattdessen wird das Wort selbst zum Protagonisten von Peckls Inszenierung, dreht sich um sich selbst und schafft so einen neuen Gegenstand, welcher mit der ursprünglichen Bedeutung dennoch in Zusammenhang steht. Es zeigt sich darin eine Peckls Werken eigene Faszination für Analyse und Synthese, das Auseinandernehmen und neu Zusammenfügen von Dingen, wodurch das schon im ursprünglichen Ding verborgene zum Vorschein kommt. Diese ist im Übrigen auch seinen nicht primär sprachorientierten Werken eigen – so etwa seinem Meteoriten aus Stücken von Sternkarten, seinen Landschaften aus Streifen von Atlanten. Auch hier: das Konkretisieren des Abstrakten zum greifbaren, erfahrbaren Detail.



Und auch in seinen Wortbildern spielt Peckl mit dieser Gegenüberstellung und Verschmelzung von abstrakter Wortform und konkreter Wortbedeutung. Die festgeschriebene Performance der wirbelnden Buchstaben hält der Realität die Erscheinungsform des Wortes als Spiegel vor, findet Spiegelungen der Realität in der Erscheinungsform des Wortes, macht die Realität zur Metapher dieser Erscheinungsform.
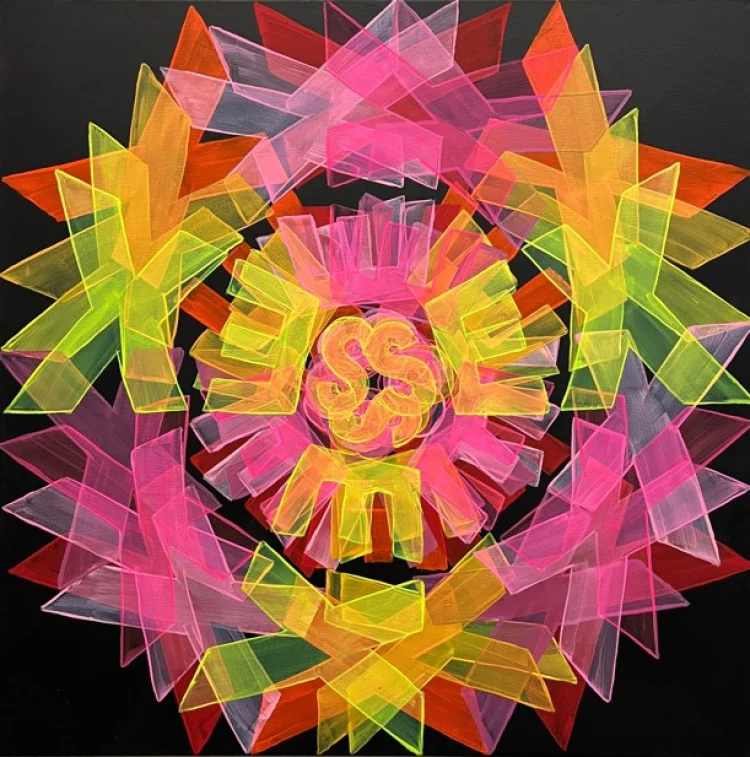
Deutlich wird dies in Peckls Social Media-Kommentaren, die er gleichsam als neue Kunstgattung und Ergänzung seiner Werke diesen hinzufügt. Diese sind Erklärung, aber auch Einziehen einer neuen Meta-Ebene. Sie schaffen einen neuen Standpunkt für den Betrachter zwischen zwei sprachlichen und konzeptuellen Ebenen, zwischen der Realität des Bildes und jener außerhalb, von der aus der Betrachter, die Betrachterin sich aufmachen muss, Peckls Welt zu erkunden. Wie in den Bildern und Skulpturen entsteht auch hier durch Worte ein neuer Raum, der als Brücke in Peckls Ideenwelt dient: „Have a look at my #PORN #picture, #acrylic on #canvas 1 × 1 m. The #colors are slightly different in the #original #painting. The blue parts are greener, a little colder, too. Generally it is less contrasted which increases the impression of speed and thereby refers to #film . I’m giving this information in case you wanted to know more about PORN.”
Wer mehr über Pornografie wissen möchte, erfährt hier mit einem Augenzwinkern mehr über die Farbgebung des Bildes, bevor Peckl wieder die Brücke zur extradiegetischen Realität des Pornofilms schlägt. Ebenso ist Peckls Vergleich zwischen Sex und Porn, prima facie als Beschreibung seiner Werke kodiert, eine verspielt-ironische Bemerkung über die Konzepte, auf die sich die Worte beziehen.
„What you always wanted to know about the difference between #SEX 80 × 80 cm and #PORN 100 × 100 cm. It is not just size and #color. SEX with its three letters has three rays, PORN with four letters has four #rays and becomes a #cross #shape. In addition, the perceived image #energy is different, as PORN seems to revolve around itself. SEX, on the other hand, pulsates more. Both #paintings #acrylic on #canvas 2024.“
Intersubjektivität, verpackt in verspielt-ironische Doppelbödigkeit, wird zum Programm: Werk und Begleittext brechen die Schranke zwischen dem durch das Wort bezeichnete Konzept und dem Bild auf: der Text nimmt den Betrachter an der Hand und erlaubt ihn, gemeinsam mit Peckl mühelose zwischen den Welten zu hüpfen.
Gleichzeitig erahnt man in diesen Texten aber auch einen schmunzelnden Hegemonialanspruch: Die Erklärungshoheit über Peckls Welt hat immer und allein Manfred Peckl. Und das ist gut so. Deshalb beeile ich mich auch abschließend zu betonen, dass mir nichts ferner liegt, als eine Erklärung von Manfred Peckls Kunst zu versuchen. Dieser Text ist nichts als eine interdisziplinäre Mauerschau auf einen kleinen, subjektiv gewählten Ausschnitt von Manfred Peckls Werk; eine Einladung zur Erkundung seiner Welt. Was Peckl mit Worten tut, lässt sich nicht in Worte fassen. Statt eines abschließenden Fazits setze ich diesem Text daher einen letzten performativen Sprechakt ans Ende, zugleich Einladung und Befehl: Schauen Sie sich das an!
Letzte Änderung: 26.03.2025 | Erstellt am: 26.03.2025
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


