
Joana Mallwitz und das Konzerthausorchester Berlin mit Luigi Nonos »Come una ola de fuerza y luz« und Gustav Mahlers Vierter Sinfonie
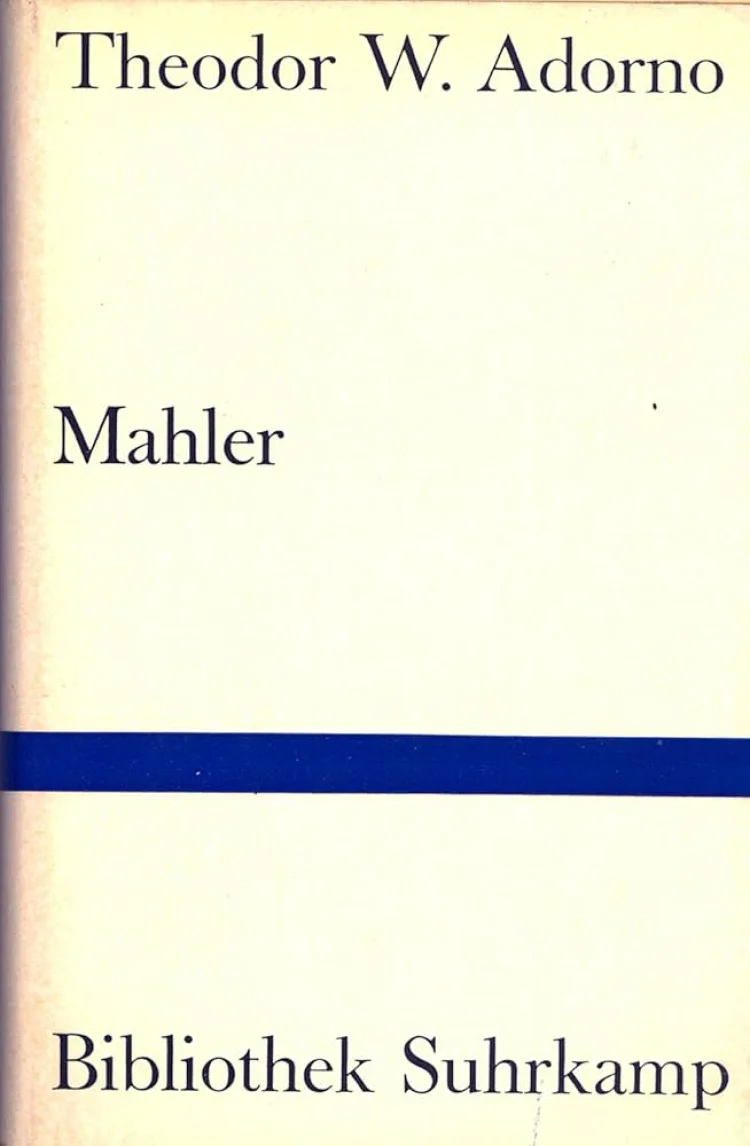
Vielleicht hätte – die in der Tat grandiose – Joana Mallwitz noch ein kleines bißchen mutiger sein, zwischen Nonos großer Totenklage und Mahlers Sinfonie vom himmlischen Leben die Pause streichen und zwischen beiden Stücken nicht einmal Applaus zulassen sollen. Dann hätte Mahlers vierte Sinfonie nicht ganz so unrecht klein gewirkt, weil wie zart aus einer längst vergangenen Welt. Von untergegangenen Welten erzählen nämlich beide – bei Nonos nach wie vor hinreißendem »Come una ola de fuerza y luz« fällt es wegen des Einsatzes elektronischer Klänge nur nicht so auf, kommt es uns nah immerhin noch vor. Doch wer derart ungebrochen der kommunistischen Revolution sinfonische Musiken schreibt, ist nach heutigem Wissen nicht weniger naiv gewesen, als es Mahlers ja nur vermeintliche Ländler- und Paradiesgartl-Seligkeit ist. Er ist sogar naiver. Denn Mahler zerhackt seine Ländler. Nur dass sie eben für unsere Ohren sowieso schon keine Gegenwärtigkeit mehr haben – so wenig, dass vor allem junge Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr erspüren können, es sich allenfalls intellektuell erschließen, was der große Komponist da vor Augen, zumindest aber als Ahnung gehabt. Schon meiner eigenen, akustisch von Beat und Rock `n Roll geprägten Generation fiel das nicht mehr leicht; die meisten von uns brauchten, um zu verstehen, Adorno.
Ein hörpädagogisch noch so fein zusammengestelltes Programmheft kann das nicht leisten – aber der Verzicht auf eine Pause hätte es können, sinnlich nämlich können. Wenn Mahler in der Partitur z.B. »anmuthig« vermerkt (er tut es mehrfach), hören wir Heutigen nicht Anmut, sondern Zöpfe.
So war an diesem Sonnabendabend das Herzens- und Bravourstück tatsächlich der Nono, und Mahler fiel dagegen ab – auch aber musikalisch -an-sich, insofern das Konzerthausorchester Berlin unterdessen zwar ein Klangkörper der fast schon ersten Reihe ist, der allerersten aber lang noch nicht. Und ich schreibe sowas, der sich gerade diesem Orchester, wenn auch noch aus Zagroseks Zeiten, eng verbunden fühlt, ich war mit ihm sogar mal auf Spanientournee; die Berliner Philharmoniker haben mich nie auch nur entfernt so interessiert. Doch den Violinen fehlt noch Kraft, vor allem aber jene Seide, die einem Sirren den Schmelz unmittelbarer Ergriffenheit verleiht – ich meine etwa das sehr, sehr langgezogene fis knapp nach Anfang des dritten Satzes:

Wiederum sind im Horn bisweilen Treffunsicherheiten zu vernehmen. Und wenn die Klarinette grob klingt – klingen so soll – , dann nicht auf eine Weise, die dieses Sollen unterschlägt. Wir dürfen uns die Frage gar nicht erst stellen, ob ein Instrument auch anders gespiel werden könne. Erst dann können wir über die Frechheit dieser kompositorischen Volte lachen, so dass wir uns beherrschen müssen, es nicht sehr laut zu tun. Wir wollen ja nicht stören.
Zweidreimal passierte es mir. Denn Mallwitz ist hinreißend darin, Mahlers Konzepte – fast alle sind sie subversiv – lustvoll umzusetzen. Die ganze Frau ist nur Musik, möchte ich fast schreiben; anderswo schrieb ich von »Mallwitzzauber«. Wenn Mahler vermerkt »etwas zögernd«, arbeitet sie sogar das »etwas« heraus und bekommt es obendrein hin, die Geiger, wenn sie beginnen, achtelsekündige Glissandi spielen zu lassen, was unsere Ohren als leisen Riß vernehmen. Auch → Barbirolli konnte das.
Genau mit solchen Irritationen läßt der Komponist all seine praternden Walzerseligkeiten aufs unheimlichste brüchig werden. Da bereits klingt das Konzerthausorchester enorm, »fertig« aber ist es noch nicht. Wie ich → vor einem Jahr schon schrieb, steht Mallwitz vor genau der Aufgabe, vor der Anfang der Neunziger Barenboim stand, als er die Staatskapelle übernahm. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie sie zu lösen vermag, doch gänzlich mit anderen Mitteln: Zum Mallwitzzauber gehört, dass diese Frau nicht nur das Publikum rundweg betört; sie schafft’s bei ihren Musikerinnen und Musikern auch. Man kann’s schon am Dirigierstil erkennen: Ich hab den Impuls, ihn ›zärtlich‹ zu nennen. Schon deshalb hatte ich über sie mal ein ganzes Portrait schreiben wollen – doch Abstand genommen davon, als derart viele andre es taten. Ich mochte beim »Hypen« nicht Schlange stehen; das Konzerthaus selbst ist unterdessen mit Mallwitzfotos fast schon tapeziert. Da ward’s mir einfach zuviel Pop. – Egal, nun ›darf‹ ich ja mal wieder. Und wurde mit einem Sitzplatz belohnt, dass ich es gar nicht fassen konnte, also hier sitzen zu dürfen.
Nur half es drüber nicht hinweg, dass der für Nono geradezu perfekte Sopran Sarah Aristidous an Mahler scheitern mußte. Denn ihrer ist der eines glühenden, darf ich das noch schreiben?: Vollweibs? Von Mädchen, gar »Reinheit« Göttinseidank nicht die Spur. Wenn Mahler aber über den letzten Satz der Sinfonie, ein Orchesterlied imgrunde, »sehr behaglich« schreibt, dann meint er es auch so. Nur wollen zur Behaglichkeit die vertonten Verse nicht recht passen:
Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes d’rauf passet.
Wir führen ein geduldig’s,
Unschuldig’s, geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn’ einig’s Bedenken und Achten.
Frau muß also sehr naiv sein, um sowas zum Himmlischen Leben zu rechnen. Kurz, die Stimme braucht die allerreinste Unschuld – so, wie etwa, wenn auch ein wenig keck, Christine Whittlesey 1988 bei Gielen oder vorher bei Solti, 1961, Sylvia Stahlman. Doch paßt dies eben wenig zu dem dramatisch-leidenschaftlichen Melos, der Frau Aristidous Stimme für den Nono derart perfekt sein ließ und sicher bleiben läßt. Da reicht sie fast an Slavka Taskova heran, die diese Partie in der Referenzaufnahme sang, die mich → für dieses Stück geprägt hat (Nono selbst führte da die Regie) … ein für alle Mal’, wie ich dachte und nun aber eine Aufführung vor Ohren bekam, die ebenfalls so stilprägend ist, dass mir fast Hören & Sehen verging. Na gut, das Hören ja nun nicht. Welch Jammer also, sollte dieses Konzert nicht mitgeschnitten worden sein. Zumindest eine Studioaufnahme sollte es geben. Ich bitte hiermit öffentlich drum.
Aber vielleicht … nein, gewiß hätte sich Frau Aristidous Mahler-Part anders angehört, hätte es diese Pause nicht gegeben. Ich meine, es waren insgesamt 88 Minuten Musik, das sind nicht mal ganz anderthalb Stunden, etwa die Dauer von Mahlers siebter Sinfonie – da geht man zwischendurch ja auch nicht kurz mal etwas trinken. Ich bin sogar der Meinung, dass die beiden Stücke attacca hätten gespielt werden müssen – aus dem hohen ersterbenden Flirren bei Nono direkt in Mahlers Flöten und Schellen und die A-Klarinette hinein. Luciano Cruz’, dem Nonos Totenklage gilt (bitte ihn nicht mit dem gleichnamigen, aber noch lebendigen Oboisten verwechseln), wäre dann endlich angekommen – doch freilich immer noch nicht sicher, da selbst das himmlische Leben derart getränkt ist von Blut. Mahlers Musik, das wurde zurecht schon häufig geschrieben, ahnt permanent das Unheil voraus (wenn Sie so wollen, den Weltkrieg) und Nonos Stück, so spürte ich früh, das Ende der großen sozialen Utopien, auch wenn der Marxist in ihm es sicher so nicht gewollt hat und sein Luciano nicht etwa im Klassenkampf, sondern bei einem Autounfall umgekommen ist. Nicht selten eignet großer Kunst, selbst die Willen ihrer Autoren krud’ zu unterlaufen. Nur deshalb gilt selbst ein Rassist wie Céline begründet als Genie, Pound ohne jeden Zweifel für einen, wenn nicht den Meister des modernen Verses, und Pfitzners »Palestrina« gehört sehr zurecht in ihren Hort.
Hinreißend übrigens, bei Nono, war auch die Klangregie Christina Bauers. Von der Dirigentin quasi assistiert, ließ sie Elektronik und den physischen Orchesterapparat geradezu amalgamieren – in einer Live-Aufführung! Alleine das muß man erstmal hinbekommen, frau + frau, um’s gradzubiegen. (Michael Gielen allerdings konnte es auch: Mit Kopfhörern als Monitor dirigierte er zwei Orchester zugleich). Dazu die teils beklemmende, teils dynamisch überwältigende Massivität dieser Trauermusik; Sarah Aristidous Stärke war eben auch, aus Klage Anklage werden zu lassen und den Revolutionsruf Agitation. Wozu das rasend expressive, mitunter geradezu explosive Klavierspiel Tamara Stefanovichs nicht nur paßte, nein, es nahm diese Ausbrüche auf, um sie noch um so brutaler fortzusetzen. Unversehens war des Konzerthauses historistischer Saal nicht zeitlos nur, nein, modern – weil zum einen nämlich nur noch Musik, zum anderen aber wie Zeugenschaft der furchtbar nahen Kriege, zu denen wir uns irgendwie stellen müssen – auch hier einen Zeitbruch vor Augen, an den das Wort Umbruch zu harmlos nicht langt. Es war schlichtweg atemberaubend. Nach der Pause der Mahler, leider, rückte den architektonischen Historismus dann wieder ins Licht, egal, wie sehr die Sinfonie selbst auch dessen Risse entblößte.
Je mehr ich nachdenke, desto spannender wird’s. Und desto heikler, dies noch eine Kritik zu nennen. Dieshalb hier jetzt nur noch kurz: Welch ein großer Abend sogar für diese an großen Abenden wahrlich, wahrlich reiche Stadt!

Letzte Änderung: 17.09.2024 | Erstellt am: 16.09.2024
In Band 13/20 der gesammelten Werke von Theodor A. Adorno finden Sie seine Ausführungen zu Mahler. Der Band ist hier erhältlich.
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


