
An Modelle abstrakter, struktureller Art denkt man nicht, wenn es um Kunst geht, aber es gibt sie dort durchaus. Warum sind Künstler also bereit, sich auf spröde und formelhafte Bedeutungsmöglichkeiten von Modellen einzulassen? Die meisten Künstler paraphrasieren sie nur oder halten es mit einer bloß modellistischen Attitüde, meint Christian Janecke.
Wenn in der Kunst von Modellen die Rede ist, handelt es sich in der Regel um Skalenmodelle, maßstabsgerecht verkleinerte, dimensional aber nicht verringerte Darstellungen verlorener, absenter oder künftiger Dinge. In der Geschichte der Architektur, des Bühnenbildes und der Bildenden Kunst nehmen sie eine überwiegend dienende Funktion ein, die sich nur hier und da – etwa in der Plastik der sogenannten ›Modellbauer‹ der 1980er Jahre – zum Selbstzweck oder ästhetischen Zweck läutert.
Abgesehen von didaktischen Einsätzen und Veranschaulichungszwecken gegenüber Laien und unverständigen Geldgebern wurden solche Skalenmodelle für die Wissenschaften und die Technik aber weitgehend bedeutungslos. Modelle leisten auf diesen Gebieten etwas anderes. Sie veranschaulichen den Sachverhalt, auf den sie Bezug nehmen, also ihr Modelloriginal, auf strukturelle Weise. So könnte man das komplex mannigfaltige Bewegungsbild einer genügend großen Anzahl angestoßener Billardkugeln zum Modell erheben für Molekülbewegungen kinetischer Gase. Prinzipiell spräche nichts dagegen, dass nun ein Soziologe mit den nämlichen Billardkugeln die Zufälligkeit sozialer Begegnungen in einem öffentlichen Gebäude zu modellieren suchte. Im einen wie im anderen Fall gälte es, auf viele abundante Merkmale zu verzichten, gälte es festzulegen, was überhaupt – vertreten durch zu bestimmende Elemente des Modells – Abbildung finden sollte oder inwieweit die beim Billardspiel auf einer Fläche kollidierenden Kugeln auch räumliche Ereignisse zu modellieren in der Lage wären usw.
An Modelle solcher Art denkt man zwar nicht zuerst, wenn es um Kunst geht, aber es gibt sie dort durchaus. Beispielsweise Franz Erhard Walthers Auge modelliert (1968): Zwei vis-à-vis stehende Menschen spannen ein langes, zu einem zylindrischen Schlauch vernähtes Tuch auf und können es gerade aufgrund ihres starken Auseinanderstrebens als Blickröhre nutzen. Eine Aussage, die durch die formadäquate und eben deshalb vermutlich etwas komische Betätigung eines solchen ›Instruments‹ modellierbar wäre, könnte lauten: »Ausgerechnet körperliche Distanz kann visuelle bzw. psychische Nähe ermöglichen.« Diese nicht sonderlich tiefsinnige, aber immerhin paradoxe, hier einmal angenommene Hypothese wäre natürlich auch anders modellierbar gewesen (so wie im Gegenzug mit Walthers Arbeit auch andere Aussagen hätten modelliert werden können). Trotz dieser Offenheit liefert Walthers Arbeit, wenn man sie als Modell betrachtet, keine willkürliche, sondern eine qualifizierte Struktur, die sich so oder so auf eine paradoxe Beziehung zwischen Akteuren anwenden lässt. Dass sich die Parameter dieser Struktur (zum Beispiel hinsichtlich der Länge des Bandes oder der Anzahl involvierter Personen) variieren ließen, spricht gar nicht dagegen, sondern zeichnet Modelle vielmehr aus.
Nun kann man sich fragen, warum Künstler überhaupt bereit sein sollten, die um einiges geschmeidigeren und vielseitigeren Möglichkeiten einer der Kunst eignenden Darstellung einzutauschen gegen derart spröde und formelhafte Bedeutungsmöglichkeiten von Modellen, bei denen weder eine ästhetische Dimension per se verbürgt ist noch eine konkrete, sondern lediglich eine strukturell verbindliche Referenz besteht. Die ernüchternde Antwort lautet: Die meisten Künstler erschaffen solche Modelle auch gar nicht! Stattdessen paraphrasieren sie ernsthafte Modelle nur oder halten es mit einer bloß modellistischen Attitüde – und dies erst berechtigt uns, von Modellhaftigkeit als einer Masche der Kunst zu sprechen. Denn dabei kann der Künstler hoffen, von den Vorzügen eines Hantierens mit Modellen zu profitieren, ohne sich mit gewissen Schwierigkeiten herumschlagen zu müssen.
Zu den unattraktiveren Seiten gehört jedenfalls, wie man bereits aus dem erörterten Beispiel ersehen konnte, ein je nachdem naiv oder dogmatisch aufstoßender Schematismus mit arg didaktischer Note. Zu den Nachteilen, die sich unter Berücksichtigung historischer Konjunkturen von Modellen ergeben, zählt weiterhin, dass mit dem Abebben der in den 1960er Jahren noch herrschenden wissenschaftsgläubigen Haltungen auch das Vertrauen in die Modellierbarkeit und mithin Kalkulierbarkeit vielfältiger Aspekte des sozialen, wirtschaftlichen Lebens sich verflüchtigt hatte. Ungebrochen modellistische Szenarien wirkten bereits in den späten 1970er Jahren sektiererisch oder unterkomplex utopisch und aus heutiger Sicht vollends spleenig.
Nur ganz oberflächlicher Betrachtung kann es so erscheinen, als habe die nachfolgende Postmoderne ein gutes Verhältnis zu Modellen gepflegt. Zwar verabschiedete freilich auch sie ein Modell ›Moderne‹, um mit dem ›Posthistoire‹ selbst ein anderes Modell dagegenzusetzen, aber hier müsste man eher von Leitbildern sprechen. Denn das Wesentliche für ein funktionierendes Modelldenken: Der Glaube an die Systematisierbarkeit von Welt, an die Möglichkeit, sich ihr zureichend in formalisierter Beschreibung zu nähern, an die Möglichkeit einer Übertragung von Schlussfolgerungen von einem Gebiet auf ein gänzlich anderes – all dies bricht mit der Postmoderne weg.
Zu den fragwürdigen Vorzügen einer Modellhaftigkeit gehört es daher heute erstens, dass sie das Anachronistische zum ›Kult‹ ummünzen kann und von einer Art Wissenschafts-Retrolook profitiert. Indem ein nicht so sehr dem Inhalt, sondern eher nur der Form nach von Wissenschaft und Technik behafteter Eindruck geschürt wird (wie er bei den ›Sammler‹-Künstlern oder auch den Labortüftlern verbreitet ist), fühlen wir uns nicht so sehr gedrängt, zu erraten, was gewisse Dinge oder Zeichen bedeuten sollen, sondern wie sie es qua der in ihnen verkörperten Struktur tun. Da nämlich heute ganz allgemein die ikonographische Anschlusswahrscheinlichkeit – vulgo: die Chance, dass Betrachter wüssten, was Bildgegenstände meinen – gering ist, durchzieht die Modellhaftigkeit ein angenehmer Duft von Verstehbarkeit. Die Modellhaftigkeit provoziert Kohärenzerlebnisse, die eine jüngere Kunst uns gemeinhin immer seltener vergönnt.
Es erscheint zweitens attraktiv, dass Modelle ähnlich einer Formel etwas in verdichteter, allgemeiner, gleichsam uranfänglicher Weise enthalten, das sich über die faktische Gegebenheit des jeweiligen Modells hinaus problemlos weiterdenken lässt. Denn damit gelingt in modellhafter Kunst, was der Kunst in metaphysisch erodierter Zeit sonst kaum mehr jemand abnimmt: ein über die Werkgrenzen hinaus reichendes, gleichsam paradigmatisches Sich-auf-etwas-Beziehen.
Drittens würde ich von der ›linken‹ Anschlussmöglichkeit ausgehen, über Modellhaftigkeit der vermeintlich autoritären Dimension einer dem Betrachter oktroyierten Darstellung entkommen und stattdessen eine Veränderbarkeit des Werkes durch die Betrachter initiieren zu können. Das ›Erarbeiten‹ des Werkes durch den Rezipienten, dessen ›Handeln‹ mit dem Werk als das Werk, betreibt mit großem Sendungsbewusstsein seit Jahrzehnten der erwähnte Franz Erhard Walther, und es ist beispielsweise auch in Charlotte Posenenskes Drehflügel Serie (1967) angelegt. Modelle sind ja gleichgültig gegenüber ihrem Erfinder: Was zu früherer Zeit als Vorteil nur in den exakten Wissenschaften geschätzt wurde, konnte in der Kunst Einlass finden, als es schick wurde, die Autorschaft des Künstlers zurückzudrängen respektive auf die Betrachter zu verlagern. Aus diesem Grund bleiben modellhafte Züge auch beliebte Zutat jüngerer Projektkunst.
Schließlich umweht Künstler, die Modellhaftigkeit nutzen, immer auch etwas von der alten, sehr schmeichelhaften (wenn auch in Wirklichkeit kaum je ernsthaft von ihnen ausgefüllten) Rolle des Erfinders: Denn das modellhaft Dargebotene mimt gern den Prototyp neuer Dinge, Sozialtechniken oder Denkbarkeiten, es zeigt sich als ›erfindungsträchtig ohne Erfindung‹. Die Kunst der Modellhaftigkeit vermeidet damit nicht allein die Daniel-Düsentrieb-Peinlichkeiten tatsächlicher Künstlererfindungen – die angesichts der heutigentags differenzierten Sphären von Kunst und Technik zwangsläufig dürftig ausfallen müssten. In ihrer Korrumpierung echter modellistischer Grundsätze bei gleichzeitiger Paraphrase modellhafter Schemata öffnet künstlerische Modellhaftigkeit auch ein Hintertürchen für die in avancierten Künstlerkreisen als uncool geltende Imagination. In Modellhaftigkeit kompromittieren sich die proto-erfinderischen Gesten der Künstler also gar nicht, weil sie auf die ungedeckten Schecks des Künftigen sich richten.
Gibt es dann eigentlich noch, so würde man abschließend gerne wissen, die Möglichkeit eines Modells in der Kunst, die weder auf bloße Modellhaftigkeit noch auf Trivialität noch doch wieder nur auf die eingangs von uns verabschiedeten Skalenmodelle hinausläuft? Nennen würde ich eine ältere, wunderbar einfache Arbeit des Schweizer Künstlerduos Fischli & Weiss aus gebranntem Ton: Theorie und Praxis (1981). Das eine Mal bilden zwei Männer gymnastisch eine Schubkarre (»Theorie«), das andere Mal steht da die technische Lösung der uns vertrauten Schubkarre aus Rad, Gestell und Lade (»Praxis«). Obwohl Theorie und Praxis nicht als Modell gedacht gewesen sein muss, funktioniert die Arbeit prächtig als ein solches, indem sie nämlich die beiden Begriffe des Werktitels in ein qualifiziertes Verhältnis setzt und dabei mit Humor überzeugt. Soweit ich sehe, wird auch noch das Ausschließende der von Kleist einst behaupteten Alternative widerlegt, Menschen verstünden sich entweder auf eine Metapher oder auf eine Formel.
Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag
Letzte Änderung: 30.08.2021
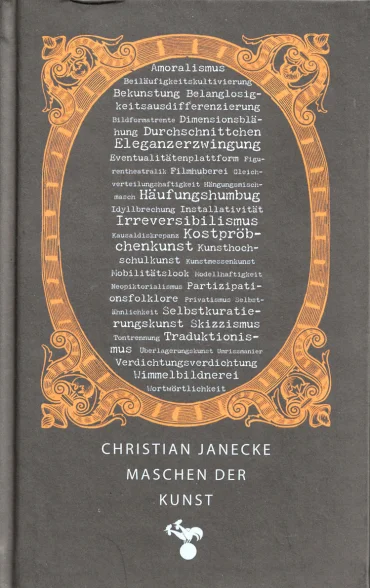
Christian Janecke Maschen der Kunst
Auflage: 1. Aufl.
Einband: Hardcover
Umfang: 238 Seiten
Erschienen: 14. Sep 2011
Format: 11,50 × 18,50 cm
Sprache: Deutsch
Verlag: zu Klampen Verlag
ISBN-13: 9783866741591
ISBN-10: 3866741596
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


