
Wenn heute von Eleganz die Rede ist, sind meist besonders gelungene Gebrauchsgegenstände gemeint. In der Kunst hingegen ist das Elegante darstellbar, aber nicht selbst erreichbar. Deshalb kann die Eleganzerzwingung nur ein vergebliches Vorgehen bezeichnen, findet Christian Janecke.
Nichts erreicht der Zwang schlechter als ausgerechnet Eleganz, die er nie herbeizuführen, sehr wohl aber zu vertreiben in der Lage ist. Deshalb kann die Erzwingung von Eleganz partout kein Resultat, sondern nur ein vergebliches Vorgehen bezeichnen.
Für Eleganz stehen die Chancen schlecht in der heutigen Kunst. Denn obwohl sie kultentbundener- sowie käuflicherweise ein Luxusgut ist und eigentlich jede erdenkliche (Geistes-)Haltung kommunizieren, Kunst uns folglich Eleganz zeigen kann, kommt sie nicht umhin, sich auf einem Aufmerksamkeitsmarkt zu behaupten. Beides aber, das Buhlen um Aufmerksamkeit wie auch das Zeigen als solches, verwirkt Eleganz. Ich würde sogar genau darin eine tiefere Pointe jener Karten sehen, die Jochen Gerz um 1970 an Bekannte und Unbekannte verschickt hat, mit dem Text: »J’ai vu quelqu’un faire un geste pour son propre plaisir. (Il n’y aura pas d’exposition.)« In einer beschließenden, Vertragsunterschriften ähnelnden bzw. paraphrasierenden Zeile stand links unten noch »du 4 avril 1940 au« und in derselben Zeile rechts »Jochen Gerz«, so als könne von diesem Tage an (dem Geburtsdatum des Künstlers) und bis auf weiteres für das oben Stehende der Unterzeichnende bürgen. Dass eine Geste aus bloßer Laune, um ihrer selbst willen vollführt wurde, dass etwas gezeigt wurde, ohne doch adressiert zu sein, wirkt paradox. Das Besagte zielt gegen die krude Mittel-zum-Zweck-Relation, die wir einer Geste jederzeit zu unterstellen bereit sind. Aber es soll auch noch die Kommunikation dieser Verweigerung durch den Verweigernden ungewollt erscheinen. Der da eine Geste vollführte »pour son propre plaisir«, ist als unschuldig zu denken, im Michael Fried’schen Sinne ›absorbed‹, sich unbeobachtend wähnend. Seine Geste ist darstellungsabstinent. Sie begab sich, soll aber nicht nachträgliche Begebenheit werden. Der von Gerz eingeklammerte Nachsatz bekräftigt dies: Mit »Il n’y aura pas d’exposition« wird der emsigen Fraktion etwaiger Kuratoren oder Vermittler anderer Art abschlägig und prompt beschieden, was als Ansinnen vorzubringen sie noch gar keine Gelegenheit hatten. Gerz kam damals, wie er mir sagte, »vom Text und wollte dieses Material wohl in Bewegung versetzen – weniger visuell, was ich ja vorher machte (visuelle Poesie), sondern konzeptuell«, und eine ›Ausstellung‹ hätte hingegen eher Fetischisierung begünstigt, zumal bei den ehernen Botschaften, die Gerz damals ausstreute.
Doch verlassen wir fürs Erste diesen spröden Eigensinn alter Schule und schauen auf die Gegenwart. Wer heute auf Eleganz hält, der schwärmt gerne von jener vermeintlichen ›Zeitlosigkeit‹, die als ›schlichte Eleganz‹ firmiert. Meist ist dann die Rede von besonders gelungenen Gebrauchsgegenständen, an denen eine unaufdringliche, aber hohe Funktionalität bewundert, denen aber vor allem ästhetische Verfallsresistenz bescheinigt wird. Zu schade nur, dass funktionale wie ästhetische Unverweslichkeit zwar als geglückter Sonderfall im Leben der Menschen und in dessen Ausstaffierung, nicht hingegen in der Kunst einen Platz finden kann. Denn in der Kunst lösen Stile, Ismen, Neuerungen einander lautstark ab, und kaum ist an ihr etwas jener Funktion Vergleichbares denkbar, die sich wie bei einem guten Spazierstock auch noch über die Zeiten hinweg erhielte – nicht anders bei einer den eigenen Vorteil aus dem Auge verlierenden dandyistischen Eleganz, die gelebt und bewundert werden kann, ja für die die Schilderungen der Künste unter Umständen die einzigen brauchbaren Zeugen sind. Indes auch hier läuft es darauf hinaus: Der Kunst ist das Elegante darstellbar, aber nicht selbst erreichbar. Wenigstens gilt dies für die heute allein noch mögliche bürgerliche Eleganz, der jene Verschwendung und Überladenheit ausgetrieben sind, an denen der Barock noch Gefallen finden konnte.
Selbsternannte Experten für Eleganz werden nicht müde, uns die Möglichkeit auszureden, Dinge, Menschen, Auftritte, überhaupt irgendetwas könne elegant sein, sondern bestenfalls eine bestimmte Haltung. Nur führen derart privative, das Elegante vor aller Vereinnahmung bewahrende Bestimmungen ihrerseits in einen gewissen Purismus, der jedenfalls selbst Eleganz verwirkt. Bereits aus diesem Grund ist es weder verwerflich noch unklug, auch eine in Maßen empirische Bestimmung von Eleganz im Auge zu behalten. Dementsprechend gehören Außeralltäglichkeit und Leichtigkeit zur Vorstellung von Eleganz – und so gilt uns ein Schäferhund kaum als elegant, ein afghanischer Windhund schon eher. Deswegen kann ein Hubschrauber, dessen windschaufelnde Rotorblätter immerzu gegen den Absturz zu kämpfen scheinen, kaum elegant wirken, ein Segelflugzeug durchaus. Im Unterschied zum Klassischen, das wir mit Harmonie verbinden, ist der Eleganz allerdings immer auch eine Prise Selbstvergeudung beigemischt, und verwirkt wäre sie in dem Augenblick, da ihre Mittel kanonisch würden.
Elegant wäre wohl, was seitens der Kunst nicht zeigen würde, was einfach nur so, für sich wäre – es zu forcieren, ginge den (von Gerz nicht gemachten) Schritt zu weit, der eine Eleganzerzwingung als Masche der Kunst erkennbar werden ließe. Aber wie wird dort forciert? Zum Beispiel, indem Kunst schweigsamen Ausdruck sucht, auf dass sie nicht plebejisch am Markt des argumentativen Für und Wider sich verschleiße. Indem sie das materialiter Wertvolle dem Vorwurf der Protzerei durch Formdezenz enthebt (oder spektakuläre Form durch schlichtes Material läutert). So oder so freilich begibt Kunst sich schnurstracks ins Kunstgewerbliche oder wird Opfer einer verfälschenden Rezeption, die an ihr ein Quietiv sucht – Letzterem entspräche die von bürgerlichen Kunstliebhabern notorisch bewunderte ›Eleganz‹ Brancusis, die sich tatsächlich erst einer von den Schlacken des Entstehungskontextes gründlich gereinigten, nur mehr zwischen sakralen und luxurierenden Anmutungen ahistorisch vagierenden Rezeption im Jahrzehnte späteren Nachhinein verdankt.
Charakteristischerweise sind Architekturen, die wir heute als elegant empfinden, länger, horizontal gestreckter als andere, etwa im Falle von Bungalows. Architektur kann im Unterschied zur Bildenden Kunst vermutlich deshalb kitschresistent elegant sein, weil eben nicht nur Kunst bzw. Gestaltung, sondern auch die obengenannte Vorstellung eines Lebens darin eine wichtige Rolle spielt, nicht ohne weiteres eines Müßiggangs, aber doch einer um optimierende Raumausnutzung sich gar nicht scherenden Auseinanderlegung von Zentren des Bewohntseins. Das wiederholt sich in der Anlage einzelner Räume oder Möbel, etwa einer weit hingestreckten Couch, deren Proportion absticht von Großmutters gedrungenem Sofa. Kunst, etwa in Bildform, die sich an die Fersen dieses Prinzips heftet, punktet regelmäßig bei ästhetisch Ambitionierten, verwirkt aber wahre Eleganz. Von der Ausnahme gattungsmäßig bedingten Anlasses (Panorama, Vedute etc.) abgesehen gerät das horizontal gestreckte Format nämlich zum Prätentiösen. Es wurde mittlerweile für Neureiche, die Hundefutter mit dem Namen »Maximus« kaufen und alles in XXXL mögen, Ausdruck sozialer Distinktion (und tritt übrigens an genau die Stelle, die in den postmodernen 1980er Jahren vertikale Übertreibung innehatte).
Die Premium-Variante künstlerischer Eleganzerzwingung hat von dem horizontalen Morph-Faktor, der dank einer Favorisierung durch protzigen Geschmack ein wenig kompromittiert erscheint, Abstand genommen. Das Zaubermittel heißt dort: diskrepante Binnendistanzen des Werkes. Das zweite Obergeschoss der Kunstwerke Berlin beispielsweise schien im Zuge einer Ausstellung von Ceal Floyer fast leer zu sein. Rechterhand erblickte man zwei aufgesockelte Präzisionsdiaprojektoren, und gut 20 Meter weiter links zeigte die messerscharfe Projektion zwei einander nur knapp überschneidende handtellergroße Kreisscheiben aus Licht. Dieses Long Distance Diptych (2009) hatte alles, was zur Eleganzerzwingung nach dem state of the art gehört: zwei lichte kleine Formen, wie eingeschrieben in die große umgebende Wandfläche, weil die enorme Distanz zu den Projektoren für den Eindruck einer erratischen Ursprungslosigkeit sorgte, gleichwohl doch jede Unterbrechung der Projektion unmittelbar Schlagschatten erzeugte respektive das Lichtgebilde tilgte, so dass die permanente Erzeugung und Bündelung von Licht zu diesem Bild doch bewusst und nachvollziehbar blieb. In der hellen, staubfreien Ausstellungsetage gewann der Lichtkegel aber gar keine Kontur – bis er auf die Wand und dort direkt verwandelt auftraf. In Arbeiten wie dieser spreizt sich auf ins Realisierte, was Gerz noch konzeptuell sublimiert, was er durch doppelte Rahmung unserem Zugriff entzogen hatte.
Doch die Eleganzerzwinger lassen nicht locker. Könnte die von Gerz gewählte Strategie der Nichtinstrumentalisierbarkeit, die eine Eleganz zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen hatte, nicht ein bisschen publikumswirksamer zu haben sein? So oder so ähnlich könnte ein Massimo Bartolini gedacht haben, als er seine Arbeit Double Shell (2003) im Museum für Moderne Kunst Frankfurt realisierte: Ein freundlicher älterer Wärter öffnete, wenn es sich ergab, für einzelne Besucherinnen und Besucher behutsam seine Hand, um ihnen eine darin liegende schimmernde Perle einen Augenblick lang zu zeigen. Auch dies eine Geste – lakonisch, flüchtig, wunderbar und entwaffnend (wenn es auch etwas gönnerhaft anmuten mochte, mit dem betagten Wärter einen der Geringsten in der Museumshierarchie zum Überbringer der frohen Botschaft zu machen, wobei es unerheblich ist, ob es sich um einen echten oder einen nur gespielten Wärter handelte). Doch weiter zu den Umständen: Bartolinis Arbeit war als Teil des Ausstellungsprojektes Das lebendige Museum dazu auserkoren, die offensichtlich als ›tot‹ erachtete sonstige Konfrontation der Betrachter mit Bildern, Installationen, Videokunst usw. zu überwinden. So fanden sich auch Fotografien der ›Begegnungen‹ zwischen Wärter und Besuchern im Internet, die inniges Einvernehmen zwischen beiden vermittelten. Die Ostentation, die Darbietung der Perle, die nicht dauerhaft betrachtet werden konnte wie vielleicht auf einem gemalten Stilleben, sondern die, von einer lebendigen Hand gerahmt, unserem Staunen – nein, nicht unserem, sondern jeweils ganz intim einem individuellen Staunen – kurz preisgegeben, dann entzogen wurde, wollte genau dorthin, wo Gerz schon einmal war: Etwas sollte sich bloß begeben und nie Begebenheit werden oder geworden sein. Allerdings war Gerz’ eleganter Kniff ja die Rahmung durch den Report eines Ich-Erzählers gewesen: Das war das paradoxerweise nötige ›Bild‹, um eine buchstäblich bildliche Fixierung zu vermeiden. Ganz anders dort, wo nun ausgerechnet das Museum sich als Gastgeber jenes eleganten Bildes vom Glück aufspielt, das das Museum doch einst in Gestalt des Mediums Performance Art verlassen, geflohen hatte, um eines Glückes willen, das nicht in Marmor gehauen, nicht Bild werden wollte. Dieses Glück, so viele Lehren hatte man aus Gerz gezogen, war nicht darstellbar. Es sollte – wohl deswegen Performance – vielmehr sich selbst darstellen, ja sich ergeben als Staunen am laufenden Band auf zahlreichen Gesichtern. Und das hatte gefälligst innerhalb der musealen Öffnungszeiten des Glücks zu geschehen. Schon wieder, so möchte man aufseufzen, keine elegante Kunst, aber fast eine elegante Lösung.

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag
Letzte Änderung: 30.08.2021
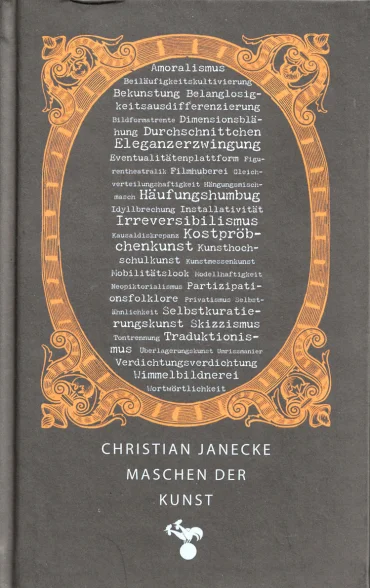
Christian Janecke Maschen der Kunst
Auflage: 1. Aufl.
Einband: Hardcover
Umfang: 238 Seiten
Erschienen: 14. Sep 2011
Format: 11,50 × 18,50 cm
Sprache: Deutsch
Verlag: zu Klampen Verlag
ISBN-13: 9783866741591
ISBN-10: 3866741596
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


