
Der Forscher des Selbstbewusstseins, der Philosoph Dieter Henrich, ist tot. Der Dialog, den Alexandru Bulucz mit ihm führte, brachte Einsichten hervor, die der einsame Schreibakt nur schwer ermöglicht. Faust-Kultur veröffentlicht noch einmal ein Gespräch, das anlässlich des 90. Geburtstags des Philosophen zustande kam und von Celibidache über Heidegger und den Tod zu Kafka und Hölderlin führt: „Die Sprache, die gesprochen wird, transportiert Gedanken hin zur Deutlichkeit, die man so sonst noch gar nicht hatte.“
Alexandru Bulucz: In Ihrem Artikel über Celibidache bezeichnen Sie ihn als Lehrer. Auch Sie sind ein Lehrer, Sie selbst beschreiben sich als Lehrer.
Dieter Henrich: Er war ein ganz anderer Lehrer als ich. Er wollte seine Sache verstehen und weiter wirken lassen, und so hörte er nicht leicht auf die anderen. Er wollte seine Einsichten mitteilen. Die aber zeigte er so, dass er sie zugänglich machte. Als Dirigent war er darin unvergleichlich – ganz anders als sein Image –, durchaus dem Werk und der Aufgabe, es aufzuschließen, untergeordnet. Ich bin nur zufällig zu ihm gekommen, denn er war ja, als ich nach München kam, längst ein sehr berühmter Dirigent, und man konnte kaum Karten für seine Konzerte bekommen. Man musste morgens sehr früh anstehen. Das konnte ich nicht auf mich nehmen. Ich war auch abgeschreckt durch Joachim Kaiser. Das war der Feuilleton-Chef der Süddeutschen Zeitung, der Celibidache ablehnte und ganz negative Rezensionen über ihn schrieb. Er warf ihm etwas vor, was auch für mich einen wirklich schlimmen Vorwurf ausmachte, nämlich eine Guru-Attitüde. Nun war er in der Tat ein Guru, aber nicht in einer selbstverliebten Weise, sondern so, wie ich gerade sagte. Zunächst bin ich einfach nicht in die Konzerte gegangen, bis ein mir auch spät befreundeter analytischer Philosoph, Donald Davidson, den ich für zwei Monate nach München auf eine Professur eingeladen hatte, zu Besuch kam – ein großer Musikkenner. Mir war klar: Wenn ich ihn einlade, dann muss ich ihm auch Konzertkarten für Celibidache verschaffen. Ich bekam die Karten dann, ohne anzustehen, weil ein prominenter Gast in der Stadt bevorzugt wurde. Ich bin eigentlich nur mitgegangen, wenn auch gespannt auf das, was mich erwartete. Und dann fing Celibidache an zu dirigieren! Nach kurzer Zeit war ich überwältigt. Das war eine meiner großen Eröffnungserfahrungen. Ich habe Musik noch nie, außer als Kammermusik, so gehört: mit einer Transparenz, dass man wie durch eine Glasarchitektur durch die Partitur, die er dirigierte, hindurchhören und -gehen konnte. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können vor Bewunderung dafür, dass er mir etwas gezeigt hatte, was ich für unmöglich gehalten hätte. In der Kammermusik, ja, aber eben nicht im großen Orchester. Er brachte es zustande, das große Orchester mit dieser kammermusikalischen Transparenz zu dirigieren.
Celibidache gab auch gelegentlich öffentlichen Unterricht. Ich stellte bei einer solchen Gelegenheit fest, dass zwei meiner eigenen philosophischen Schüler Anhänger von ihm waren, und schrieb ihm einen Brief, denn er verstand sich ja selbst auch als Philosoph. Ich schrieb, es interessiere ihn vielleicht, wie seine Musikpräsentation auf einen Philosophen wirke. Das hat wiederum ihn bewogen, auf mich zuzugehen. Ich bekam zunächst einen Anruf von der Sekretärin der Münchner Philharmoniker, die sagte: „Der Maestro will, dass Sie immer Karten haben.“ Das war ein großes Geschenk. Ich brauchte nun nur anzurufen, ich musste die Karten zwar bezahlen, aber ich bekam die Plätze, die ich wollte, und so bin ich in alle seine Konzerte gegangen, und bald hat er mich in seinen Unterricht eingeladen. So ist das zustande gekommen. Aber jener erste Konzertabend ist ein – man kann sagen – Umkehrerlebnis für mich gewesen … Ja, ich muss wohl sagen, dass er mir eine Art von profaner Offenbarung gewährt hat.
Welches Konzert war das? Ein Bruckner-Konzert?
Nein, nein, eben nicht. Das war zunächst eine Tondichtung von Richard Strauß und dann die „Fünfte Symphonie“ von Tschaikowski, eine Partitur, die ich gar nicht so großartig fand, aber er hat sie derartig eindrucksvoll dirigiert, dass das schon reichte. Er hat später nur noch wenig Bruckner dirigiert, da er das maßgeblich in früheren Jahren getan hatte. Das habe ich leider versäumt. Aber in seinem Unterricht wurden die Aufführungen auch nachträglich besprochen. Was war jeweils geschehen? Das war der Ausgangspunkt seiner Kritik der Musik auf Schallplatten. Jede Aufführung ist anders. Man kann es nicht voraussagen. Es muss werden. Im Studio wird es nie, sondern es wird abgeschaltet und wieder in Gang gesetzt oder gar montiert. Es geht nie in einem Zug. Celibidache hat schließlich immerhin Live-Aufnahmen seiner Konzerte bewilligt. Die hat er nur nicht auf Platten verkaufen wollen. Aber sie sind, was er gewiss voraussah, nach seinem Tod doch von seinem Sohn verfügbar gemacht worden.
Was hat Ihnen dabei imponiert? Die von ihm so verbreitete Langsamkeit seiner Stücke?
Nein, die Langsamkeit war die Bedingung der Differenzierung und der Transparenz. Ich bin auch immer in seine Proben gegangen. Die Proben waren öffentlich und unentgeltlich, was nur von wenigen Leuten wahrgenommen wurde. Ich war seinerzeit schon emeritiert. Ich konnte mir Zeit nehmen und mich zeitweise auf ihn konzentrieren. Ich war immer bei den Proben und habe dann auch mit seinen Schülern, seinen Dirigatschülern, engere Verbindungen gehabt. Eine wichtige Lehre seiner Technik im Dirigieren war, dass, wenn die Instrumente wechseln, jedes Instrument immer genau darauf achten muss, worauf es antwortet und was und wie es aufnimmt, so dass die Instrumentengruppe das, was ihr von den anderen übergeben wird, weiterführt und wandelt, das bedeutet, wie die Artikulationen innerhalb dieser Phasen der Partitur different zu spielen sind. Dadurch ergab sich dieser Transparenzeffekt. Celibidache hat viel länger geprobt als andere Dirigenten. Ich hatte schon lange zuvor erfahren, dass die Philosophie gegenüber anderen Disziplinen die eindrucksvolleren Bauformen des Denkens ausbildet – zuerst findet man diese Art Architektur bei Platon und trotz seiner Selbstbegrenzung im Wissen von einer Welt dann auch bei Kant. Das sind Zuordnungen von außerordentlicher Subtilität, Weite und Gestaltungskraft. Wenn der Mensch ein Bild von der Welt hat, das dieser Welt und den Menschen angemessen ist, dann muss es differenziert sein. Es muss aber auch transparent sein, und die großen Philosophen bieten Ihnen diese Architekturen, in denen Sie dann versuchen können zu leben. Dem hat Celibidache für mich in der Musik entsprochen. Natürlich ist es in der Philosophie etwas ganz anderes; er aber hat es ziemlich unmittelbar auch als philosophisch verstanden.
Seine musikalische Phänomenologie …
Ja, das war eine weitere Dimension seines Dirigierens. Sie steht im Zusammenhang mit seiner Orientierung am Denken aus indischem Ursprung. Er betrachtete die Musik sozusagen als eine philosophische Form der Welterschließung nach folgender Grundtypik: Der Komponist setzt einen Anfang, der auf das zu entfaltende Ganze voraussehen lässt, das er in nuce bereits enthält. Dann hebt eine Entwicklung an, die zu einem Höhe- und Wendepunkt führt, von dem aus das Ganze einem Ende zugeleitet wird, in dem der Anfang wiederum präsent ist. Wenn ich dirigiere und diese philosophische Dimension im Dirigieren walten lasse, dann muss ich schon beim ersten Takt das Ende irgendwie antizipieren: Celibidaches Interpretation von großen Werken, insbesondere von Beethovens Symphonien, schloss den Hinweis darauf ein – den Hinweis darauf, wo der Höhepunkt der Sätze gelegen ist und dass der Höhepunkt etwas ganz Stilles sein kann, in dem die ganze Symphonie gegenwärtig ist. Das wollte er dirigierend aufzeigen, und seine Selbstinterpretationen dazu waren ungemein erhellend. Das kann man übrigens nur, wenn man so langsam spielt. Wenn das Dirigat Sie emotional mitnimmt, dann haben Sie gar nicht die Distanz, die zu einer auf der Kontemplation des Ganzen beruhenden wirklichen Ergriffenheit durch dieses Ganze gehört. Er selber sagte, dass es ihm nicht immer gelinge, Anfang und Ende zusammenzubringen und damit diese Synthese der Komposition im Dirigieren zu erreichen. Da ist die Transparenz, die Durchsichtigkeit natürlich eine Voraussetzung, aber das genügt noch nicht, um diese Formwahrnehmung zu erreichen, die einer philosophischen Lebenseinsicht vergleichbar ist. Das war sein Ziel. Er erzählte, dass es nur wenige Male geschehen sei, dass er in einer Aufführung das Bewusstsein gehabt habe, das sei jetzt wirklich vollendet der Komposition angemessen und insofern ‚wahr‘. Er könne es auch nicht bewirken, es müsse ‚kommen‘ – und er erinnerte sich einzelner Aufführungen irgendwo in der Welt, die lange zurücklagen, und berichtete über sie und die Akustik im Konzertsaal. So viel zu Ihrem Landsmann. Sie sehen in mir hier einen Deutschen, der die rumänische Kultur zu schätzen weiß.
Ich bleibe noch kurz bei Heidegger, den ich gern zitieren möchte: „Vielleicht sind Sie der Meinung, dass dies hineingedeutet ist […], aber Sie werden vielleicht später einmal sehen, dass Interpretation vielleicht nichts anderes ist als Herausstellen dessen, was nicht da steht.“ Dies spricht er im Rahmen seiner Aristoteles-Auslegung aus, was ich aber weggelassen habe, denn es geht mir zunächst nur um Heideggers Begriff der Interpretation.
Ja, das würde ich ganz unterschreiben, aber es müsste die Deutung etwas ergeben, was da stehen könnte.
Was aber nicht hineinprojiziert wird, sondern was schon immer da gewesen ist.
Ja. In Heideggers Formulierung wirkt sich sein Gedanke vom ‚Sein‘ als sich verbergend im Sich-Ereignen aus – auf Seiten des Menschen von dem Vergessenen im Reden, das immer selbst auch vergessen ist und das deshalb herausgehoben werden muss, indem an es erinnert wird. Das führt dazu, dass er etwas zur Sprache bringen will, was nicht nur nicht da steht, sondern in dem, was da steht, immer auch und schon verdeckt ist. Sich dem anzuschließen hieße, Heidegger im Ganzen zu folgen. Es gibt aber auch eine schlichtere Begründung: Kein Denker kann selbst ganz erschöpfen und in seinen Kontext bringen, was ihm zuerst aufgegangen ist. So sagt etwa auch Kant, jeder große Denker bedürfe eines Deuters. So ist für Kant Newton derjenige, den er erst in seiner eigentlichen Bedeutung verständlich macht. Ich habe auf dem Titelblatt meiner Dissertation über Max Weber eine Reflexion Hegels stehen: „Ein großer Mann verdammt die Menschen dazu, ihn zu explizieren.“ Das meint dasselbe, aber nicht das Unaussprechbare, das unausgesprochen ist, weil es von ihm selber her gar nicht auszusprechen wäre. Dieser Gedanke ist das Besondere bei Heidegger. Da ist also zwar die Originalität seines Gedankens anzuerkennen, aber ich kann ihm nicht zustimmen in der Auffassung dessen, was eine philosophische Interpretation leisten soll. Noch als Assistent habe ich die Unverfrorenheit besessen, eine Rezension von Heidegger zu schreiben, in der ich seine Weise zu interpretieren kritisiere. Die Rezension von Heideggers Kant-Buch wurde 1955 – ich war noch nicht habilitiert – in der „Philosophischen Rundschau“ veröffentlicht. Sie heißt „Über die Einheit der Subjektivität“. Darin weise ich Heidegger nach, dass er in Kant etwas hineinliest, was nach Kants ausdrücklicher Meinung nicht da stehen soll. Und das, na ja …, war Gadamer nicht so lieb; dennoch hat er den Text selbst in seiner Zeitschrift veröffentlicht. Heidegger hat das wohl auch wahrgenommen. Ich meinerseits war mir gar nicht bewusst, dass es vielleicht riskant ist, so etwas zu tun. Zu jener Zeit war Heidegger fast, nicht ganz, aber fast unbestritten der Denker der Zeit.
Sie werden vermutlich überrascht sein, wenn ich Ihnen jetzt den Grund nenne, weshalb ich diesen Satz und nicht einen anderen zitiert habe. Das hat weniger mit Heidegger zu tun denn mit einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich Sie soeben unterbrochen habe. Mit dem Heidegger-Zitat, das ich bei Weitem nicht so tiefgründig wie Sie durchdacht habe bzw. habe durchdenken können, wollte ich lediglich die Rede auf etwas bringen, was, wie mir scheint, bei Ihnen fehlt: die ausdrückliche Thematisierung des Todes. Der Tod als Thema kommt bei Ihnen meist in den Nachrufen zu Wort, wobei es gut sein kann, dass ich mich da täusche.
Doch, doch, das ist richtig.
Wie könnte man das dann verstehen? Fällt es jemandem, der, wie Sie, vom Deutschen Idealismus geprägt ist, notwendigerweise schwer, den Spagat zum Thema ‚Tod‘ zu machen? Gibt es eine Waage zwischen Deutschem Idealismus und Schicksal, was der Tod durchaus ist? Ich möchte einen kurzen Exkurs machen, um diese Fragen zu konkretisieren: Als Jacques Derrida wusste, dass er bald sterben würde, gab er sein letztes Interview. Dieses Interview ist betitelt „Ich bin im Krieg mit mir selber“: ein folgenschweres Bekenntnis, wie ich behaupten würde. Denn man könnte zugespitzt sagen, dass im Angesicht des Todes ihm der Halt, den er seinem lebenslangen Philosophiestudium abgetrotzt hatte, und das Bewusstsein dafür völlig abhandengekommen waren. Man könnte sagen, sein lebenslanges Philosophiestudium war ihm persönlich letztendlich doch nur vergebliche Mühe gewesen. Sie sehen, mit dem Heidegger-Zitat wollte ich zur persönlichsten Frage, die ich Ihnen stellen wollte, überleiten …
Ja, sie ist wirklich sehr persönlich. Aber ich will mich ihr gern stellen. Ich war elf Jahre alt, als mein Vater starb, und meine Eltern haben, bevor ich geboren wurde, drei Kinder gehabt, die alle gestorben sind: eine späte Fehlgeburt und zwei Kindertode im Babyalter. Es war die Zeit der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Ich habe mit dem Tod meine Kindheit verbracht. Dieser Kindertod war für meine Eltern ein schreckliches Schicksal. Und dieser Tod ist irgendwie auch für mich immer präsent gewesen – nicht nur bei dem häufigen Gang zu den Gräbern der kleinen Brüder, sondern auch in der großen Angst der Eltern um mein, ihres einzigen gebliebenen Kindes Überleben. Der Tod meines Vaters ist dann zu einem entscheidenden Ereignis in meinem Leben geworden. Denn ich war bei ihm, und sein letztes Wort hat er an mich gerichtet. Es war ein Segenswort. In gewisser Weise verstehe ich mein ganzes Leben als eine Erfüllung dieses seines letzten Wortes. Gerade weil mir der Tod so bedeutsam ist und insbesondere weil er mir etwas ist, das verlangt, im Ganzen all dessen, was wir denken können, verstanden und angenommen zu werden, wenn dies denn möglich ist, bin ich zurückhaltend gewesen, darüber zu sprechen. Es würde zu sehr persönlich werden. Ich habe die beiden Reclam-Bändchen, die ich publiziert habe, meinem Vater und meiner Mutter gewidmet – mit dem Gedanken sozusagen, ein literarisches Doppelgrab für sie zu errichten. Manche Menschen merken das, wenn sie die Bändchen lesen. Auch habe ich eine Abhandlung über Dankbarkeit geschrieben, die mir gerade in der Theologie Aufmerksamkeit erbracht hat. Für mich ist das menschliche Leben damit verbunden, dass es im Ganzen dessen, was es ist, für sich selbst und für ein anderes Leben dankbar sein kann – also gerade im Tod, dem eigenen oder dem eines geliebten Menschen. Ich zweifle, dass das möglich wäre, wenn es ein ewiges Leben geben würde. In der Zeit, als ich meine Selbstbewusstseinstheorie entwickelte – die Vorform, also von „Fichtes ursprüngliche Einsicht“ – hatte ich nachts einen Traum, in dem ich mit meinem Assistenten Hans Friedrich Fulda sprach, und in diesem Traum hatte ich einen Einfall: „Wenn die Theorie des Selbstbewusstseins – die in der ganzen Geschichte der Philosophie und die noch immer maßgeblich ist –, dass wir nämlich aus eigener Kraft uns auf uns wenden können, wahr ist, dann ist der Tod unmöglich.“ Das heißt, ich musste mein eigenes Programm auch darauf orientieren, das Selbstbewusstsein so denken, dass es vergehen kann, um nicht unfreiwillig durch ein falsches Modell in eine Notwendigkeit der Selbstverewigung getrieben zu werden – wie es etwa Fichte zuzeiten geschah. Das ist nur eine Serie von Fixpunkten des Horizonts für eine Verständigung über den jeweils eigenen Tod in dieser Zeit. Ich habe keine wirkliche Konzeption, die unsere Rolle als Mensch unter sieben Milliarden anderen davor bewahrt, nur als absurd erfahren zu werden. Wir sind selbstzentriert, und zugleich sind wir, wie auf der Hand zu liegen scheint, ganz ephemer im Ganzen. Aus meiner Schulklasse ist noch ein Viertel der Schüler in Hitlers Krieg gefallen. Sie sind mir alle gegenwärtig. Dass ich überlebt habe, ist einer zufälligen Konstellation und meinen Bemühungen, mich nicht in den sinnlosen Untergang hineinziehen zu lassen, zu verdanken. In der letzten Kriegsphase wurden auch noch die Sechzehnjährigen ‚verheizt‘. Ein unglaubliches Verbrechen auch dem deutschen Volk gegenüber. Ich muss an Leibniz denken, wenn ich mich frage: Wie gehst du mit deiner völligen Zufälligkeit in dieser deiner zeitlichen Existenz um? Leibniz war Mathematiker, und für ihn spielte die Unendlichkeit keine besonders aufregende Rolle. Die Zahl der Menschen, die es je gegeben hat, ist für einen Mathematiker winzig, aber Gott ist unendlich. Wenn man das wirklich denkt, also ein Absolutes denkt, dann muss man denken – das ist auch zen-buddhistisch –, dass in jedem Menschen irgendwie ein Konzentrationskern des Ganzen gelegen ist. Aber das ist ein Gedanke, den man nicht einfach so leichtfertig vortragen kann – zumal in der Anwendung auf den Tod. Man muss diesen Gedanken, zugunsten dessen ich vieles geschrieben habe, trotz seiner Klarheit und Tiefe auch verdächtigen als eine Ausflucht, und so meine ich schon, dass der Mensch, der auf das Ganze geht und sich in diesem Ganzen unterbringen muss, notwendig in einer Ambivalenz steht. Was Derrida über sich selber sagt … Wenn ich etwa dazu zu ihm sprechen könnte – er war ein sehr sympathischer Mensch –, würde ich ihm sagen: „Du wirst jetzt an dir selbst irre; das gehört zu dem, was du bist; vertraue trotzdem auf dein endliches Leben und das, dem es zugehört.“ Aber das ist nichts, was ich in eine wissenschaftliche Abhandlung einfach nur hinschreiben kann. Das ist das Resultat eines langen Nachdenkens und Erfahrens im Lichte von Gedanken, also notwendig auch sehr persönlich. Wir leben, wenn wir endlich sind, als Fackelträger. Wir geben durchdacht Erfahrenes weiter, und darin liegt, dass man den Anderen in ganzem Ernst als ebenso wirklich wie sich selbst betrachtet. Man schließt sich ihm auf und vertraut darauf, dass er sich über sich selbst wird verständigen können. So entsteht eine Kette in Gedanken geführten Lebens – ohne demonstrierte Erkenntnis und im nie ganz schwindenden Selbstzweifel – und doch verlässlich.
All das, was Sie erzählen, ist mir noch nicht passiert, aber die Angst vor dem Tod ist trotzdem da.
Junge Menschen haben solche Furcht mehr als alte, wenn sie sich auch verwegen über sie hinwegsetzen können. Ich kann ja immer sagen, ich habe mein Leben gelebt, bin zufrieden mit ihm und dankbar für es. Aber das Leben ist in Jugend und Alter eben doch nicht wirklich grundlegend verschieden. Wir bleiben immer diese Endlichen, von denen die Griechen, anders als wir, in ihrem Alltag als von den Sterblichen sprachen. Auch der Tod ist im Grunde immer so dasselbe, wie das Leben dasselbe ist. Der Tod hat für einen alten Menschen wohl das Besondere, dass er einem sehr nahe bevorsteht und man doch immer noch nicht weiß, wie er sich vollzieht. Er kann gnädig sein, und er kann furchtbare Entstellungen bewirken. Vor dem Sterben muss man ja auch Furcht haben, wobei die Angst vor dem Tod eine andere Angst ist. Dass man endlich ist, das ist nichts, was man einfach nur so verbuchen und worüber man sagen kann: „Ja, natürlich.“ Dies muss man zwar auch sagen, denn es versteht sich wirklich von selber, aber als was es sich da von selbst versteht oder verstehen kann, das ist eine ganz andere Frage. Sie bedarf einer lang anhaltenden Auslegungsanstrengung, und sie wird nie dazu führen, dass man mit sich im Reinen ist ganz und gar, dass man nicht fürchten muss, wie das, so scheint es, Derrida erfahren hat: dass etwas über einen kommt, womit man nicht gerechnet hat, von dem man dachte, man sei immun dagegen. Das ist man nicht. Man muss trotzdem eine Stabilität gewinnen. Ich habe dies alles so noch nie gesagt. Gut, dass Sie gefragt haben. „Gute Frage“, sagt man, wenn man keine Antwort hat. Aber man muss dennoch mit dem Sprechen beginnen. Die Sprache, die gesprochen wird, transportiert Gedanken hin zur Deutlichkeit, die man so sonst noch gar nicht hatte. So ist ein Anfang gemacht.
Eine Frage, auf die Sie gewiss eine Antwort haben: Welche waren für Sie die ersten großen Bücher: die Bücher der Bibel, die der Philosophen …?
Das ist schwer zu sagen. Es gab natürlich Kinderbücher, die ich liebte. Ein erstes Buch, das mir wirklich einen ganz neuen Horizont eröffnet hat, so dass ich sage, das hat einen Urhorizont eröffnet, war die „Kritik der reinen Vernunft“. Ich kannte früh Literatur, aber die Literatur, die ich dann wirklich groß, weil etwas noch nicht Berührtes treffend, fand, ist das noch nicht gewesen. Meine Eltern waren in gewisser Weise deutsche Kleinbürger. Mein Vater war Naturwissenschaftler, aber selbst aus beengten Verhältnissen kommend. Meine Mutter hatte nur die Volksschule besuchen dürfen. Aber sie stand einem damals viel gelesenen Schriftsteller (Wilhelm Speck) sehr nahe. Die Literatur, die meine Eltern hoch schätzten, die sie besaßen, war für mich nicht so in der Tiefe erschütternd – immerhin etwas Wilhelm Raabe und Fontane bis hin zu Thomas Mann. Die Bibel habe ich zwar internalisiert, und sie hat mir viel bedeutet, aber ein großes Buch in dem Sinne kann ich das nicht nennen, weil ich sie gar nicht als Buch kenne, sondern immer nur in einigen auch meinen Eltern wichtigen Passagen, die allerdings dann auch auf immer präsent waren – wie natürlich Paulus’ „Hohelied der Liebe“, 1. Korinther 13, und der 23. Psalm: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.“ Also kein großes Buch, sondern lebenswichtige Worte. Zu den Autoren, von denen ich beim Lesen dachte, jetzt wird die Welt anders, muss ich zunächst Kafka zählen, was mit der Erfahrung von 1945 zusammenhängt. Sie müssen sich vorstellen, ich bin unter Hitler in die Schule gegangen. Damals war alles Moderne ausgesperrt. Die Literatur, die wir lasen … Gut, Goethes „Faust“, ein in seiner Art singuläres Buch. Ich kannte daraus große Passagen auswendig. Homer, aus dem ich auf Griechisch auswendig lernte. Aber große Bücher, durch die eine Perspektive sich eröffnet, die dich in deiner Gegenwart berührt, waren das doch nicht. Sophokles’ „Antigone“ kam dem schon näher. Der Zusammenbruch von Hitlers Reich und der Einzug der Amerikaner gehörten natürlich zu einer ungeheuren Umbruchserfahrung: eine Befreiung, aber gleichzeitig auch eine Demütigung. Sie haben uns dann umerzogen und uns die Demokratie gelehrt. Wir fanden das alles zunächst einmal sehr oberschulhaft, aber sie haben ebenso versucht, uns in eine andere Praxis hineinzuversetzen, und zudem die Politik des „Schau hin!“ verfolgt. Sie kennen die Legende von der Bekehrung des Augustinus: Augustinus hörte von irgendwo: „Nimm und lies!“, und griff daraufhin zur Bibel. Die Amerikaner stellten uns sogar die Bücher hin und sagten nichts anderes. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Ich war noch Schüler, hatte noch nicht das Abitur, als der Krieg zu Ende war. Sofort danach wurde das Amerikahaus gegründet, das man besuchen konnte. Auch noch als Schüler hörte ich eine Vorlesung von Franz Borkenau, damals US-Universitätsoffizier in Marburg, eines bedeutenden Autors, und die Amerikaner besorgten mir ein Buch auf Englisch, das gerade erst erschienen war, bloß weil ich es, angeregt durch jene Vorlesung, lesen wollte. Und da waren die vielen anderen zuvor unzugänglichen Bücher – und da war eben Kafka. Ich bewunderte zwar Rilkes impressionistische Gedichte und lernte viele von ihnen auswendig. Aber als ich angefangen habe, Kafka zu lesen, hat mich eine Welt angerührt – wie ein Abgrund hinter allem. Ah! Ein ganz großer Augenöffner. Das war viel näher an dem, was ich wirklich erfahren hatte, als die Indoktrinationen der ‚Reeducation‘ samt ihren durchaus auch honorigen Stilformen. Ja, das war Kafka. Jedoch sehr spät eigentlich. Es hätte viel früher sein müssen. Aber es war noch vor der „Kritik der reinen Vernunft“. In der Schule gab es leider noch keine Philosophie, und Wilhelm Anz, der Lehrer, der sie in den Deutschunterricht ehedem einzufädeln wusste, war längst Soldat und nun in Gefangenschaft. Ich vermisste ihn sehr.
Lieber Herr Henrich, ich erlaube mir einen weiteren Sprung, und zwar zu meiner letzten Frage. Sie bezieht sich auf eine Stelle aus Hölderlins „Friedensfeier“.
Muss das sein?
Lieber nicht?
Gerade manche Hymnen sind für mich auch ein Problem in Hölderlins Werk.
„Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander“, lautet diese Stelle. Kann man sie in Begriffen wie ‚Ethik‘ und ‚Verantwortung‘ denken?
Das sind zwei Dinge. Verantwortung ist nun seit Hans Jonas auch noch ein anderes Thema. Verantwortung ist normalerweise eine solche für Menschen, primär für Abhängige, noch näher für Kinder und für Bereiche, in denen man eines Amtes waltet. Das ist die Ebene, in der Gespräche stattfinden. Das kommt mir, weil Jonas eine Verantwortung des Menschen nicht nur für die Menschheit annimmt. Das ist eine Problematik, die mit diesem Hölderlin-Wort verbunden werden kann, und Heidegger würde sie sogar so verbinden. Zwar spricht er nicht über die Menschheit, aber darüber, dass wir am Ende des Abendlandes im Gespräch sein müssen mit dem Ursprung der griechischen Welt, der eben eines Gespräches bedarf, weil er ein sich selbst Verborgenes in sich trägt, das in diesem Gespräch in dieser seiner Verborgenheit doch zur Sprache kommen kann. Wissen wir von dem, was in aller Unverborgenheit verborgen bleibt, so werden wir zugleich uns selbst besser verstehen. Gadamer hat das Gespräch als die eigentliche Grundform des Verstehens angenommen. Wie ich glaube, habe ich darüber schon einiges gesagt: in einer Podiumsdiskussion zu Gadamer, fünfzig Jahre nach „Wahrheit und Methode“, die in einem von Carsten Dutt herausgegebenen Band erschienen ist. Darin sage ich einiges über das Gespräch, wie es Gadamer gedacht und wirklich praktiziert hat. Gadamer hat dieses geschichtliche Gespräch durchaus auch im Sinn, er modelliert es aber doch ganz nach dem spontanen Gespräch zwischen Menschen in seinem gedankenbildenden Wechselbezug.
Über das, was ein Gespräch bedeuten kann, sagt Hölderlins „Andenken“ Gewichtiges: „Nicht ist es gut, / Seellos von sterblichen / Gedanken zu sein. Doch gut / Ist ein Gespräch und zu sagen / Des Herzens Meinung“. Also: „Seellos von sterblichen Gedanken“, das bedeutet, sich mit den Sorgen des hinfälligen Lebens und in Gedanken an seine Begrenztheit zu beunruhigen und sich dabei etwa schließlich gar selbst zu verlieren. Aber ein Gespräch wäre gut, in dem „des Herzens Meinung“ zum Ausdruck kommen kann, in dem also das, was ich für mich selbst eigentlich bin und was letztlich für mich gilt, allererst klar heraustritt. „Des Herzens Meinung“, also der tiefsten Überzeugungen, kann man gar nicht für sich allein ganz sicher sein. Man muss sie in vertrautem Gespräch zu einem anderen aussprechen. Wie ich denke, würde das sowohl Hölderlin wie Gadamer entsprechen und meiner ganz persönlichen Erfahrung mit ihm. Heidegger insofern auch, aber Heidegger hat immer diese geschichtsphilosophische Dimension im Sinn, die dann doch monologisch und unterweisend wird. Heidegger konnte im Grunde nicht Gespräche führen, weil er immer belehrend war oder weil er auf alles neumachende eigene Worte setzte. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm gegenüber gerecht bleibe. Doch es gab eine Veranstaltung, die „Theologischer Arbeitskreis Alte Marburger“ hieß. Das waren Schüler von Bultmann, die sich einmal im Jahr irgendwo trafen, und ich war dazu eingeladen, weil mich dort ein Freund hineingezogen hatte. Da waren meist Theologen, und auch Heidegger: der späte Heidegger. Selbst Bultmann konnte sich mit ihm kaum noch wirklich verständigen. In Heidegger schien mir immer das Motiv wirksam zu sein, er müsse vor einem Auditorium eine Konversion bewirken, eine Wendung evozieren, was doch eigentlich etwas sehr Autistisches und was gerade nicht Voraussetzung für ein Gespräch ist. Nun gut, das, was er dann philosophierend mit der Verständigung über die frühen Griechen in Gang gesetzt hat, ist schon als eine Art von Gespräch ernst zu nehmen. Er hatte Fragen aufgebracht, die aber wohl anders beantwortet werden müssen. Ich weiß nicht, ob Sie Michael Theunissen kennen.
Michael Theunissen kenne ich. Zu ihm gelangt bin ich über den Brief, den er in der Zeit seiner Habilitation Martin Buber hat zukommen lassen.
Ich war an seiner Habilitation in Berlin beteiligt. Ich bin der Patenonkel seiner Tochter. Neben Tugendhat ist Theunissen der andere meiner Generation, an dessen Arbeit ich immer Anteil genommen habe. Mit Theunissen bin ich sogar wirklich befreundet. Er hat ein Buch über den Lyriker Pindar geschrieben, das sein Spätwerk wurde. Es ist ein ernst zu nehmendes Konkurrenzunternehmen zu Heideggers Verständigung über die frühen Griechen. Theunissen hat auch die tiefgehendsten Analysen zu der Bedeutung ‚des Anderen‘ für die Konstitution unseres Lebens ausgearbeitet. Das Gespräch hatte darin einen prominenten Platz. So versteht sich seine Korrespondenz mit Martin Buber, dessen Lehre vom ‚Du‘ er gegen alle bekannteren Philosophen stark machte. Es macht mich sehr traurig, dass Theunissen seit Jahren nicht für mich zu erreichen ist – und für niemanden. Er hat sich ganz in sein Krankenlager zurückgezogen und lässt alle Versuche, ihn zu erreichen, ins Leere gehen. Der Widerspruch zu seinen philosophischen Lehren ist offenbar. Ich weiß nicht, ob sich seine Überzeugungen auflösen oder ob sie ihm in einer höheren Kontemplation aufgegangen sind.
Auch das, ein solcher Abschied, ist eine wirkliche Erfahrung im Alter. Sie brauchen sie hoffentlich noch nicht zu machen. Auch auf Sie kommt dies einmal zu. Aber jetzt haben Sie andere Aufgaben, in denen Sie sich bewahren und bewähren müssen.
Das Gespräch führte Alexandru Bulucz
Auszug aus: Alexandru Bulucz (Hg.), Dieter Henrich, »Sterbliche Gedanken«
© Edition Faust, Frankfurt am Main 2014
Letzte Änderung: 18.12.2022
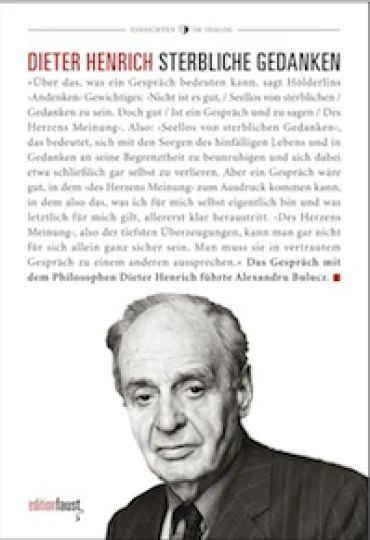
Dieter Henrich Sterbliche Gedanken
Alexandru Bulucz (Hg.)
Der Philosoph Dieter Henrich im Gespräch mit Alexandru Bulucz
Broschiert, 64 Seiten
ISBN 978-3-945400-10-4
Edition Faust, Frankfurt am Main, 2014
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


