Es ist etwas geblieben
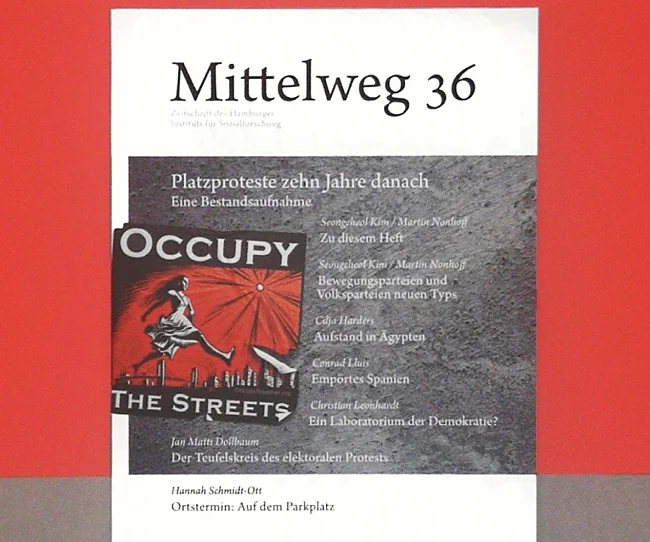
Vom Ägyptischen Frühling bis zur Besetzung des Majdan – die Proteste, die vor zehn Jahren auf öffentlichen Plätzen für demokratische Reformen laut wurden und manchmal dort auch neue Formen politischen Verhaltens vorführen ließen, sind Geschichte. Was davon geblieben ist, ist in „Mittelweg 36“, der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, nachzulesen. Jutta Roitsch nahm Einblicke in die neuen Studien.
Vom Tahrir Platz bis zum Majdan: Platzproteste zehn Jahre danach
Die Namen haben sich ins Gedächtnis eingegraben: Tahrir, Gezi, Syntagma, Zuccotti oder Majdan. Zwischen 2011 und 2014 besetzten erst kleinere, dann immer größere Gruppen von Menschen zentrale, öffentliche Plätze und protestierten gegen korrupte Machthaber und kriminelle Banker, gegen gefälschte Wahlen, für demokratische Beteiligung, Brot und Würde. Gerade ein Jahrzehnt ist dieser oft als „Siegeszug der Demokratisierung“ gefeierte Aufbruch, im Nahen Osten auch „arabischer Frühling“ genannt, her. Ist etwas geblieben? Gibt es ein Nachleben oder eher ein autoritäres und gewaltsames Nachbeben, in dem Militärs und Diktatoren jede demokratische Bewegung ersticken? Gibt es einen radikaldemokratischen linken Populismus, der die repräsentativen, parlamentarischen Demokratien erschüttert? In der jüngsten Ausgabe (August/September) gibt „Mittelweg 36“, die Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, anregend-ungewohnte und nachdenkenswerte Einblicke in jüngste Studien über die „Platzproteste“ (movements of the squares). Die Forschungsreisen führen nach Ägypten und in die USA, nach Barcelona, Madrid, Moskau und Minsk.
Der Tahrir Platz
Eine „etwas andere Bilanz“ zieht Cilja Harders, Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, für Ägypten, obwohl sich die Hoffnung, „dass friedlicher Wandel auch unter repressivsten Bedingungen möglich ist“, schnell zerschlagen habe. Für Harders ist angesichts der „Re-Autokratisierung“ in Ägypten, Krieg und Gewalt in Syrien und Libyen, aber auch angesichts der „tödlichen europäischen Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge“ von der „damaligen Euphorie heute nur noch wenig geblieben“. Und dennoch zeichnet sie mit ihrer „Staatsanalyse von unten“, mit der sie sich von einer „eher eliteorientierte(n) Politikwissenschaft“ deutlich absetzt, das Bild einer ägyptischen Gesellschaft, die seit den Ereignissen auf dem Tahrir Platz eine andere geworden sei. Zu den „wichtigen, aber derzeit wissenschaftlich und medial wenig beachteten Ergebnissen der Proteste seit 2011“ zählt sie die Überwindung der Angst vor staatlicher Gewalt, das neue Gefühl bürgerschaftlicher Ermächtigung, das Hinterfragen alter politischer Loyalitäten. Ihren Ansatz der „Emotions-und Affektforschung“ verteidigt Harders mit vielen Beispielen aus ihren Studien vor Ort. Jenseits der „Großereignisse“ seien auf lokaler Ebene, also „von unten“, Jugendgruppen, Nachbarschaftskomitees, Kunstgalerien, Parteien entstanden: Erst nach dem Putsch der Generäle gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi (2016) und den verschärft repressiven Zeiten hätten sich die politisch und gesellschaftlich engagierten Menschen zurückgezogen.
Dennoch: Die Proteste auf dem Tahrir Platz, der inzwischen umgestaltet wurde, könnten nicht ungeschehen, genauso wenig könnten sie „ungefühlt“ gemacht werden. Wohin die Erfahrungen führen werden und ob die Bewegung für „Brot, Freiheit, Würde und soziale Gerechtigkeit“ angesichts der nach wie vor ungelösten Probleme wieder aufflammen könnte, lässt Harders offen. Sie hofft auf eine „untergründige“ Wirkung der Erinnerung an den Aufbruch.
Der Zuccotti Park
Die wissenschaftliche Reise führt weiter auf den Zuccotti Platz in New York, auf dem im Sommer 2011 die US-amerikanische, kapitalismuskritische Bewegung Occupy Wall Street für wenige Monate ein Camp errichtete und mit einer General Assembly eine demokratische Basisbeteiligung einübte. Hängengeblieben sind die Bilder von den Versammelten, die bei Zustimmung mit den Händen wedelten. Diese Geste verbreitete sich nach London oder Frankfurt am Main wie der Slogan „We are the 99%“. Christian Leonhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Interkulturelle und Internationale Studien der Universität Bremen, setzt sich in seinem Beitrag „Ein Laboratorium der Demokratie?“ mit dem Nachleben von Occupy in der amerikanischen Innenpolitik und mit der demokratietheoretischen Kritik auseinander, wie sie die in England lehrende belgische Marxistin Chantal Mouffe am schärfsten formuliert hat. Handelte es sich bei Occupy „einfach nur um ein paar Weltverbesserer, die in einem ereignisarmen Spätsommer etwas zu viel Medienaufmerksamkeit bekamen“, fragt Leonhardt, schließlich habe der damalige US-Präsident Barack Obama die Bewegung „ebenso konsequent wie erfolgreich“ ignoriert. Von den Konservativen bis Libertären ganz zu schweigen.
Leonhardt zieht seinerseits andere Schlüsse: Er sieht Nachwirkungen bei linken Demokraten wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, aber auch Verbindungen zur Black Lives Matter-Bewegung, die die mehrheitlich weiße Occupy-Bewegung stärker unterstützt hätte als die Durchschnittsbevölkerung in den USA. Und er verteidigt den Versuch der Camper im Zuccotti Park, neue Formen des demokratischen Miteinanders zu erproben, gegen Chantal Mouffe, die Occupy Unfähigkeit vorgeworfen habe, konkrete politische Forderungen zu stellen, und sich geweigert habe, sich mit den Institutionen der repräsentativen Demokratie auseinander zu setzen. Leonhardt bezieht sich auf den kämpferischen Essay der Autorin „Für einen linken Populismus“. Darin verlangt sie von Bewegungen wie Occupy die „Errichtung einer politischen Frontlinie zwischen ‚dem Volk’ und ‚der Oligarchie’“. (Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus, Berlin, 3.Auflage 2020, S. 16 und 30.) Nur in organisierten politischen Bewegungen mit einer starken Führungsfigur sieht sie Chancen, Demokratie in radikaler Form zurück zu erobern. Sie setzt vor allem auf die „Indignados“(Empörte) in Spanien (und auf Jean-Luc Mélenchon mit den „Unbeugsamen“ in Frankreich, aber das ist leider keine Station auf dieser Forschungsreise im „Mittelweg 36“).
Plaça de Catalunya
Conrad Lluis, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen, nähert sich in „Empörtes Spanien“ den „verhärteten akademischen wie politischen Fronten“. Die Frage: gesellschaftliche Bewegung oder linkspopulistische Partei (Podemos ab 2014) spaltete die wissenschaftliche wie politische Zunft (sie erinnerte in vielem an die hitzigen Diskussionen rund um das „Sozialistische Büro“ in Offenbach vor der Parteigründung der „Grünen“ Ende der 1970er Jahre). Lluis schreibt sich selbst in eine „junge Forschungslinie“ ein, „die mit mehr Distanz“ auf diese brisante Zeit zurückblickt. Dies gelingt ihm eindrücklich, zumal sich die beiden charismatischen „Führungsfiguren“ (im Sinne Chantal Mouffes), die Politikwissenschaftler Inigo Errejón und Pablo Iglesias, auf die sich bisher Kritik oder Begeisterung konzentrierten, aus „Podemos“ oder der Politik überhaupt zurückgezogen haben.
Lluis geht zurück auf den Hauptplatz von Barcelona, die Plaça de Catalunya. Aus den rund 150 Menschen, die am ersten Abend im Mai 2011 mit Isomatten und Schlafsäcken auf dem zentralen Platz campierten, wurden Tausende, die sich täglich in einer Hauptversammlung trafen, Kommissionen bildeten und das praktische Alltagsleben auf dem Platz organisierten von der Essensausgabe bis zur Müllbeseitigung. Eine Fundgrube für den Wissenschaftler Lluis sind „die meist sehr detaillierten Verlaufsprotokolle“, die die Indignados in der Anfangsphase anfertigten. Darin gehe es weniger um bedeutungsschwangere Neufassungen von Demokratie oder Gleichheit, auch nicht um die ständige Beschwörung von Feindbildern wie „die Eliten“ oder „die von oben“. Zwar habe sich der Protest sehr klar gegen die Privilegien der Politiker, der Reichen und der Bankerinnen und Banker (Forderungskatalog vom 22. Mai 2011) gerichtet, das eigentliche Anliegen der Indignados aber sei ein gesellschaftliches: die Schaffung und das Vorleben einer neuen „Wir-Identität“ in arbeitsteiligen, solidarischen und direktdemokratischen Formen. „Für einen kurzen historischen Augenblick verwirklicht sich in den Versammlungen auf den Plätzen jene Ordnung, die die Versammelten für die Gesellschaft als Ganzes anstreben“, schreibt Lluis.
Kaum herausgefordert sahen sich allerdings die herrschenden Parteien in Spanien durch die Platzproteste. Erst Podemos („Wir können“), drei Jahre nach den Protesten gegründet durch die beiden Politikwissenschaftler Iglesias und Errejón, löste eine Bewegung von unten aus, die die neue Partei ins Europaparlament trug, in die Rathäuser von Barcelona und Madrid und schließlich in eine Minderheitsregierung unter dem Sozialdemokraten Pedro Sanchez.
Den euphorischen Aufstieg dieser linkspopulistischen Partei begleitet Lluis eher skeptisch. Die Menschen, die damals zu Podemos strömten, hätten eine Partei neuen Typs gewollt, eine basisdemokratische Organisation wie auf der Plaça de Catalunya. Die Parteiführung aber habe dieses Bedürfnis unterschätzt. „Der Versuch der Podemos-Partei, Spaniens Empörungsstimmung mittels eines linkspopulistischen Projekts zu einer Regierungsmehrheit zu verdichten, scheiterte,“ urteilt Lluis. Darüber sei sich die Forschung mittlerweile einig. Dabei werde aber kaum gefragt, „wie man die selbstbestimmten radikaldemokratischen Praktiken konkret in Parteiform hätte realisieren können.“ Diese Frage, die vor vierzig Jahren schon die „Grünen“ in ihren Gründerjahren umgetrieben hat, bleibt weiterhin offen wie auch das längerfristige Nachleben der Empörungsjahre in Spanien.
Plätze in Moskau und Minsk
Die letzten Stationen der Forschungsreise führen nach Moskau und Minsk. Jan Matti Dollbaum, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt der Universität Bremen, ordnet die Bewegung „Für faire Wahlen“ in Moskau (2011 bis 2013) und die Bewegung gegen Wahlfälschungen und Polizeigewalt in der belarussischen Hauptstadt Minsk (2020/2021) ein, vergleicht ob Vergleiche mit den Empörten oder Occupy möglich sind. Sein Urteil fällt ernüchternd aus: Zwar prägten auch die Proteste in Moskau ein tiefes Misstrauen gegenüber der Politik und der Regierungspartei „der Gauner und Diebe“ (so Alexej Nawalny), aber die Empörung richtete sich gegen die Missachtung formaler Spielregeln bei Wahlen. „Es war zunächst keine Forderung nach partizipativer und deliberativer Demokratie, die die Protestierenden zusammenführte, sondern der Wunsch nach Verwirklichung genau der repräsentativen Demokratie, der die Platzbewegungen in Westeuropa und den USA so skeptisch gegenüberstanden“, schreibt Dollbaum. Auch die geringe Beteiligung der Russen erwähnt er: Bei einer Bevölkerung von 143 Millionen habe die Beteiligung an den Protesten „Für faire Wahlen“ im Promillebereich gelegen. Im Gegensatz dazu zitiert der Autor repräsentative Umfragen in Belarus, dass sich zehn bis 15 Prozent der Befragten an den Protesten beteiligt hätten. Ein irgendwie „untergründiges“ (Cilja Harders) Nachleben erstickten beide Regime mit Inhaftierungen, Einschüchterungen, Zerstörung zivilgesellschaftlicher Strukturen, Vertreibungen und massiver Gewalt. Die Regierungen in Moskau und Minsk hätten „deutlich gemacht, dass Protestbewegungen, die grundsätzlich Fragen der Machtverteilung und -ausübung stellen, keine Zukunft haben.“ In beiden Fällen seien die bleibenden Folgen der Protestbewegung „auf lokalen Aktivismus und ein Netzwerk aus Exil-Oppositionellen begrenzt“.
Ein ebenso nüchternes wie bitteres Ende einer Forschungsreise, die Martin Nonhoff, Bremer Professor für Politische Theorie, zusammen mit seinem Mitarbeiter Seong-cheol Kim für die Zeitschrift organisierte und mit grundsätzlichen Überlegungen zu „Volksparteien neuen Typs“ und einer vertieften Auseinandersetzung mit Chantal Mouffe ergänzte. Die Einblicke, die diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihre Forschungen geben, bereiten nicht nur selten gewordenes, politikwissenschaftliches Vergnügen, sondern verhelfen auch zu neuen Erkenntnissen.
Letzte Änderung: 12.09.2022 | Erstellt am: 12.09.2022
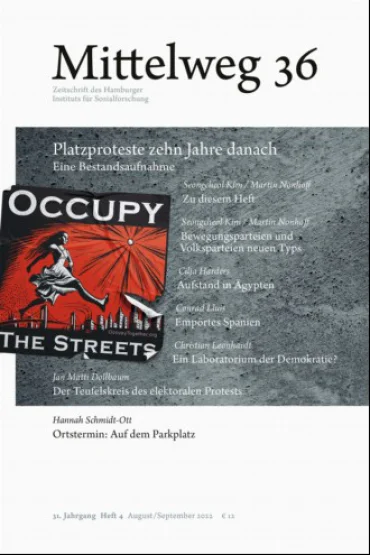
Heft 4 August/September 2022
Platzproteste zehn Jahre danach. Eine Bestandsaufnahme
96 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-86854-767-2


