Wissen über Feuer
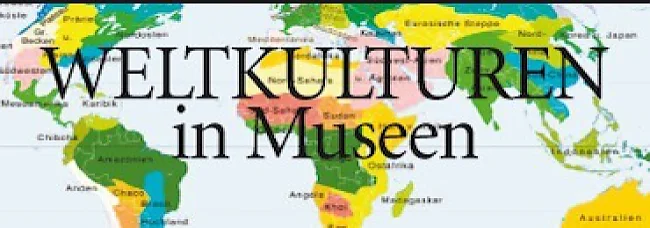
Das Völkerkundemuseum der Universität Zürich ist eine Besonderheit. Es liegt, ganz romantisch, im alten botanischen Garten mitten in der Stadt. Dort können zum einen die Bürger kostenlos hervorragend kuratierte Ausstellungen besichtigen. Zudem ist das Museum auch ein Ort des Lernens und Lehrens. Die Direktorin und Professorin Mareile Flitsch macht das wunschlos glücklich, wie sie im Gespräch mit Clair Lüdenbach gesteht.
Interview mit Dr. Mareile Flitsch, Professorin für Ethnologie und Direktorin des Völkerkundemuseums der Universität Zürich
Clair Lüdenbach: Wie entstand diese Ethnographische Sammlung?
Mareile Flitsch: Die Sammlung wurde vor 126 Jahren von Händlern und Geographen in Zürich angelegt. Vor 101 Jahren wurde sie dann der Universität Zürich geschenkt. Seither ist sie eine universitäre Sammlung. Dann wurde sie bestückt mit einer Stelle. Man kann sagen, das Museum wurde um die Sammlung herum aufgebaut, und die Sammlung wurde immer mehr erweitert. Ich glaube, als sie übernommen wurde, waren es etwa 10.000 Objekte, jetzt sind es etwa 40.000. Für ein solches Museum ist das eine ganz ordentliche, überschaubare, aber auch eine sehr gute Sammlung. Sie kommt aus Reisebeständen, aus Expeditionen: Wir haben die Horner-Sammlung von der Weltumsegelung Krusensterns. (1) Wir haben die Namibia-Sammlung von Hans Schinz; er war der Gründer der systematischen Botanik. Wir haben die Nachlässe von Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter – ihre Tibetsammlung, aber auch Harrers Surinam- und Neuguinea-Sammlungen. Das sind Sammlungen, die in der Ethnologiegeschichte recht bekannt sind.
Mein Interesse richtet sich vor allem auf die Wandlungen, die die ethnologischen Museen erfahren haben. Sie haben in vielen Städten lange Zeit ein wenig wahrgenommenes Dasein geführt. Obwohl es große Häuser gab, war das Interesse des Publikums eher bescheiden. Die Erwartung auch an diese Museen, hohe Besucherzahlen vorzuweisen, hat zu einer neuen Museumspolitik geführt. Spüren Sie auch diesen Druck? Agieren Sie anders als früher?
Alles was Sie beschreiben, trifft auf uns nicht zu. Zum einen sind wir ein kleines Haus, das sieht man schon an der Sammlung. Die Schweizer Museen haben auch eine etwas andere Publikums-Wahrnehmungsgeschichte als die in Deutschland. Aber hier ist ein Ort, der mit den anderen Museen gar nicht vergleichbar ist. Wir unterscheiden uns in einem Punkt ganz grundlegend von den großen Museen: Wir zählen zwar Besucher, weil es uns interessiert, aber wir nehmen keinen Eintritt. Das heißt, wir haben den Druck überhaupt nicht. Ich könnte eine Ausstellung machen, zu der wenige, aber ausgesuchte Besucher kämen, die sich genau für dieses Thema interessieren. Das ist möglich. Wir streben auch an, dass uns viele Menschen wahrnehmen, aber die Publikumsorientierung hat sich nun nicht grundlegend geändert. Ich denke auch, dass das ein Problem vieler Museen ist: Wenn man Besucher zählen muss und auf Einnahmen aus dem Besuchereintritt angewiesen ist, ist man im Hinblick auf die Ausstellungen auch gebunden. Das sind wir nicht.
Und die Selbstdarstellung, wie verändert die sich?
Wir haben eine 126-jährige Geschichte mit sieben Direktionen. Viele davon hatten sehr lange Amtszeiten. Während dieser Direktionen hat jeder Direktor, und ich bin die erste Frau in dieser Riege, ein eigenes Profil entwickelt. Das bildet sich auch in der Sammlung ab. Das ist natürlich interessant, so etwas wissenschaftshistorisch nachzuvollziehen. Das bildet sich dann in Ausstellungen ab, in Veranstaltungen und so weiter. Ich wüsste gar nicht – man hat ja die Besucher nicht immer gezählt – wie die Besucherzahlen meiner Vorgänger wirklich waren. Was ich aber sagen kann ist, dass innerhalb der Universität Zürich und innerhalb der Wissenschaftslandschaft der Schweiz unsere Sammlung eine ganz eigene Bedeutung hat. Bei solchen spezialisierten Museen ist natürlich auch nicht die Zahl der Besucher maßgebend für Qualität. Das Völkerkundemuseum der Universität Zürich ist ein wissenschaftliches Lehr- und Forschungsmuseum und an einen Lehrstuhl für Ethnologie gebunden. Gleichzeitig ist die Ethnologin die Direktorin des Museums. Natürlich war mit dem Amtswechsel – mein Vorgänger war Michael Oppitz – eine Neuausrichtung vorbestimmt; das ist bei Dienstwechseln ja immer so. Ob das nun ein neues, wahnsinnig tolles Projekt ist, das mögen andere beurteilen. Aus meiner Sicht wurde ich berufen, weil ich ein bestimmtes Profil habe und weil die Universität wollte, dass dieses Profil für eine Amtszeit zum Tragen kommt, einfach als Entfaltungsmöglichkeit. Regional vertrete ich die Ethnologie Chinas, thematisch den Schwerpunkt Technikethnologie, was zu einem Museum wie diesem sicherlich passt. Das kann ich nun in einem Zeitraum von 19 Jahren einmal umsetzen, in Lehre, Sammlung, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Die Forschung steht also im Mittelpunkt, und das eine greift ins andere über.
Das ist eine Einheit. Wir sind ein Haus mit dreißig Mitarbeitern. Davon sind fünf Kuratierende und dazu noch ich. Also sechs Wissenschaftler und drei Assistierende. Und die weiteren Mitarbeitenden sind Restaurator/innen, Grafiker, Fotografinnen, Bibliothekarinnen, Ausstellungsdienst und so weiter. Wir sind alle immer mit allem beschäftigt. Das heißt, wir machen grundständige Lehre in den Bereichen Museologie, materielle Kultur, praktisches Wissen. Aus der Lehre ziehen wir Studierende, die wir für besonders talentiert halten, ins Museum hinein. Im Museum machen wir Museumsstrategie: Wir bewahren eine Sammlung, mit Konservierung, Restaurierung bis hin zur Klärung von Provenienz oder allem, was an Fragen ansteht. Dann haben wir im Haus ein eigenes Forschungsprofil. Dieses Forschungsprofil führt dazu, dass wir an unterschiedlichen Publikationen sitzen, unterschiedliche Sammlungsteile bearbeiten, ein Ausstellungsprogramm aufstellen, Studierende betreuen oder eine Sammlung anschaffen, die wir für die Wissenschaft für besonders aussagekräftig halten. Geordnet wird das dadurch, dass wir auf Kontinente verteilt sind. Es gibt eine Amerika-Kuratorin, eine Asien-Kuratorin, einen Kurator für Ozeanien und den islamischen Raum, (2) einen Afrika-Kurator, einen Spezialisten für Museen in Afrika und dann vertrete ich noch China, sozusagen als Domäne der Direktorin. Eigentlich bilden immer Sammlung, Forschung, Lehre und Öffentlichkeit eine Einheit. Wir unterrichten zum Beispiel über Themen, über die wir auch forschen, das ist Lehr-Forschung, und zu denen wir auch Ausstellungen machen. Darum ziehen wir manche Studierende aus dem Unterricht in die Mitarbeit an Ausstellungen. Oder wir bieten Studierenden die Möglichkeit, aus einem „Praxismodul Museum“, an dem alle Wissenschaftler, alle Mitarbeiter mitwirken und in dem sie den Studierenden theoretisch und praktisch vermitteln, was dieses Museum ausmacht, professionell gestützt mit jungen Ideen eine eigene Ausstellung zu entwickeln.
Wie setzen sie das um? Sie sind wahrscheinlich auf den Bestand des Museums angewiesen?
Nicht ausschließlich. Unsere Sammlungen haben ein bestimmtes Alter; viele Teile sind noch nicht erschlossen. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit damit, Sammlungsteile zu erschließen oder mit wissenschaftlich relevanten Fragestellungen an die Sammlung heranzugehen, und dann eben Grundlagenforschung zu machen. Wir müssen aber nicht nur über die eigene Sammlung forschen. Wobei ich allerdings sagen muss, dass die schon interessant genug ist. Wir haben noch ein paar Jahrzehnte vor uns, bis wir wirklich wissen, was alles in den Sammlungen ist. Im Moment bereiten wir zum Beispiel die Ausstellung „Drahtspielzeuge Afrikas“ vor. Da haben wir die Sammlung für die Ausstellung erworben. Wir möchten sie gerne ausgehend von einer bestimmten Fragestellung bearbeiten und ausstellen. Dafür haben wir von der Universität und von Stiftungen Mittel eingeworben. Auch aus unserem Etat fließen da Mittel ein. Wir haben ein Gesamtbudget, wobei das Museum entscheidet, wie das, über das Jahr verteilt, ausgegeben wird. Wir können zum Beispiel Teile des Gesamtbudgets für den Ankauf einer Sammlung verwenden.
Diese Sammlung ist nur für dieses Museum erworben?
Diese ist nur für das Museum erworben worden, um diese Ausstellung zu machen und natürlich um sie zu bewahren. Wir haben auch die Aufgabe, wichtiges Kulturgut zu verwahren und zu erhalten. Mittlerweile sind wir eine Kulturgüterschutzsammlung der Kategorie A des Kantons Zürich. Der Wert unserer Sammlung ist durchaus anerkannt. Wir erweitern sie strategisch um das, wovon wir denken, dass es bewahrt werden sollte und dass man es zeigen sollte.
Sie erwähnten, dass Ihr Spezialgebiet Technikethnologie ist. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt ein Fachgebiet, das heißt im Deutschen „Technikethnologie“. Dazu würde man im Englischen „anthropology of skilled practice“, oder im Französischen „anthropologie des savoirs-faire“ sagen. Das macht vielleicht etwas deutlicher, dass die Bezüge weiter gefasst sind.
Da ist das Handwerkliche mit drin.
Wir beschäftigen uns mit dem praktisch handelnden Menschen in all seinen Dimensionen. Man kann das ganz einfach erklären, indem man sagt: Das, was ich im Kopf als Kultur oder Wissen habe, das übersetze ich mit der Hand in etwas Materielles. Und die Technikethnologie beschäftigt sich eigentlich damit: Was ist überhaupt technisches Wissen? Wie wird etwas erklärt? Wie erklären Leute Materialveränderung, Fermentierung, Transformation von irgend etwas, das Altern von Material? Da gibt es nicht nur westlich-wissenschaftliche Erklärungsmuster, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, das zu erklären. Mit technischem Wissen beschäftigen wir uns, aber es ist immer eine bestimmte Gesellschaft, die sich einer Technik oder eines Materials bedient und die sich darin quasi abbildet. Solche Gesellschaften haben Weltanschauungen, die auch eine Rolle spielen. Wir versuchen, wenigstens in dieser Dreiheit – und da kommen ja noch Ästhetik, Empfinden, Haptik, Körpertechniken und was auch immer dazu – in einem ganzheitlichen Ansatz, praktisches Handeln in Gesellschaften zu untersuchen. Eigentlich erscheint es seltsam: Die Museen sind voller Objekte, aber was macht man eigentlich für eine Objektforschung? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir aus westlichen Kulturen in Regionen der Welt gehen und uns dabei mit allen möglichen Themen beschäftigen. Selten fragen wir: Was beschäftigt die Leute eigentlich selbst? Mein Schlüsselerlebnis war – ich habe über Bauern in Nordostchina geforscht – als ich eine Bäuerin nach ihrem Verhältnis zur Schwiegermutter befragte und die Bäuerin überlegte, ob das Feuerholz reichte, um mir eine Mahlzeit zu kochen. Sie war die ganze Zeit auch mit dem Feuermachen beschäftigt und anderem. Da wurde mir so klar: Das passt so gar nicht zusammen. In dem Moment, in dem ich mich mit der Frau über ihr Wissen über Feuer unterhalten habe, Feuermachen, Garen, da habe ich festgestellt, dass das Dimensionen sind, mit denen wir uns viel zu wenig beschäftigt haben. Da war für mich klar, als ich nach Zürich kam, das wäre etwas für dieses Haus oder vielleicht auch in der Ethnologie. Was macht man also mit einer Sammlung von Ethnographica, die man ja auch bewahren muss, konservieren usw., und in die ja auch Gelder fließen? Man sollte sie als eine Sammlung von Wissen anschauen und immer wieder auf neue Weise befragen: Was ist darin an Wissen bewahrt, das wir möglicherweise noch gar nicht kennen, worüber wir uns noch keine Gedanken gemacht haben? Das wäre so ein Schwerpunkt auf Kennerschaft, auf „skill“.
Gibt es hier auch die Fragestellung, dass all das, was in diesem Museum aus der Kolonialgeschichte stammt, Vergangenes ist und dass man sich mit der heutigen Zeit beschäftigen muss?
Die Schweiz hat ja bekanntlich keine unmittelbare Kolonialgeschichte, wiewohl viele Sammlungen, wie z.B. die Sammlung Schinz – sie wurde mit der Lüderitz-Sammlung zusammengetragen – durchaus eine koloniale Geschichte haben. Insofern kann man nicht sagen, dass es da keine Berührungspunkte gebe. Man kann ja sozusagen Menschheitsgeschichte als Fortschrittsgeschichte schreiben. Dann schaut man immer, was das Modernste ist. Man kann aber auch Fortschritt als eine Verlustgeschichte verstehen. Und es lohnt sich immer wieder zurückzuschauen: Was war denn da? Man muss wissen, dass unsere Sammlungen von manchen Leuten als älter wahrgenommen werden, als sie sind. Für Technikethnologen ist von der Steinzeit bis heute alles interessant, wenn man die richtige Fragestellung dazu hat. In der Frage, was konnte, was kann der Mensch, spielt das Alter der Sammlung für mich überhaupt keine Rolle. Die Schöninger Speere (3) oder der Ötzi, die zeigen uns ja, dass wir noch längst nicht alles kennen. Für Wissenschaftler ist das Alter höchstens eine analytische Frage. Aber die Verlustgeschichte, also die Frage: Kennen wir eigentlich Gesellschaften aus dem Moment heraus, an dem gesammelt wurde? Oder haben wir Zeugnisse von Gesellschaften, die wir überhaupt noch nicht angeschaut haben? Das ist eigentlich die interessantere Frage! Wir sammeln überhaupt nicht nach alt oder neu, sondern alles, was einen Erkenntniswert hat. Die Drahtspielzeugsammlung, die wir gerade angeschafft haben, das ist so eine Sammlung. Da haben in den siebziger Jahren, nach unserer Lesart, Afrikaner nicht mit Müll oder Resten gebastelt, sondern afrikanische Kinder und Jugendliche haben innovatives Material, das sie bis dahin vielleicht noch nicht kannten oder nicht zur Verfügung hatten, verwendet, um die Moderne darzustellen: Flugzeuge, Hubschrauber, Autos, schicke Sportwagen, moderne Technik. Das sammeln wir natürlich, das hat einen Erkenntniswert. Was man heute auf dem Markt an afrikanischem Drahtspielzeug findet, das ist etwas völlig anderes. Und das werden wir in der Ausstellung zeigen. Wir haben uns auch schon zum Beispiel mit moderner Keramik beschäftigt, mit allem. Museen wie unseres stellen relevante Fragen und sammeln dazu, was man braucht, um dieses Wissen abzubilden.
Haben Sie besondere Wünsche für dieses Museum?
Wir haben relativ komfortable Bedingungen, um uns auf immer neue Weise zu präsentieren, als Fenster der Wissenschaft, in unserem Fall der Ethnologie, zur Öffentlichkeit. Etwas Schöneres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich möchte auch nicht größer werden oder bedeutender. Ich möchte ein Zeichen setzen: Der Mensch kann etwas und das, also sein Können, möchte ich immer wieder aus neuer Perspektive betrachten. Mir erscheint die Darstellung des Menschen häufig zu klein, als könnten sie nichts, als wären sie unfähig. Guckt man genauer hin, dann stellt man fest, die Gesellschaften der Welt schlagen sich tapfer. Dem eine Stimme zu geben, auf immer neue Weise, das erscheint mir in der heutigen Zeit wichtig. Ich würde dieses Modell, so wie es ist, an einem Lehr- und Forschungsmuseum Ethnologie immer wieder neu erfinden und bin frei darin, zu sagen: Das muss das Publikum jetzt mal schlucken. Das möchte ich einem Publikum jetzt mal zeigen, zum Beispiel: Wie erlernt man eine neue Harfenart? Wie kommunizieren Leute über weite Strecken? Wie erwerben Kinder Wissen, um als Erwachsene zu bestehen? Was macht es aus, Irokese zu sein, in der Moderne? Das sollte uns immer wieder umtreiben. Wir sollten auch das politische, ökonomische Weltgeschehen unter diesem Aspekt beobachten und wichtige Beobachtungen als Bildungsangebot an die Öffentlichkeit weitergeben. Was mich hier in der Schweiz schon immer erstaunt hat: Hier gibt es ein Publikum mit einem Interesse an Könnerschaft. Es gibt ein Bewusstsein für diese Verlustgeschichte der Fertigkeiten. Mit dem Handy vergessen wir, uns die Nummern zu merken. Wir leben in einer Welt, in der die haptische, physische, handwerkliche, oder in der Hand liegende Kompetenz gravierend abgebaut wird. Dieses „De-Skilling“ ist ja ein wichtiges Thema unserer Zeit. Das Bewusstsein sprechen wir auf jeden Fall an. Vielen Leuten wird bewusst, dass das, was sie hier beobachten oder lernen, nicht mehr praktiziert wird. Die Themen, die wir angehen, sind natürlich vielfältig.
Wir hatten eine Ausstellung: China töpfert bodennah. Da ging es darum, warum töpfert man in China eigentlich hockend am Boden? Was hat es damit auf sich, dass die Leute womöglich eine Töpferscheibe aus Europa kaufen, ein Loch in den Boden machen, sie versenken und sich dann daran hocken? Da haben wir in der Ausstellung natürlich versucht zu zeigen, was Keramik in China ist. Wir haben Keramikern aus der Schweiz angeboten, selbst einmal auf einer bodennahen Scheibe zu töpfern. Aber wir wollten auch zeigen: Wenn ich irgendwo durch die Welt gehe und sehe einen Menschen, der am Boden hockt, dann sind das nicht Leute, die „noch“ am Boden hocken, sondern das ist eine andere Technik. Das ist eine andere Wahrnehmung der Welt. Man denkt in anderen Winkeln, in anderen Körperhaltungen, in anderen Körperlichkeiten. Das zu zeigen, schafft ja auch ein Bewusstsein für das Anderssein als eine andere Kompetenz.
1 Johann Kaspar Horner (* 1774 in Zürich – † 1834 in Zürich) nahm an der von Adam Johann von Krusenstern (* 1770 in Rapla – † 1864 in Kiltsi), Admiral der Russischen Flotte, geleiteten ersten Weltumsegelungsexpedition 1803 – 1806 teil.
2 Diese Kombination (Ozeanien und islamischer Raum) ist quasi zufällig durch die persönliche Qualifikation der betreffenden Person entstanden und bildet natürlich keine Sinneinheit.
3 Bei den Schöninger Speeren, die 1994-1998 im Braunkohletagebau Schöningen (bei Helmstedt) entdeckt wurden und die bis zu 400.000 Jahre alt sind, handelt es sich um die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt.
Weitere Informationen
Völkerkundemuseum der Universität Zürich
Letzte Änderung: 17.08.2021




Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


