Sobald ein Objekt im Museum ist, ist es etwas Vergangenes
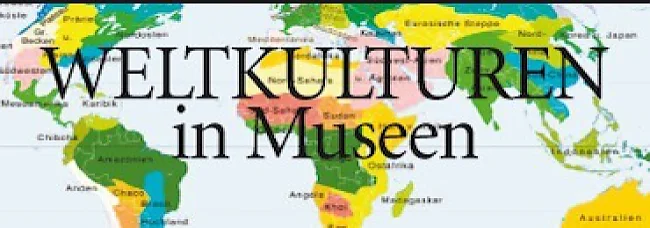
Im Herzen von Basel am Münsterplatz steht das Museum der Kulturen. Es ist ein Häuser-Ensemble aus Fachwerk und Stein mit einem lichten Neubau aus jüngster Zeit, gebaut um das Herzstück, ein 16 m hohes Kulthaus, das Abelamhaus aus Papua-Neuguinea. Der kleine Platz vor dem Museum schmiegt sich wie eine natürliche Arena an den Hang und ist im Sommer ein beliebter Ort zum Verweilen. In den lichten, einladenden Museumsräumen ist viel Platz zum Erkunden, Staunen und Erforschen der Kulturen aus aller Welt. Es wurde schon 1849 gegründet, seither informiert es die Baseler über alles, was die Welt zusammenhält.
Clair Lüdenbach im Gespräch mit Anna Schmid
Lüdenbach: Die ethnologischen Museen haben sich in den letzten Jahren fast alle neu aufgestellt. Warum ist das notwendig?
Schmid: Es erstaunt doch sehr, dass so viele Neubauten, Renovationen und Totalsanierungen in und an ethnologischen Museen stattfinden. Bisher standen vor allem Kunstmuseen im Vordergrund. Die Ethnologie bekam ganz sicher einen enormen Schub durch den Neubau des Musée du quai Branly in Paris. Damals sollte (auch) neu definiert werden, was ethnologische Museen sind und was sie leisten können. Jacques Chirac hatte in Aussicht gestellt, dass sowohl das neue Gebäude als auch seine Inhalte einer Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit verpflichtete seien. Die Erwartungen waren hoch, die Fachwelt hat klar kritisiert, dass dieser Aspekt nicht eingelöst wurde.
Es gibt unter Ethnologen seit geraumer Zeit ein Nachdenken darüber, was solche Museen überhaupt leisten können, was ihr Auftrag sein kann. Es geht darum, vom Althergebrachten wegzukommen, also z.B. nicht mehr “retten, was noch zu retten ist”, nicht mehr zeigen wollen, wie Menschen woanders leben, – damit wird ein lang vorherrschender Anspruch dezidiert in Frage gestellt. Aber was ist ein ethnologisches Museum dann? Es gibt mehrere Versuche, darauf Antworten zu finden. Eine Forderung ist, nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben, sondern die Verbindung zum Hier und Jetzt herzustellen. Es kann nicht mehr die Exotik sein, die wir zeigen, oder gar eine Kulisse, die wir aufbauen und in der man sich bewegen kann. Wir können und wollen auch nicht mit Medien wie dem Dokumentarfilm konkurrieren. Heute reisen viele Menschen, wie nie zuvor. Der Augenschein, das Erleben vor Ort und die eigene Erfahrung werden meistens über alles andere gestellt. Es macht keinen Sinn, so zu tun, als ob wir das vermitteln könnten. Und es stellt sich in der Tat die Frage, ob wir das überhaupt versuchen sollten.
»Was sind zentrale Punkte dabei? Und da ist die Verbindung zum Hier und Jetzt nicht einfach: Was geschieht bei uns im gleichen Segment? Sondern: Wie können wir eigentlich über eigene Lebensfo
Für uns stellte sich bei der Neuausrichtung des Hauses die ganz große Frage: Wie gehen wir es hier an? Wir hatten mit der Erweiterung des Museums die Gelegenheit, uns sozusagen neu zu erfinden. Zentrale Punkte waren die Verbindung zum Hier und Jetzt: Wie gehen wir mit vergleichbaren Situationen um? Wie können wir über eigene Lebensformen, eigene gesellschaftliche Realitäten, reflektieren – im Angesicht des Anderen. Ich denke, dass ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt: das Sich-In-Beziehung-Setzen, um zu sehen, was sich auf die eigene Lebensweise und -erfahrungen übertragen lässt. Wo können wir lernen? Und was gegebenenfalls?
Wir haben fünf Themen ausgewählt, sie sind gewissermaßen das Rückgrat unseres Hauses. Da geht es um Gruppenbildung, um Gemeinschaften. In welche werde ich hinein geboren, welchen schliesse ich mich an und warum? Welche meide ich? Wo werde ich ausgeschlossen? Es geht um Handlungsfähigkeit. Darunter wird das Vermögen eines Menschen verstanden, in Beziehung zu bestehenden Strukturen zu handeln. Jedes Individuum verfügt über Handlungsspielräume, seien diese auch noch so klein. Es geht um Raum. Menschen greifen in den Raum ein, nutzen ihn, verändern ihn, eignen ihn sich an. Wie nimmt man ihn ein? Wie gestaltet man ihn? Was ist gegeben – physisch? Was kann man auch ganz anders machen? Wissen: Was wird zu tradiertem Wissen? Wie wird Wissen als solches überhaupt erkannt und wie wird es in den unterschiedlichsten Bereichen angewendet? Und schließlich Performanz, dabei geht es um das ganze Spektrum von Ritual, Theater, und Spiel – Phänomene und Praktiken, die in allen Kulturen vorkommen.
»Natürlich, das kommt immer mal wieder, oder: neo-kolonial. Wo ich ganz klar sage, wir alle haben Vorurteile, und wir tun gut daran, sie als solche erst einmal anzunehmen, um überhaupt darübe
Es gibt zwei weitere Themen, die genauso essentiell sind wie diese fünf; Zeit und Sprache. Auf diese beiden Themen haben wir bewusst verzichtet. Das Museum ist etwas Visuelles. Sprache ist im Museum in erster Linie ein Hilfsmittel, deswegen sollte sie nicht separat in den Vordergrund gestellt werden. Bei dem Thema Zeit verhält es sich etwas anders: In der Ethnologie wurde lange im Präsenz gedacht und geschrieben; damit wurde anderen Kulturen implizit eine eigenständige Entwicklung abgesprochen. Das kommt einem Festschreiben der Anderen gleich – “bei denen ist das so”, andere Kulturen wurden als statische Gebilde gesehen. Um das zu durchbrechen, müssen wir immer darauf achten, wie wir Zeiten – Präsens, Vergangenheitsformen – in der musealen Arbeit verwenden. Deshalb wurden diese beiden Themen nicht separat angegangen.
Die Schweiz ist ja nie ein Kolonialland gewesen, hatte aber in der Vergangenheit viele weit gereisten Sammler. Spielt das Sammeln und an ein Museum Weitergeben heute noch eine Rolle?
Es spielt nach wie vor eine große Rolle, aber vielleicht sollten wir uns zuerst dem früheren Sammeln zuwenden. In den ethnologischen Sammlungen von Kolonialmächten wie z.B. Deutschland kann man der kolonialen Vergangenheit sehr gut nachspüren. Ozeanien, Papua-Neuguinea, Kaiser-Wilhelm-Land ist in den Sammlungen immer vertreten; ebenso ein bestimmter Teil Afrikas, diese Gebiete sind relativ dominant. Das lässt sich mit der kolonialen Geschichte in Verbindung bringen.
Selbstverständlich hat das Sammeln nach dem Ende der Kolonialzeit nicht aufgehört, die Menschen sammeln immer noch. Und sie treten auch an Museen heran, weil sie Sammlungen schenken oder verkaufen wollen. Die letzte große Sammlung, die in Basel angekauft wurde, war die Tibetsammlung von Gerd Wolfgang Essen. Er hat eine Sammlung von Tibetika zusammengestellt, wobei es ihm darum ging, den tibetischen Buddhismus in seiner umfassenden Ikonographie zu erfassen. Diese Sammlung wurde 1998 gekauft. Das ist eine Sammlung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angelegt wurde. Da herrscht ein anderer Blick, als wenn jemand als Kolonialbeamter irgendwo stationiert war oder in der Folge des Kolonialismus irgendwo hingereist ist, um zu sammeln. Die Tibetsammlung ist systematischer; sie wurde mit einer ganz dezidierten Fragestellung zusammengetragen.
Wie sammeln wir heute? Wir haben eine Sammlungsstrategie erarbeitet, bei der es sehr viel stärker um Begegnungen geht, die im Objekt sichtbar sind. Einer meiner Träume ist, dass wir irgendwann die Ausstellung realisieren, die unter dem Arbeitstitel „Kaurischnecke und Glasperle“ läuft. An diesen beiden Materialien liesse sich besonders gut zeigen, wo Begegnungen stattgefunden haben. Kaurischnecken wurden beispielsweise auch in Kulturen verarbeitet, die ganz sicher keinen Zugang zum Meer, keine Nähe dazu hatten. Glasperlen spielten eine sehr grosse Rolle beim Objekttausch; gerade auch dann, wenn eine Sammlung angelegt werden sollte. Was passierte da eigentlich? Was wurde getauscht? Inwiefern wurden materielle und nicht-materielle Güter getauscht? Welche Rolle spielten verschiedene Sichtweisen auf Dinge, auf das Leben, auf die Welt? Diese Fragen sind bis heute relevant, sowohl in Bezug auf diese Materialien, aber natürlich auch auf andere. Es kommt darauf an, diese Art der Begegnung und ihre Konsequenzen ernst zu nehmen, und dann zu fragen: Was passiert bei einer Übernahme, Adaption, Aneignung? – Das ist das Thema des ethnologischen Museums schlechthin.
Begegnet man in der Schweiz auch schon mal Ressentiments gegenüber dem Erbe aus fernen Kulturen? Wird der Vorwurf, kolonialistisch oder rassistisch zu sein, erhoben?
Natürlich, das kommt immer mal wieder vor, oder auch der Vorwurf, neo-kolonial zu sein. Wir alle haben Vorurteile, und wir tun gut daran, sie zunächst als solche anzunehmen, um überhaupt darüber hinausgehen zu können. Der Mensch ist per se ethnozentrisch.
Sobald ein Objekt im Museum ist, gehört es zur Geschichte, ist es etwas Vergangenes. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch eine Verbindung zur Gegenwart, wenn nicht gar zur Zukunft herstellen kann. Nach Möglichkeit sollten Verbindungen in beide Richtungen möglich sein, wenn auch spekulativ als Andeutung, als Auslegeordnung in Richtung Zukunft. Der Anspruch ist, dass ich es mit mir in Verbindung bringen kann, dass ich im Objekt oder einer Objektgruppe etwas sehe oder gar erkenne. Das kann man als das große Problem, aber auch als unglaubliche Chance des ethnologischen Museums per se sehen.
Basel liegt ja in gewisser Weise an einer Schnittstelle der Kulturen. Die Stadt ist finanzstark. Gibt es hier noch, im Gegensatz zu deutschen Museen, ein Ankaufsetat? Kann man hier noch erweitern und die Kulturen weiter verfolgen?
Wir haben keinen Ankaufsetat. Wir haben ein Globalbudget aus dem alle Betriebskosten bestritten werden müssen. Natürlich sind die Finanzmittel auch hier knapp – zumal angesichts der anstehenden Projekte. Wenn es aber um einen Ankauf geht, lassen sich Geldgeber dafür finden. Das ist der große Unterschied zu Deutschland.
Es gibt also auch ein Privatinteresse an diesem Haus?
Die Tibetsammlung, von der ich eben gesprochen habe, wurde uns von einer einzigen Mäzenin geschenkt. Wohlgemerkt: Gespendet, nicht gesponsert. Das heisst, es wird keine Gegenleistung verlangt, sondern wirklich gespendet. Ich habe in Deutschland immer wieder erlebt, dass viel von Kultur geredet wurde, sie sei wichtig; wenn es aber darum ging, dass sie auch was kostet, gab es oft und relativ schnell einen Rückzieher. Hier ist es ganz anders, und es gibt schon fast ein intrinsisches Interesse an Kulturellem und an Kulturen. Wir haben ein Haus im Haus: das Abelamhaus (16 Meter hohes Kulthaus aus Papua-Neuguinea – Anm. d. Red.). Der Raum wurde für dieses Objekt gebaut. Für mich ist es eine Metapher dafür, was es den Menschen wert ist, ihre Sammlung zu sehen, zu zeigen, zu haben – durchaus auch Besitzerstolz.
Haben Sie noch einen Traum, wie das Museum weiterentwickelt werden könnte?
Ja, wobei der nicht sehr konkret ist. Ich hätte gerne, dass das Museum tatsächlich ein urbaner Treffpunkt wird. Das heißt, dass die Leute bei jeder Ausstellung wissen: “Ich sehe etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Ich kann es einfach nur genießen.” Oder wir schaffen es, dem Publikum immer wieder ein Aha-Erlebnis zu ermöglichen. Ich hätte gern, dass sich das Museum so etabliert – mit jeder Ausstellung ein Stück mehr, oder auch ein Stück anders – , dass man sich hier trifft, um neue Argumente zu erfahren oder in Diskussionen zu hören. Und wenn jemand nicht weiss, was zu Weihnachten schenken, werden sie in unserem Shop ganz sicher fündig. Ein Museum ist nicht mehr ein Ort, an dem man still verharren muss. Es ist ein lebendiger, sich ständig wandelnder Ort. Dies in allem zu spüren, das ist mein Traum.
Letzte Änderung: 17.08.2021






Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


