Große Zukunft
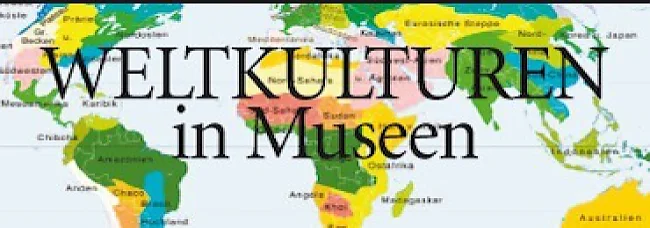
Ein Reisspeicher aus Sulawesi empfängt den Besucher im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum. Dieser schiffsähnliche Bau auf Stelzen ist das größte Exponat der Kölner Sammlung. Er weckt Neugier auf die vielen tausend Objekte aus aller Welt, die sich hinter diesem großartigen Entree verbergen. Erster Sammler war Wilhelm Joest. Der wohlhabende Zuckerfabrikant hatte Naturwissenschaften studiert. Angesteckt vom Entdeckergeist vieler Kollegen seiner Zeit, begab er sich im Jahre 1874 auf die erste Bildungsreise. In den folgenden zwei Jahrzehnten legte er mit seinen „Reisemitbringseln“ den Grundstein für das nach ihm benannte Museum. Als er mit 45 Jahren starb, vermachte er die Sammlung seiner Schwester Adele Rautenstrauch. 1901 übergab sie die umfangreiche Sammlung ihrer Heimatstadt Köln, die dann das nach den Geschwistern benannte Museum gründete. Heute leitet Prof. Klaus Schneider das schöne Haus am Kölner Neumarkt.
Clair Lüdenbach im Gespräch mit Prof. Klaus Schneider

Clair Lüdenbach: Das Rautenstrauch-Joest-Museum ist in ein neues Haus gezogen und präsentiert sich ganz neu. Worauf kam es Ihnen bei der Neugestaltung an?
Klaus Schneider: Diese Neuaufstellung hat bei uns schon eine längere Vorgeschichte. Am alten Standort am Ubierring hatten wir schon in den 90er Jahren sehr intensiv überlegt, wie wir eine neue Präsentation auf die Beine bekommen. Und ich bin seit 1996 da, und da kam ich in diesen Prozess rein. Das kam dadurch, dass damals schon etwas ganz Neues im Vergleich mit deutschen und europäischen Museen gemacht wurde, nämlich der Ansatz ‚Kulturvergleichende Ausstellungen’. Dieser ‚Kulturvergleichende Ansatz’ sollte auch damals schon im Altbau in einer Dauerausstellung münden. Das war das ganz Neue. In Sonderausstellungen hatte man das auch immer schon anderswo gemacht. Nach der Entscheidung der Stadt, einen Neubau zu realisieren, – was in der Situation in Köln für uns durchaus ein Glücksfall war, dass man so etwas groß anpacken konnte – gingen wir von vornherein in die Planung. Wir versuchten, die Dauerausstellung für ein erweitertes Publikum, was wir uns dadurch erhofften, mit diesem Ansatz zu erreichen. Wir sind davon ausgegangen: Unsere eigene Kultur ist unser Ausgangspunkt. Diese Einbindung in unsere eigene Kultur und unseres eigenen Standpunktes, unseres eigenen Daseins, das haben wir dann versucht, in unseren einzelnen Themen, die wir dann ausgesucht haben, als Ausgangspunkt zu nehmen. Das war auch etwas ganz Neues. Denn ich würde sagen, der wichtigste Kernsatz dessen, was wir machen wollen, ist: Grundsätzlich wollen wir nicht Unterschiede der Kulturen zeigen. Vor allem wollten wir erreichen, dass alle Kulturen in ihrer Weise gleichwertige Kulturen sind, und nicht, wie die Völkerkunde-Museen es früher gerne gemacht haben, und zum Teil heute auch noch machen, dass man diese Wertigkeit bemerkt. Das wollten wir umdrehen. Nur so, haben wir uns damals gedacht, schaffen wir es, aus Köln heraus ein Publikum zu erreichen, was bis dato nie im alten Haus am Ubierring war. Und das hat sich auch nach der Eröffnung und auch jetzt – im normalen Betrieb, wenn man so will – gezeigt.
Die Ausstellungspräsentation hat ja auch etwas mit den Sammlungen zu tun, die zur Verfügung stehen. Deutschland hat eine bedeutende Forschung und große Sammlungen. Aber gleichzeitig gibt es in der Bevölkerung nicht so ein Bewusstsein für andere Kulturen, wie das in den alten Kolonialländern England, Frankreich und Holland ist. Spielt das auch eine Rolle bei der Präsentation?
Auf jeden Fall auch. Die anderen Länder, die Sie ansprachen, haben diese lange koloniale Phase gehabt, Deutschland nicht, und trotzdem sind die Bestände, die in der Kolonialzeit in die Museen kamen, die, die die Sammlung ausmachen. Bei uns war es bis 1918 so, dass der Grundbestand – das Museum wurde 1901 gegründet – nach 18 Jahren, von 3.500 Objekten, die alle ausgestellt waren aus der Sammlung von Wilhelm Joest, sich in den 18 Jahren versiebenfacht hatte. Heute haben wir insgesamt 64.000 Objekte. Und wenn man bedenkt, war damals schon die Hälfte davon da. Die Bestände sind in allen Häusern sehr heterogen. Das ist auch bei uns so. Und natürlich, muss man bei einer Ausstellungsplanung immer wieder gucken: Was will ich zeigen, was kann ich zeigen? Was sind die herausragenden Objekte? Oder was sind Ansätze, womit man ein bestimmtes Thema sehr gut zeigen kann? Das ist ja nach wie vor das Besondere bei uns, und gerade bei uns, dass wir die Originale haben, die man nicht ersetzen kann durch eine Abbildung. Das geht bei den ethnografischen Sammlungen gar nicht.
Wie sieht die Gestaltung in Ihrem Haus aus? Sie haben eine Dauerausstellung. Ist die wirklich dauerhaft festgeschrieben?
Wir haben früher ein Kunstwort eingeführt, nämlich „semipermanente“ Ausstellung. Dauerausstellung bedeutete früher oft, dass so eine Ausstellung zehn oder fünfzehn Jahre unverändert stand. Das kann man gar nicht mehr machen. Dauerausstellung ist für uns eine Phase, wo nach fünf Jahren spürbare, deutliche Veränderungen vorgenommen werden. Das sagt sich leicht. Aber in dem Konzept, mit dem die Museen leben müssen, beinhaltet auch die finanziellen Ausstattungen. Die Umgestaltung einer Dauerausstellung ist sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen mit den kommunalen Mitteln als eine Sonderausstellung. Für die bekommen sie auch Drittmittel. Für die Veränderung einer Dauerausstellung nicht. Diese interessante Erfahrung machen wir gerade, denn wir sind dabei zu überlegen, was wir 2015 als erste Veränderung vornehmen wollen.
Wir hatten ja in der Überlegung, wie wir etwas verändern, von dem wir uns wirklich eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit versprachen, entschieden, dass wir keine regionalen Räume mehr zeigen. Nicht den Afrikasaal, wo man den Kontinent Afrika behandelt, oder den Amerikas oder Asiens. Denn den Anspruch kann eigentlich kein Museum wirklich erfüllen. Wir haben uns dann entschlossen, Themen zu behandeln, und diese Themen dann kulturvergleichend zu präsentieren, und kamen dann auf mehrere Dutzend Themen, die möglich waren. Die haben wir dann festgelegt auf Grund unserer Bestände und auf Grund der Zusammenhänge, damit das auch eine Einheit bildet. Sonst ist die Gefahr, dass man so patchworkartig einzelne Themen präsentiert. So wie ‚eine Sonderausstellung folgt der nächsten’, das wollten wir vermeiden. Die Sonderausstellung, die wir planen – jetzt nur noch eine im Jahr, weil wir einfach nicht mehr leisten können, finanziell und personell auch nicht – die ist dann ganz anders ausgerichtet. Jede Sonderausstellung hat sowieso ein Thema. Da wollen wir dann auch Sammlungsbestände aus unseren Depots nach und nach herausbringen, die man zum großen Teil noch nie gesehen hat. Das Depot umfasst heute ca. 62.000 Objekte, und in der Dauerausstellung sind es ungefähr 2.000 Objekte.
In manchen anderen Häusern werden Objekte aus den Beständen mit Gegenständen aus unserer zeitgenössischen Kultur konfrontiert. Viele Besucher aber sehnen sich nach dem Exotischen und Fremden und weniger nach solchen Konfrontationen. Wie ist es in Köln? Präsentieren sie nur Altes?
Nein. Das kann man überhaupt nicht mehr machen. Wir sind zwar von der Gattung her ein kulturhistorisches Museum, das werden wir auch bleiben, und kein Kunstmuseum. Diejenigen, die versuchen, diese kulturhistorischen Objekte als reine Kunst auszustellen, die sind extrem selten. Wir machen so etwas manchmal auch in Form von Sonderausstellungen. Das Rietbergmuseum in Zürich wäre ein Beispiel. Und jetzt, wo sie Frankfurt ansprachen, da ist es nur noch Kunst. Und zwar werden die kulturhistorischen Objekte, ich sage immer „missbraucht“, – aber die werden jedenfalls genutzt, um die moderne zeitgenössische Kunst damit neue Dinge entwickeln zu lassen. Das ist manchmal interessant und absolut nichts Neues, das haben wir vor 20 Jahren schon mehrfach getan. … Was wir auf jeden Fall versuchen müssen, meiner Meinung nach, man muss die jüngsten Kulturen mit einbinden. Wir machen das, indem bei Ausstellungsplanungen – jetzt aktuell die Ausstellung Ozeanien – aufgehängt wird an einem Stoff, Tapa, das sind Rindenbaststoffe, bei uns relativ unbekannt, in ganz Ozeanien, ein riesiger Raum, der prägende Werkstoff. Und zwar historisch wie heute. Das zeigen wir aus der Sammlung, die James Cook in den 1780er Jahren mitgebracht hat, und enden in Werken zeitgenössischer Künstler aus Australien und Neuseeland, die unten in dem Raum große Stars sind. Diese Verbindung ist ein tolles Beispiel, um zu zeigen, wie sich da eine kulturhistorische Geschichte an einem bestimmten Objekttypus oder Material bis heute fortsetzt. Da passt es perfekt. Wir haben es auch in anderen Bereichen gemacht. Wir haben es auch in der Dauerausstellung gemacht, weil wir teilweise rezente Objekte ausstellen, so wie sie heute benutzt werden, aber für ein altes, sagen wir mal, Bestattungsritual. Das verstehen die Leute sofort. Man holt sie auf unserer zeitlichen Ebene ab, und dann kann man das wunderbar erklären. Das funktioniert sehr gut. Und das halte ich für sehr wichtig.
Haben solche Museen eine Zukunft?
Auf jeden Fall. Ich meine sogar, die ethnografischen Museen haben eine große Zukunft, weil sie im Gegensatz zu den Kunstmuseen, die ja inflationär auftreten, einfach viel mehr Gesellschaftsrelevantes zu sagen haben. Diese Bedeutung wird meiner Meinung nach immer noch nicht genügend geschätzt. Da müssten auch Kommunen wie Köln viel mehr draus machen. Die Museen sind ja oft auch in einem Bundesland nur einmal vorhanden. Sie haben aber in Nordrhein-Westfalen tausend andere Museen, die sich eigentlich als Kunstmuseen verstehen. Und nur ein ethnografisches Museum! Das kann man noch viel, viel mehr nutzen. Ich denke auch, dass die Erkenntnis für Besucher, dass man mit Objekten etwas Konkretes verbinden kann, wenn man nur ein bisschen da eintaucht, dass das weiterhin richtig gefragt werden wird. Das müssen wir wiederum aufnehmen, wir müssen uns auch der Sehweise von heute etwas anpassen. Was wir sicherlich nicht ausreichend in der Vergangenheit bedacht haben, sind die ganzen Entwicklungen der neuen Medien. Was wir jetzt in der neuen Ausstellung anbieten, ist fast wieder auf einem Status angekommen, wo man sagt: Das würde man heute aber anders machen: Also viel mehr mit Digitalisierung arbeiten als mit interaktiven Elementen. So etwas müssen wir in den nächsten Jahren auch umsetzen.
Letzte Änderung: 17.08.2021






Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


