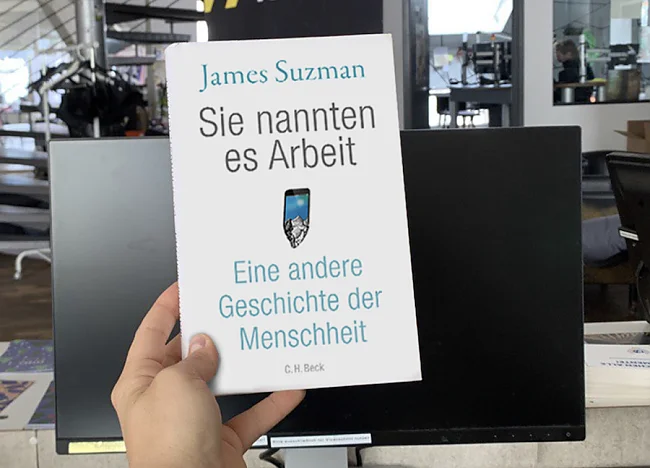
Dass wir glücklicher sind, wenn wir das tun, was wir gern tun, liegt auf der Hand. Aber wovon können wir dann leben? Nur in Utopien ist das Problem gelöst. Wir sind eben noch nicht so weit. So schreibt James Suzman in seinem Buch „Sie nannten es Arbeit. Eine andere Geschichte der Menschheit“. Hans-Jürgen Arlt hat einen kritischen Blick darauf geworfen.
James Suzmans „andere Geschichte der Menschheit“
Haben Menschen viele Jahrtausende lang als Jäger und Sammlerinnen weitaus glücklicher gelebt als die Kontoinhaber:innen und Online-Shopper:innen zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Oder geht es uns Heutigen trotz sozialer Klüfte und ökologischer Krisen wesentlich besser als unseren unzivilisierten Vorfahren?
Beiseite gelassen, dass es ziemlich daneben ist, auf solche Fragen brauchbare Antworten zu erwarten – Erzählmuster lassen sich erkennen: In den Freudengesängen über Wachstum und Wohlstand kommen ur- und frühzeitliche Menschen nur als mühselige, beladene und kurzlebige vor. Klagelieder über tiefe Ungerechtigkeiten und drohende Untergänge der Moderne haben dagegen häufig eine Schlussstrophe, die das einfache, unbeschwerte, nachhaltige Dasein längst vergangener Zeiten bejubelt. „Sie nannten es Arbeit. Eine andere Geschichte der Menschheit“, geschrieben von dem Sozialanthropologen James Suzman, gehört zur zweiten Fraktion. Davon unabhängig: Das Buch ist ungewöhnlich und anregend, weil es Biologisches und Soziales progressiv verbindet, nicht reaktionär wie viele andere, Rassisten an der Spitze.
„Sie nannten es Arbeit“ schreibt Suzmans früheren, 2017 erschienen Titel „Wohlstand ohne Überfluss: Die verschwindende Welt der Buschmänner“ weiter. Als Ausgangspunkt dient Suzman der bekannte Aufsatz von John Maynard Keynes aus dem Jahr 1930 „Economic Possibilities for our Grandchildren“. Mitten in der Weltwirtschaftskrise schaut Keynes voraus auf das Jahr 2030 und sieht, dass alles gut geworden ist. Die wirtschaftlichen Probleme sind gelöst. Materielle Bedürfnisse können jederzeit gestillt werden, wofür nicht mehr als 15 Stunden Wochenarbeitszeit nötig sind. Die Menschen haben Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, nicht Reichtum, sondern Lebensqualität interessieren sie. Aus Ökonomen sind „bescheidene, sachkundige Leute, vergleichbar Zahnärzten“ geworden.
Suzman knüpft daran an, um die Problemlage zu charakterisieren, die ihn antreibt:
„Die Schwellenwerte in puncto Produktivität und Kapitalvermehrung, die nach Keynes’ Berechnungen den Zugang zu diesem ‚gelobten Land’ ermöglichen würden, haben wir schon vor einigen Jahrzehnten erreicht, doch offensichtlich ist die Menschheit noch nicht so weit, dass sie die Fortschrittsdividende einstreichen könnte. Die meisten von uns arbeiten noch genauso fleißig wie unsere Großeltern und Urgroßeltern, und unsere Regierungen starren heute noch ebenso gebannt auf die Parameter Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung […] trotz aller Fortschritte in Technik und Produktivität verzeichnen einige der fortgeschrittenen Volkswirtschaften der Welt, etwa Japan und Südkorea, nach amtlichen Angaben Hunderte unnötiger Todesfälle infolge überstundenbedingter Erschöpfung.“
„Hundertausende sterben laut UN jährlich an Überarbeitung“, berichtet aktuell Zeitonline. Suzmans Gegenbild zum “krankhaften Klammergriff” der Arbeit und zu der Auffassung, das Leben in primitiven Gesellschaften sei ein ständiger Kampf gegen das Verhungern gewesen, liest sich so: In Wirklichkeit waren Jäger und Sammler „normalerweise wohlgenährt, hatten eine höhere Lebenserwartung als die meisten Ackerbau-Gesellschaften, arbeiteten selten mehr als 15 Stunden die Woche und verbrachten einen Großteil ihrer Zeit damit, sich zu regenerieren und ihre Hobbys zu pflegen“ (S. 13).
Suzman verfügt über einen originellen Wissenshaushalt, der ihm spannende Argumentationslinien und bemerkenswerte Begründungszusammenhänge erlaubt. Da ich seinen naturwissenschaftlichen und ethnografischen Kenntnissen nicht das Wasser reichen kann, mische ich mich in diesen Hinsichten nicht ein, berichte nur, dass ich die Lektüre durchaus lohnend empfand. Sein Verständnis von Wirtschaft und sein Umgang mit dem Knappheits-Begriff erscheinen mir freilich theoretisch unterbelichtet. So beläßt er es bei sympathischer Verwunderung, wenn er kritisch beobachtet:
„Die Leute, denen wir die Aufgabe anvertrauen, unsere Kinder zu unterrichten und uns zu pflegen, wenn wir krank sind, verdienen heute erheblich weniger Geld als diejenigen, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass sie reichen Leuten helfen, Steuern zu sparen, oder als die Leute, die ständig neue Techniken erfinden, um uns mit endlosen unerwünschten Werbebotschaften zu bombardieren.“ (S. 348)
Sich nicht nur zu wundern, sondern es sich auch zu erklären – über Bemerkungen hinaus wie, die Menschen seien noch nicht so weit –, liegt im Bereich des Möglichen. Es ist die Wirtschaftsweise, die solche wunderlichen Zustände produziert. Die heutige Gesellschaft akzeptiert, dass es die Bestform des Wirtschaftens sei, möglichst nur dann zu arbeiten bzw. arbeiten zu lassen, wenn sich dabei das investierte Geld vermehrt. Unter dieser Prämisse sind die Arbeitsleistungen wertvoller (und werden besser bezahlt), die mehr Gewinne einbringen. Umgekehrt tut sich Arbeit, die – wie die Familienarbeit – gar kein Geld einbringt, sehr schwer, überhaupt als Arbeitstätigkeit anerkannt zu werden. In der Logik dieser Wirtschaftsweise verursachen Unterricht und Pflege nur Kosten – und dann soll man diese Kosten noch dadurch erhöhen, dass die dazugehörigen Arbeitskräfte gut bezahlt werden? Das wäre unwirtschaftlich, jedenfalls unkapitalistisch. Im Rahmen unserer Wirtschaftsweise wird sich daran nichts ändern, solange nicht politische Entscheidungen oder konsequenter Widerstand der Arbeitskräfte höhere Entgelte erzwingen.
By the way: Auch die „unerwünschten Werbebotschaften” sind „systemrelevant”. Werbung ist in den Strukturen unserer Wirtschaftsordnung fundamental angelegt. Die kapitalistische Form der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit macht die werbliche Kommunikation zu einem prinzipiell unverzichtbaren Treiber. Sie gehört dazu wie die Saiten zur Gitarre.
Leben heißt arbeiten.
Als Fundament seiner Argumentation schlägt Suzman einen Arbeitsbegriff vor, den er auf die (etwas irreführenden) Kurzformel bringt „Leben heißt arbeiten“ und diese Kurzformel führt ihn zu der Frage „Wodurch unterscheidet sich die Arbeit, die beispielsweise ein Baum, ein Tintenfisch oder ein Zebra leistet, von der Arbeit, mit der sich unsere Spezies an die Schwelle zur künstlichen Intelligenz herangearbeitet hat?“ (S. 42)
Seine Antwort lautet, das Verhältnis zwischen Energie, Leben und Arbeit verbinde uns mit allen anderen lebenden Organismen, aber „zugleich sind unsere Zielstrebigkeit, unser grenzenloser Einfallsreichtum und unsere Fähigkeit, selbst aus Banalem Befriedigung zu gewinnen, Teil eines evolutionären Vermächtnisses“ (S. 374). Diesem Vermächtnis würden die Menschen im „krankenhaften Klammergriff, mit dem die Knappheits-Ökonomie unser Arbeitsleben im Schwitzkasten hält“, nicht gerecht. Stattdessen komme es darauf an, unsere rastlose Energie, Zielstrebigkeit und Kreativität einzusetzen für die Gestaltung neuer, nachhaltigerer Zukünfte.
Letzte Änderung: 28.08.2021 | Erstellt am: 23.08.2021

James Suzman Sie nannten es Arbeit - Eine andere Geschichte der Menschheit
Originaltitel: Work. A History of how we spend our time
Übersetzung: Karl Heinz Siber
Beck C. H., 03/2021
Einband: Gebunden
Sprache: Deutsch
ISBN-13: 9783406765483
Umfang: 398 Seiten
Gewicht: 645 g
Maße: 221 × 152 mm
Stärke: 32 mm
26,95 Euro
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


