Gleich und Gleich
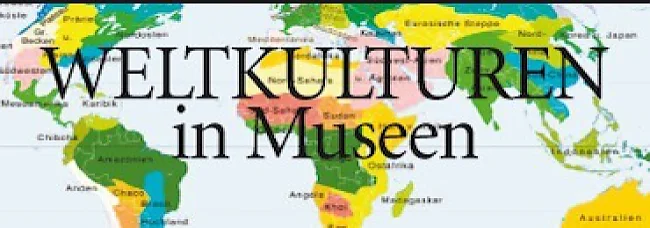
Einst gehörte zu Berlins kaiserlichem Machtgepränge eine umfangreiche ethnologische Sammlung aus aller Welt. Die über 500 000 Ausstellungsstücke erzählen Geschichten vom alltäglichen Leben, von Mythen, religiösen Bräuchen und dem Wandel der Kulturen. Mit Peter Junge – er ist Leiter der Afrika-Abteilung im Ethnologischen Museum Berlin – fand Clair Lüdenbach einen Gesprächspartner, der ihr die Aufgaben eines ethnologischen Museums von einem ganz neuen Blickwinkel aus erklärte.
Clair Lüdenbach im Gespräch mit Dr. Peter Junge
Clair Lüdenbach: Das Museum in Berlin Dahlem ist das größte ethnologische Museum in Deutschland. Was ist das Konzept? Versucht man, sich der Zeit anzupassen, wie viele andere Museen?
Peter Junge: Das Museum hat in der Gründungsphase das Konzept, ein wissenschaftliches Archiv der Kulturen, die nicht europäisch waren, aufzubauen. Die Sammlungsmenge geht natürlich vor allem auf die Kolonialzeit zurück. Das Konzept ist aber älter. Es geht auf Philipp Wilhelm Adolf Bastian zurück, der das Museum gegründet hat und der erste deutsche Völkerkundler an der Uni war. Damals hatte man die Perspektive, durch den Kolonialismus gehen die Kulturen alle kaputt und man muss jetzt noch schnell alles sammeln, bevor sie verschwunden sind. Das war das Konzept, was in der Gründung dahinter stand, und was – vielleicht nicht so ausgesprochen – noch sehr lange in diesem Museum zu finden war. Die Idee: Man hat etwas gerettet, was es so nicht mehr gibt. Das ist keine typisch Berliner Idee, die hatten viele Museen. Was Bastians Konzept unterschieden hat, sicher auch damals schon, – er hat es nicht als Kolonialmuseum gesehen, viele andere deutsche Völkerkundemuseen haben da ja eine ganz starke Tradition – hier war mehr die wissenschaftliche Haltung im Vordergrund. Die Sammlungen sind auch, anders als in anderen deutschen Völkerkundemuseen, nicht auf die deutsche Kolonialzeit beschränkt. Für Afrika haben wir eine sehr große Kongosammlung, eine sehr große Nigeriasammlung, also alles Sammlungen, die nichts mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun haben. Und wenn Sie auf die ganze Sammlung von 500 000 Objekten blicken – so viele liegen hier – dann haben Sie sehr viel Archäologisches; wir haben Kunstsammlungen, wir haben Bereiche, die auch nicht so die klassischen der Völkerkunde sind. Der ganze indische, ostasiatische Bereich war bis in die 60er Jahre Teil des Dahlemer Völkerkundemuseums, wie es damals noch hieß. Das hat natürlich den Rahmen der ganz traditionellen Völkerkunde gesprengt.
Wer waren die Sammler? Gab es ein staatliches Interesse?
Es gab verschiedene Interessen und auch verschiedene Formen von Sammlern. Während der Kolonialzeit gab es eine Anweisung über die Reichsregierung an die deutschen Kolonialbeamten zu sammeln, und diese Objekte auch erst einmal an das Berliner Museum zu geben. Es hatte, jedenfalls auf dem Papier, eine Monopolstellung. Die Idee war, alles kommt nach Berlin und wird dann vielleicht noch verteilt. Das hat in der Praxis natürlich nie so funktioniert. Es gibt viele Kolonialbeamte, die haben das gleich an andere Museen gegeben. Aber der Anspruch des Museums war für etwa zehn Jahre, alles zu sammeln, wo Deutsche in Afrika oder in der Südsee sind. Und der Aufbau dieses Museums in der Größe ist auch eine Form imperialer Selbstinszenierung gewesen. Das betrifft nicht nur das heutige ethnologische – früher Völkerkundemuseum – sondern auch die großen archäologischen Sammlungen auf der Museumsinsel. Da war ein erklärter Wettstreit mit London und Paris. Berlin wollte da ganz gleichwertige, möglichst sogar bessere Sammlungen haben. Das ist ein Teil der wilhelminischen Selbstinszenierung gewesen, sich als gleichberechtigte Großmacht, mit Franzosen und Engländern vor allem, in Konkurrenz zu treten. Deshalb sind auch riesige Sammlungen nach Berlin gekommen. Man hat da auch sehr viel Geld investiert. Nicht nur Geld zum Handeln, sondern es gibt ja eine ganze Reihe wissenschaftlicher Expeditionen, archäologischer Expeditionen, die vom Kaiserreich gemacht wurden. Solche Dinge wie den Pergamonaltar und die ganzen türkischen, archäologischen Ausgrabungen, die nach Berlin gekommen sind, die Ägypten-Sammlung: Das ist schon ein Teil preußischer Selbstinszenierung gewesen.
Nach welchen Kriterien hat man da getrennt? Auf der einen Seite hat man auf der Museumsinsel die große ägyptische Sammlung. Was kam nach Dahlem? Wie hat man sich da abgrenzt?
Im Prinzip ist es damals eine politische Aufteilung der Welt gewesen. Man hat auf der einen Seite Europa gehabt, mit ausdifferenzierten Museen für Malerei, die Gemäldegalerie, für Kunsthandwerk, aber auch die archäologischen Museen, die lange als so eine europäische Frühgeschichte betrachtet wurden. Selbst Ägypten war für uns keine afrikanische Kultur, sondern eigentlich eine, die zum Mittelmeerraum und zur Basis Europa gehörte. Und diese Haltung finden Sie dann auch in der Museumskonstruktion dieser Zeit. Es gibt die Museen, die mit der europäischen Frühgeschichte zu tun haben, und dann gibt es die Völkerkunde Museen. Die waren eigentlich für den ganzen damals kolonialisierten Rest der Welt zuständig. Das ist eine ganz politische, ideologische Trennung. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Museum für ostasiatische Kunst. Das hat sich sehr früh, schon vor dem ersten Weltkrieg, verselbständigt. China und Japan hat man damals schon zugestanden, dass sie so was wie Kunst haben. Deshalb hat man Museen für ostasiatische Kunst gegründet. Die Völkerkunde war sozusagen zuständig für den unentwickelten Rest der Welt. So sind die Kulturen natürlich auch betrachtet worden: Als historisch nicht wandelbare ursprüngliche Kulturen, die auf einem bestimmten Niveau stehen geblieben waren. Was auch eine der Rechtfertigungen für den Kolonialismus war, indem man gesagt hat: Wir gehen dahin und führen die an unsere europäische Zivilisation heran, weil die ohne uns das gar nicht können. Die Völkerkundemuseen wurden ein Refugium für all das, was nicht einen europäischen Standard hatte.
Früher hat man versucht, diese fremde Welt im Museum darzustellen. Das Konzept, dass man einfach die Objekte ausstellt, hat sich geändert. Wie versucht man heute, diese Welt den Besuchern näher zu bringen?
Damals hat man die Objekte auch ausgestellt unter dem Aspekt, sich europäischer Überlegenheit zu vergewissern. Im besten Fall hat man diese Länder exotisiert, dann waren sie ungewöhnlich und ein bisschen gruselig: dass zum Beispiel Schrumpfköpfe immer wieder ausgestellt wurden und der Kannibalismus. Die Kopfjagd hat immer in den Museen eine Rolle gespielt. Vielleicht weniger in den Museen als mehr im Publikumsinteresse, was aber auch nicht immer trennbar ist. Eigentlich hatte die Sammlungen die Funktion: Hier ist unsere Welt und die ist entwickelt. Und dann gibt es noch die andere Welt, die ist unentwickelt. Die durfte exotisch und interessant sein, aber die Überlegenheit der europäischen Welt steckte quasi in jeder völkerkundlichen Inszenierung mit drin, auch wenn die Kollegen vor hundert Jahren das ganz anders gesehen haben und die Kulturen hoch interessant fanden. Aber in der öffentlichen Wirkung hat es genau diesen Effekt gehabt. Das hat sich auch durch die Konstruktion von Völkerkunde Museen und spezialisierten europäischen Museen nicht wirklich geändert. Obwohl uns heute nicht mehr bewusst ist, dass das auch viel mit der kolonialen Aufteilung der Welt zu tun hat. Völkerkunde-Museen existieren heute noch mit großer Selbstverständlichkeit und tragen aber das koloniale Erbe natürlich in sich.
Man erlebt es ja in jedem Völkerkunde Museum, man will weg vom kolonialen Blick …
Genau. Was wir in den letzten Jahren ganz speziell für uns entwickelt haben und auch für das Humboldt-Forum: Wir wollen erst mal diese Trennung deutlich machen: Hier der Westen und da der Rest. Die kann man nicht mehr aufrechterhalten, die entspricht auch nicht den historischen Fakten. Deshalb ist ein wichtiger Punkt für unsere Neukonzeption, zu zeigen, dass die Weltgeschichte verflochten ist, dass man die europäische Geschichte nicht verstehen kann, jedenfalls in der frühen Neuzeit, ohne die Entwicklungen, die es in Afrika gegeben hat. Ein Königreich wie Benin – wir haben hier ein wichtige Sammlung – die ist entstanden in der Form, wie wir es kennen, etwa seit 1500, im Kontakt mit den Europäern. Das Königreich Benin hat eine aktive Rolle gespielt im Dreieckshandel mit Amerika. Europäische Händler, die Produkte, aber auch Sklaven aus dem Benin nach Amerika brachten, die dann wieder in der Zuckerindustrie arbeiteten, Zucker, der dann wieder für teures Geld nach Europa verkauft wurde. Da spielen diese Länder eine wichtige Rolle. Und da sind sie eingebunden in einen Prozess, der zur Modernisierung führt. Das wollen wir darstellen. Wir wollen zeigen: Afrika ist nicht so ein exotisches Gegenüber zur europäischen Geschichte, sondern Afrika ist Teil in einem Prozess, an dem Europäer, Afrikaner und Amerikaner beteiligt waren. Oder wir wollen zeigen, dass es zum Beispiel im Indischen Ozean Handelssysteme und Verbindungen zwischen Ostafrika, Arabien, Indien bis nach China gab, die lange bevor die Europäer dort auftraten, funktionierende Verbindungen darstellten. In denen waren wirtschaftliche Beziehungen, aber eher kulturelle Beziehungen, ein kultureller Austausch. Wir wollen diese Isolation in Zeit und Raum, der durch den Kolonialismus in den Köpfen von Europäern, und auch getragen von Völkerkunde-Museen, entstanden ist, den wollen wir aufheben, indem wir zeigen: Afrika war kein geschichtsloser Kontinent, Afrika hat geschichtliche Prozesse gehabt. Es war auch kein isolierter Raum, er stand ganz früh mit dem Mittelmeerraum, mit Arabien, mit Indien, mit China im Kontakt. Seit der frühen Neuzeit auch mit Amerika und Europa. Diese Verbindung wollen wir zeigen.
Wie stellt man das, was ja ein wirtschaftlicher Austausch in vielerlei Hinsicht war, nun dar?
Das war ja nicht nur ein Wirtschaftsaustausch. Wir werden das erst mal exemplarisch darstellen. Die Auslöser sind wirtschaftliche Interessen gewesen. Das ist ganz klar. Aber das hat Konsequenzen für beide gehabt. Wir werden das Königreich Benin zum Beispiel ausstellen mit diesen Benin-Objekten und zeigen, dass das, was wir heute als Beninkunst kennen, zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert vor allen Dingen entstanden ist. Es gab auch noch im 20. Jahrhundert Künstler, die im Benin arbeiten, aber wir konzentrieren uns auf die Zeit bis 1897. Diese Kunst ist ganz eng verbunden mit den politischen, wirtschaftlichen Beziehungen, die das Königreich Benin gehabt hat. Zum Beispiel ist dieses Material, aus dem diese berühmten Dinge wie Gedenkplatten, Reliefköpfe gegossen worden sind, ein Exportmaterial. Die Europäer haben Messing importiert nach Benin als Zahlungsmittel. Und weil Messing hoch begehrt war, war das auch ein akzeptiertes Zahlungsmittel. Dass Benin so raus fällt, auch aus anderen afrikanischen Kunsttraditionen, durch diesen Schwerpunkt auf Bronze – man sagt immer Bronzen, obwohl es nur Messing ist, Bronzen, das ist eine andere Legierung – aber durch diese Metallgüsse, – das hat ganz eng mit dem Handel zu tun. Die Basis dieser Kunst war das Ergebnis dieser Beziehung zu den Europäern.
Das muss man dann schriftlich niederlegen.
Wir versuchen, durch diese Objekte, die einen Zeitraum vom 15. Jahrhundert bis zum frühen 19. Jahrhundert umfassen, einen historischen Prozess nachzuvollziehen. Indem wir sagen, um 1500 begann das mit dem Messing, und da sind auch bestimmte Objekte und bestimmte Stile entstanden. Die zeigen wir und erklären, dass das mit dem wirtschaftlichen und militärischen Aufschwung Benins im 16. Jahrhundert zu tun hat. Das zeigt sich an Reliefplatten und einer bestimmten Form von Reliefköpfen. Das brauchen wir nicht nur hinzuschreiben, die Dinger kann man ja sehen. Dann gibt es so von 1670 bis 1720 eine ganz große Krise, die sich auch in der Kunst Benins niederschlägt. Es gibt auf einmal ganz neue Formen in der Kunst und eine Tendenz zur Individualisierung. Das ist nicht nur eine kunsthistorische Entwicklung, das hat ganz viel mit einer wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Ein Grund ist, dass der König ursprünglich das Handelsmonopol hatte. Vor allem für Sklaven und Elfenbein, was sehr wichtige Handelsprodukte sind. Um 1700 werden für die Europäer aber Baumwolle und Palmöl auch sehr wichtig. Die nehmen einen wichtigen Teil im Export Benins ein. Das sind aber lokal hergestellte Produkte, das heißt, auf einmal hatte nicht nur der König ein Handelsmonopol, sondern die Aristokratie, oder die Dorfvorsteher. Die haben auf einmal selber Handel betrieben und sind damit wirtschaftlich stärker geworden. Das drückt sich auch in der politischen Konkurrenz aus gegenüber dem König. In Benin, in der mündlichen Überlieferung ist das immer eine dynastische Krise. Da gibt es einen schwächlichen König, der hat keine Kinder, und da gibt es lauter Nachfolger aus der Familie und Aufstände gegen sie. Erst im Anfang des 18. Jahrhunderts etabliert sich dann wieder ein König. Aber der Hintergrund sind diese wirtschaftlichen Verschiebungen, die dazu führen, dass die Macht des Königs auch beschnitten wird von der Aristokratie. Viele Titel in der Aristokratie waren nicht erblich. Der König ernannte die immer nur und hatte dann die Macht über diese Position. Einige dieser ganz wichtigen Titel wurden auf einmal erblich. Das heißt, es entstand eine eigene Macht gegenüber dem König. Das kann man auch in der Kunst sehen. In der Kunst treten zum Beispiel erst im 18. Jahrhundert Motive auf, die sich auf die sakral-spirituelle Rolle des Königs beziehen, seine besondere Macht, die er hat. Dass das auf einmal in der Kunst auftaucht, hat damit zu tun, dass das wirklich noch etwas war, das den König von den Aristokraten unterschied. In der Kunst tauchte das erst auf, als der König das als Abgrenzung braucht, also als Kompensation verlorener politischer und wirtschaftlicher Macht. Diese Geschichte lässt sich wunderbar an diesen Objekten erzählen, und man kann auf diese Weise immer wieder den Zusammenhang herstellen zwischen dem Handel nach außen und die Auswirkung, die es sowohl auf die politische Verfassung, die wirtschaftliche Verfassung Benins und eben auch auf die Kunst hatte. Da wir dies über einen Zeitraum von 500 Jahren darstellen können, kann ein Besucher dieser Entwicklung dann auch folgen. Wir werden da auch ganz bewusst europäische Objekte mit rein bringen.
Viele Museen machen das. Sie denken anders als Sie, aber sie meinen, sie müssten einen Bezug zur Gegenwart herstellen, und bringen dann europäische Objekte in einem Zusammenhang, den man gar nicht vermuten würde.
Nein. Das ist ein anderer Punkt. Diesen Gegenwartsbezug, den haben wir auch, aber wir reden auch über Geschichte. Denn Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen. Wir werden auch viele Themen bis an die Gegenwart heranführen. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert, kurz vor der Eroberung Benins, also in der eigentlichen Kolonialzeit, war Benin als Handelspartner wirtschaftlich unbedeutend geworden. Es ging nicht mehr um den Export bestimmter Dinge nach Europa, sondern die Engländer hatten ein Interesse, ihre industriell gefertigten Textilien zum Beispiel in Nigeria auf den Markt zu bringen. Das war dann interessant. Dann wurden natürlich Handelspartner überflüssig. Bevor Benin erobert wurde, änderte sich das Image Benins. Es war plötzlich ein Menschen opferndes, blutrünstiges Königreich, wo man natürlich das Recht hatte, als gebildeter, aufgeklärter Europäer hinzugehen, um die Menschenopfer zu beenden. Das war die Ideologie. Das Image Benins war auf einmal ganz schlecht geworden. 150 Jahre vorher war das ein Handelspartner. Die Portugiesen haben im 16. Jahrhundert Prinzen ausgetauscht an ihren Höfen. Die haben Briefe ausgetauscht und sich wie andere Höfe völlig gleichberechtigt gefühlt. Auch diese Veränderung wollen wir zeigen. Wir werden das an einem Beispiel hoffentlich zeigen. Es gibt hier im Museum für Kunst und Gewerbe einen Tafelaufsatz, der ist aus dem späten 17. Jahrhundert, in Nürnberg hergestellt. Das ist ein Atlas mit einer Weltkugel, der wurde dann von den Preußen aufgekauft. Und der erste preußische König hat sich dann darauf noch einen Adler aufmontieren lassen, um die neue Bedeutung des preußischen Königtums zu dokumentieren. Auf diesem Atlas ist mit größter Selbstverständlichkeit das Königreich Benin verzeichnet. Daran sieht man, mit welcher Selbstverständlichkeit afrikanische Königreiche in Europa wahrgenommen wurden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Afrika auf einmal der dunkle, unbekannte Kontinent, den man erschließen musste. Da wurde das Wissen, was man über Afrika hatte, reduziert auf Unterentwicklung, barbarische Könige, und damit eine Legitimation geschaffen, die zu erobern. Das lässt sich durch die Integration von europäischen Objekten sehr gut machen.
Mit diesem Konzept ziehen sie dann ins Humboldt-Forum im neuen Schloss. Wird Dahlem dann geschlossen?
Ja, Dahlem wird geschlossen. Wir werden dann ja auch eine größere Ausstellungsfläche bespielen, als wir zur Zeit in Dahlem haben. Wir haben hier im Moment achteinhalbtausend Quadratmeter Ausstellungsfläche. Im Humboldt-Forum kommen wir auf knapp elftausend. Das ist schon eine Vergrößerung. Dahlem leidet ja heute unter wenigen Besuchern, da die Touristen, die für drei, vier Tage nach Berlin kommen, auf die Museumsinsel gehen. Keiner kommt nach Dahlem, das ist viel zu weit weg. Selbst für die Berliner, die so eine Neigung haben, ihren Kiez nicht zu verlassen, ist Dahlem so kurz vor Helmstedt. Da ist Dahlem so weit weg, da geht man nicht hin. Damit sind diese Sammlungen hier auf eine Art repräsentiert, die ihrem Wert, die ihrer Bedeutung einfach nicht mehr entspricht. Das war anders zu West-Berliner Zeiten, als in diesem Komplex die Gemäldegalerie war, die Skulpturen-Sammlung, ganz früher auch die Ägyptensammlung. Ich weiß noch, in den 60ern, stand die Nofretete hier im Altbau im Foyer. Das hat sich alles geändert nach der Wende. Deshalb sind die noch hier angesiedelten Museen echte Wendeverlierer, weil die Touristenströme vorher alle hier landeten. Jetzt gehen sie auf die Museumsinsel. Deswegen ist es sinnvoll, das Museum hier zu schließen. Auch wenn das einige Zehlendorfer, die zu unserer wichtigsten Kundschaft hier in Dahlem gehören, vermissen werden. Insgesamt ist es wichtig, dass wir es in die Nähe der Museumsinsel bringen. Über die Schlossfassade kann man sich ja zu Recht streiten, ob es Sinn macht, das Schloss wieder aufzubauen und da ein Museum rein zu machen. Aber dass man diese Sammlungen aus diesem Refugium hier im Südwesten in die Mitte Berlins, zu den anderen Sammlungen bringt, das ist kulturpolitisch auch eine richtige Entscheidung.
Ich plane zum Beispiel eine Kamerun-Ausstellung für das Humboldt-Forum. Da geht es um die Sozialgeschichte Kameruns, denn das ist eine der wichtigsten deutschen Kolonien gewesen. Wir werden da zeigen, wie Afrikaner nicht einfach nur Opfer wurden, sondern wie Afrikaner in der Kolonialzeit Strategien gewählt haben, um mit dem Kolonialismus umzugehen. Die einen haben sich ganz stark militärisch gewehrt. Die anderen haben versucht, sich ganz eng mit den Deutschen zusammenzutun, um ihre eigene Position innerhalb Kameruns zu sichern. Wir werden dann auch zeigen, was das mit unserem Museum zu tun hat. Die Sammlungen, die wir aus beiden beispielhaft genannten Königreichen haben, unterscheiden sich: Das eine ist vor allen Dingen Kriegsbeute, das andere sind Sammlungen, wo Kollegen hier aus dem Museum vor hundert Jahren in Kamerun waren und da gesammelt haben, wissenschaftlich diese Sammlungen angelegt haben. Die natürlich wieder ganz anders zusammengestellt sind, als die Objekte aus den Königreichen, die die Deutschen erobert haben, wo sie den Palast ausgeräumt haben. Die Kolonialgeschichte hat Wirkung auch auf die Sammlung. Aber dann wollen wir auch zeigen, und da wird es dann gegenwärtig, dass die Kolonialgeschichte nicht so eine dreißigjährige Epoche war – für die Deutschen, für die Kameruner hat sie ein bisschen länger gedauert: die ist nun hundert Jahre her – sondern dass bestimmte Ideen, die in der Kolonialzeit anstanden, sind: Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, alle diese Dinge, dass die in Deutschland weiter existiert haben. Nicht nur im Faschismus, sondern bis heute gibt es Ausländerfeindlichkeit, und das ist unser Erbe der Kolonialzeit.
Sie wollen sagen, dass Ausländerfeindlichkeit erst durch den Kolonialismus entstanden ist?
Nein, nicht nur das, sondern dass die Ausländerfeindlichkeit, wie sie heute existiert, ohne die koloniale Vergangenheit anders aussehen würde. Das hat es ja in vielen Kulturen gegeben, dass man das Fremde anders betrachtete als das Eigene. Das ist klar. Aber rassistische Vorstellungen, die heute da sind, das ist ein Erbe der Kolonialzeit. Denn in der Kolonialzeit sind diese rassistischen Theorien bis in die Wissenschaft rein formuliert worden. Und die sind immer noch in den Köpfen in Deutschland. Insoweit werden wir zeigen, dass die Kolonialzeit als politische, wirtschaftliche Herrschaft vorbei ist, dass es aber eine koloniale Attitüde in unseren Köpfen immer noch gibt. Das wollen wir nicht nur für Deutschland zeigen, sondern auch, welche Konsequenzen die Kolonialzeit für ein Land wie Kamerun gehabt hat. Die Kolonialzeit hat ein Herrschaftsmodell vorgeben. Und viele unabhängige Staaten haben dieses Herrschaftsmodell in den 60er Jahren übernommen. Dass es heute in Kamerun eine kleptokratischen Präsidenten gibt, das liegt nicht nur daran, das der Mann böse und schlecht ist. Sondern der kopiert ein Herrschaftsmodell, was den Kamerunern zum Teil als Opfern, aber dann in den 60ern in Teilen als Tätern bekannt ist. Es gibt auch Länder, die damit anders umgehen. Aber da wollen wir das Thema Kolonialismus an die Gegenwart heranführen. Das sind andere Methoden, mit der Gegenwart umzugehen: Nicht nur zeitgenössische Kunst mit alter Kunst zu konfrontieren, sondern Geschichten bis zur Gegenwart zu erzählen.
Letzte Änderung: 17.08.2021







Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


