Die Gratwanderung des WIR

Diskriminierungen, Demütigungen, Abwertungen und soziale Selektion nach Herkunft – die Wunden und Traumata, die von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus verursacht wurden, verlangen nicht nur Anerkennung. Jutta Roitsch hat die Argumente im Kampf um die richtigen Worte in Büchern von Emilia Roig und Judith Kohlenberger kritisch gesichtet.
„Nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, ist unerträglich. Weil es unsere Menschlichkeit infrage stellt.“
Emilia Roig
Mit diesen beiden Sätzen holt die französische Politikwissenschaftlerin Emilia Roig, die seit anderthalb Jahrzehnten in Berlin lebt, die lautstarke Debatte über linke Identität, „Black lives matter“, den Postkolonialismus, der vor allem in den französischen Instituten der „Science Po“ erregt und mit verbaler Härte ausgetragen wird, und nicht zuletzt sexuelle Diversität nach Deutschland. In ihrem (ersten) Buch „Why we matter. Das Ende der Unterdrückung“ bündelt sie diese Themen zu einem großen „Wir“: anspruchsvoll und herausfordernd für alle, die die Wut verstehen wollen, die sich in den USA und in Kanada ausbreitet, aber auch in den Politikseminaren von Paris bis Grenoble und unter den „neuen Deutschen“, die sich so nennen, weil sie hier geboren sind und das immer noch abwertende und ausgrenzende Etikett „Migrationshintergrund“ zurückweisen.
Emilia Roig löst Anspruch und Wut ein, wenn sie sich selbst vorstellt: „Ich bin ein Produkt des französischen Kolonialismus.“ Sieben Worte, die mindestens zwei Jahrhunderte französischer Geschichte einkreisen. Es ist eine bittere Geschichte und führt zurück in die Zuckerrohrplantagen auf Martinique, auf denen meist aus Frankreich verschiffte afrikanische Sklavinnen und Sklaven schufteten, kilometerlange Bewässerungskanäle von den Bergen zu den Plantagen bauten und den weißen Patrons dienstbar zu sein hatten. Roigs Mutter kommt aus einer dieser Sklavenfamilien. Ihr Vater, ein Arzt, wuchs im einstigen „Departement“ Algerien auf und stammte aus einer jüdischen Familie mit spanischen wie osteuropäischen Wurzeln. Die schwarze Großmutter auf Martinique glaubte an den Geist der Ahnen, der Großvater aus Algerien wurde nach dem verlorenen Krieg zum rechtsextremen französischen Nationalisten und Kolonialisten, der die weiße Vormacht der Franzosen in Afrika verteidigte. Und sich am Antisemitismus der Le Pens nicht störte.
Wie geht eine junge Frau, die 1983 in Frankreich geboren wurde und bis zur Trennung ihrer Eltern in einer gut bürgerlichen Welt (mit Cello und Skilaufen, wie sie schreibt) eines Pariser Vororts aufgewachsen ist, mit dieser Familiengeschichte um? Mit einer schonungslosen Ehrlichkeit. Das gibt diesem Buch die glaubwürdige Wucht. Und trotz der überschwänglichen Liebeserklärungen an ihre Eltern im Dankesnachwort rechnete sie mit ihrer „transracial family“ ab. Diese Familien, so schreibt sie, würden gerne als Symbol für Toleranz und Offenheit bemüht. „Nein, leider sind gerade diese Familien für Rassismus besonders anfällig.“ Das ist ein hartes Urteil, das in dieser Allgemeinheit von ihr kaum belegt wird.
Es trifft ihren Vater, es trifft ihre Mutter. Seiner lebenslangen Vorliebe für schwarze Frauen verleiht ihr Vater einen Weltverbesserungsanspruch. Sie schreibt: „Eines Tages, als ich versuchte, mit ihm über Rassismus zu sprechen, sagte er zu mir: ‚Siehst du? Deswegen wollte ich metisse-Kinder haben. Um Rassismus zu überwinden und zu der Gesellschaft der Zukunft beizutragen’ Mit einem solchen Satz sagte mein Vater viel über die Beziehung zu meiner Mutter aus. Sie war in seinen Augen austauschbar. Hauptsache Schwarz.“ Ihre Mutter wiederum dachte weniger an die Gesellschaft der Zukunft als an den sozialen Aufstieg ihrer drei Mädchen durch den weißen Vater. Roig erkennt auch darin ein Muster: In der Ehe mit einem Weißen sieht ihre Mutter eine Chance, sich von ihrer schwarzen Identität zu distanzieren. Und einer immer gefühlten Minderwertigkeit. So erklärt Roig den enormen Druck, den die Mutter auf ihre Mädchen ausübt: mehr wert sein durch Bildung.
Für Emilia, die junge Französin, die privilegiert und mit dem berühmten „sozialen und kulturellen Kapital“ (Pierre Bourdieu) in überwiegend weißen Kreisen aufwächst, ist ihre Suche nach einer Identität ein langer, quälender Prozess. In der laizistischen, republikanischen Schule, auf die die Franzosen so stolz sind, erfährt sie wenig über das, was ihre Familiengeschichte ausmacht: Der Befreiungskrieg in Algerien wird erst seit 25 Jahren ein Krieg genannt, die Departements in Übersee, so auch Martinique, verharren in völliger Abhängigkeit vom „Mutterland“, nicht einmal ein Joghurt wird auf der fruchtbaren Insel produziert. Und ethnische wie religiöse Spannungen oder offene Konflikte im Klassenzimmer, in der Kantine oder auf dem Schulhof sind erst seit anderthalb Jahrzehnten unter Soziologen ein Thema. Seit dem Mord an dem Geschichtslehrer Samuel Paty interessiert sich zwar eine breitere Öffentlichkeit für den Alltag an den Schulen, aber eine aufmerksame Forschung über Rassismus, (Anti-)Islamismus und Antisemitismus in der Schule findet in Frankreich (noch immer) nicht statt: Ein Gesetz aus dem Jahr 1978 verbietet Fragen nach der ethnischen Herkunft und der Religionszugehörigkeit. Interessierte Forscherinnen und Forscher gehen gewundene Wege, um die extreme Benachteiligung der Kinder und Jugendlichen aus den Banlieues und ohne soziales wie kulturelles Kapital nachzuweisen.
Emilia Roig beschreibt ihren Prozess „der inneren Unruhe“ und der „unverarbeiteten Wut“ schrittweise. Sie beobachtet sich dabei selbst, wie sie danach sucht, „wie die gesellschaftlichen Systeme, in die unsere Erfahrungen eingebettet sind, funktionieren.“ Aus ihrem „Ich“ und ihrer Familiengeschichte wird ein „Wir“ und ein „Uns“, beide Worte benutzt die Wissenschaftlerin als Abgrenzung von der weißen Mehrheitsgesellschaft und der „eurozentrischen Universität“. In einer US-amerikanischen Universität betritt die Studentin der „Science Po“ einen Seminarraum und trifft nur Menschen, die aussehen wie sie. Sie fühlt sich im Schonraum, einem safer space. Und sie liest Bücher, die in ihrem bisherigen französischen Bildungskanon nicht aufgetaucht waren: Angela Davis und Frantz Fanon oder Aimé Césaire, der große Dichter der „négritude“, dessen poetische Zeilen heute auf seiner Heimatinsel Martinique an Häuserwänden zu lesen sind. Roig nennt diese Begegnungen, mächtig überhöhend, „Theorien der Befreiung“, ohne die „hätte sich mein politischer Aufbruch in Grenzen gehalten“.
Der Aufbruch ist auch ein Ausbruch, von Frankreich nach Berlin. Im zweiten Teil ihres Buches verlässt sie die Familiengeschichte und überblendet ihre Erfahrungen mit inzwischen doch sehr umfangreichen deutschen Studien über strukturelle Diskriminierungen, Demütigungen, Abwertungen und soziale Selektion nach Herkunft. Sie streift durch Schulen und Universitäten, durch die Justiz und die Medien, durch die Gerichtssäle und die Krankenhäuser. Schwarze Menschen entdeckt sie in den Universitäten und Behörden: als Putzfrauen. Wer sich bisher mit diesen Seiten der deutschen Wirklichkeit nicht beschäftigt hat, den klärt Roig, die sich selbst als eine Linke bezeichnet, gründlich und wütend auf. „Empathielücken“ sieht sie bei den (weißen) Deutschen. Zu ihrem „Wir“ gehören sie nicht. Bei einer solchen schroffen Abgrenzung wirkt die Unterzeile ihres Buches „Das Ende der Unterdrückung“ befremdlich. Die Unterdrückung, so ihre Alltagsbeschreibung, findet statt.
Und das Ende? Im Schlusskapitel rutscht Emilia Roig in eine Sprache, die fast an die Geisteranrufung ihrer Großmutter erinnert. Da beschwört sie die „Einheit der Menschheit“ in Liebe und Schmerz. Sie verlangt, „neben der Heilung der verwundeten Egos – von allen Menschen, unabhängig vom Geschlecht – muss sie [die Politik – Anm. d. A.] die Wunden und Traumata anerkennen, die von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus verursacht wurden.“ Das ist „too much“, verweist aber auf einen Fundamentalismus in dieser Identitätsdiskussion, den die Wiener Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger „Religionisierung“ nennt.

Ihr schmales Buch mit dem schlichten Titel „Wir“ schrieb die 35-jährige Wissenschaftlerin vor einem Jahr im ersten Lockdown. Das „Wir“ nennt sie flüchtig und „nie homogen“. Noch immer kämpften viele Menschen tagtäglich darum, „an der Macht des Wir teilhaben zu dürfen“. Das Ziel, das Kohlenberger beschreibt, sei ein Wir, das niemanden zurücklässt. In demokratischen Gesellschaften sei dies ein anstrengender und sehr dynamischer Prozess, „weil immer neue Gruppen ins Wir drängen.“. Die Generation der Emilia Roig zum Beispiel, die nach Abitur, Studium und Berufserfahrung sichtbare Positionen in der Gesellschaft, den Medien, der Wissenschaft, der Kunst beansprucht. Für Kohlenberger bedeutet das, auf bisherige Privilegien zu verzichten, Vorteile nicht zu nutzen: „reject your privilege“. Über die absehbaren Risiken und Nebenwirkungen verbreitet Kohlenberger keine Illusionen: „Wenn bisher marginalisierte Gruppen Sichtbarkeit erlangen und einen Platz am Tisch für sich beanspruchen, geht das offenbar nicht ohne Reibungen und Konflikte mit denen vor sich, die schon immer und seit Generationen am Tisch saßen.“ Solange die türkische Putzfrau mit Kopftuch in der Universität oder im Gericht unsichtbar geblieben sei, seien antimuslimische Konflikte ausgeblieben. Erst als sich die Bildungswege und die Karrierepläne ihrer Kinder änderten und sie auch am Richtertisch oder auf einem Lehrstuhl Platz nehmen wollten, sei die Ablehnung in der Mehrheitsgesellschaft gestiegen. Erst durch Nähe entstehe Reibung, schreibt Kohlenberger. „Hinter aufbrechenden Konflikten steht also eine Verteilungsdebatte, die so notwendig wie legitim ist.“ Bequem sei diese Debatte nicht. „Eine Streitkultur statt einer ‚Leitkultur’ zu etablieren, bedeutet eben gerade nicht, dass es zum offenen Kampf kommt.“
Die Betonung der Differenz in der gegenwärtigen Debatte über Identitätspolitik sieht die Wienerin kritisch. In jeder Abgrenzung liege eine Abwertung: Wir gegen die Anderen, die Anderen gegen Uns. Gegen die gesellschaftlichen Polarisierungen und Verhärtungen, die sie von Washington bis Berlin und Wien feststellt, wirbt Judith Kohlenberger für eine Suche nach Konsens und für einen Raum, „in dem man auch Fragen stellen kann, die schwierig sind“. In ihrem Buch gibt sie auf diese Forderungen nach „Räumen des miteinander Aushandelns“ keine Antwort, aber in einem Gespräch im Deutschlandfunk am 4. Mai räumte sie ein, dass das „Aufeinanderzukommen“ in den Zeiten einer Pandemie erschwert sei. „Es ist eine große Vereinzelung der Gesellschaft wahrzunehmen“, sagte sie. Jeder bleibe in seiner engsten sozialen Blase. „Der virtuelle Raum, das sehen wir jetzt auch an diesen rasch hochgejazzten Debatten, kann da nur bedingt eine Alternative zur physischen Begegnung sein.“
Wer aber organisiert diese Begegnungen? Wer sorgt für Räume, in denen sich niemand bedroht oder angegriffen fühlt? Judith Kohlenberger wirbt: „Gerade auf der politisch linken Seite wird natürlich immer viel für Safe Spaces (Schutzräume) plädiert. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man natürlich auch der Gegenseite einen Safe Space insofern zugestehen, als man Fragen diskutieren darf mit einem Vokabular, das man vielleicht noch nicht hat, das man sich erst mühsam erringen muss.“ Für die namhafte israelische Soziologin Eva Illouz beginnt der Kampf für Gerechtigkeit „mit dem Kampf um die richtigen Worte“. (Süddeutsche Zeitung vom 27.April). Davon sind alle „Wirs“ noch weit entfernt. Leider.
So ist der Weg zu einem demokratischen Wir noch lang und beschwerlich. Er bleibt eine Gratwanderung. Wer wagt sie mit jungen Frauen wie Emilia Roig und Judith Kohlenberger?
Letzte Änderung: 26.07.2021
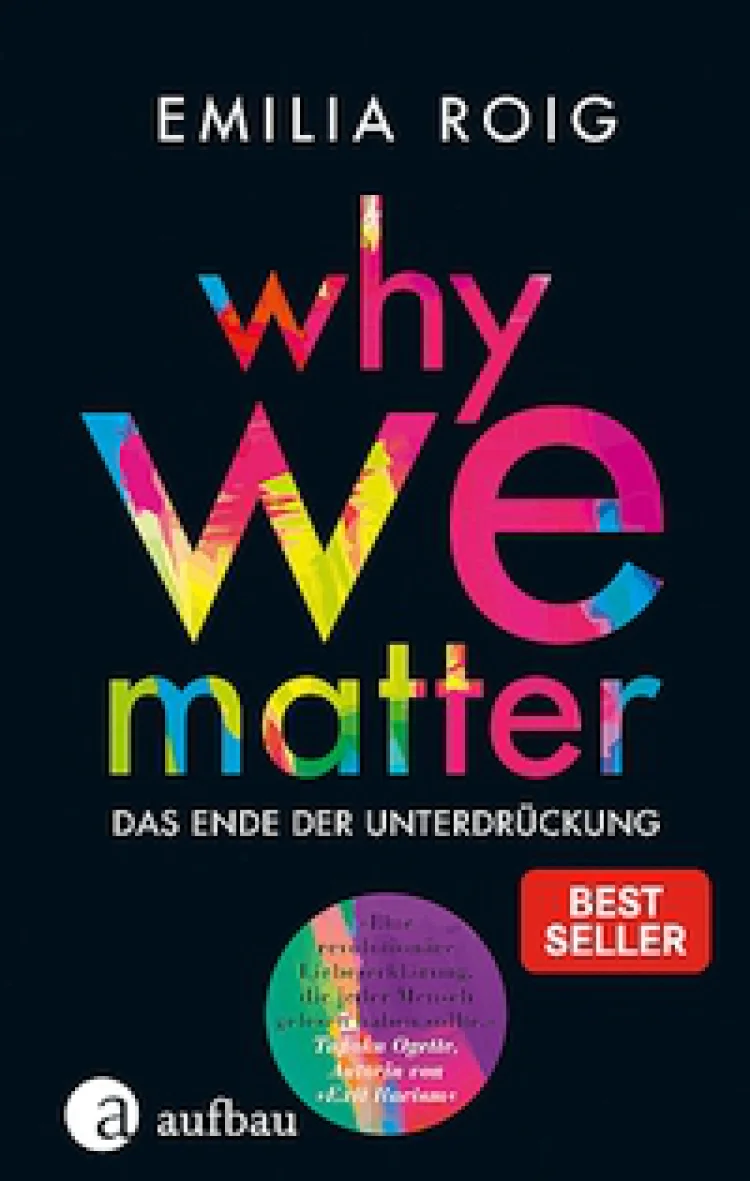

Emilia Roig
Why we matter
Das Ende der Unterdrückung
Gebunden, 397 Seiten
ISBN: 978-3-351-03847-2
Aufbau Verlag, Berlin 2021
Judith Kohlenberger
Wir
Gebunden, 107 Seiten
ISBN: 978-3-218-01255-3
Verlag Kreymayr & Scheriau, Wien 2021
Kommentare
Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.


